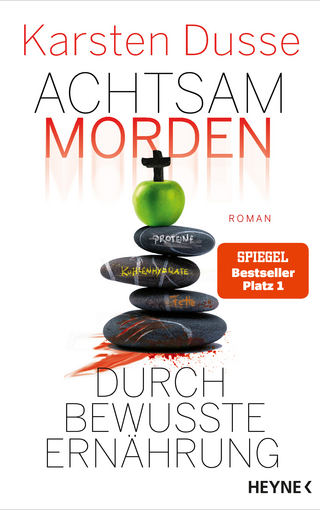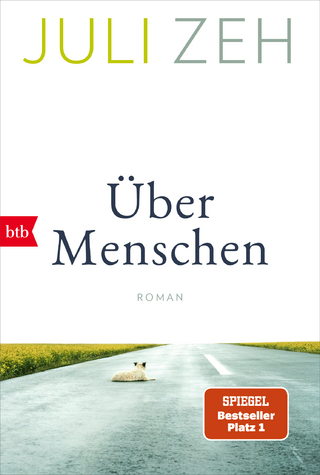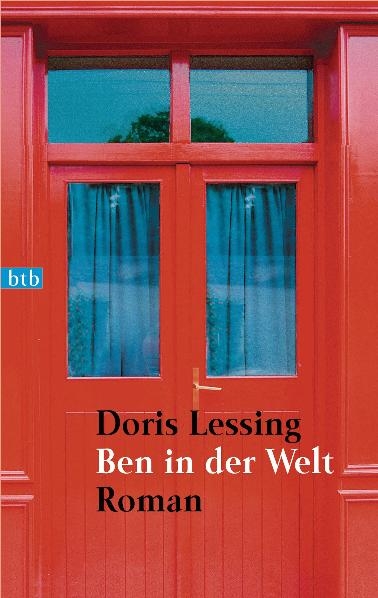
Ben in der Welt
btb Verlag (TB)
978-3-442-72741-4 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
Ben Lovatt, der destruktive Junge aus „Das fünfte Kind“, ist erwachsen geworden. Doch er findet sich nicht zurecht in dieser Welt. Die Menschen bleiben ihm fremd, so wie er den anderen ein Fremder bleibt. Noch immer aggressiv und seinen Instinkten ausgeliefert, machen ihn seine Eigentümlichkeiten zu etwas provozierend Unbegreiflichem, zu einem ungeheuer einsamen Menschen und zum Spielball der Gesellschaft.
Doris Lessing, 1919 im heutigen Iran geboren und auf einer Farm in Südrhodesien (Simbabwe) aufgewachsen, lebt seit 1949 in England. 1950 veröffentlichte sie dort ihren ersten Roman und kam 1953 mit "Eine afrikanische Tragödie" zu Weltruhm. In Deutschland
»Wie alt sind Sie?«
»Achtzehn.«
Die Antwort kam nicht sofort, denn Ben hatte Angst vor dem, was jetzt geschehen würde, dass der junge Mann hinter der Glasscheibe, die ihn vor den Besuchern schützte, seinen Kugelschreiber auf dem Formular absetzte, das er gerade ausfüllte, und mit einem Gesichtsausdruck, den Ben nur zu gut kannte, seinen Klienten musterte. Er gestattete sich, auf ungeduldige Weise belustigt zu sein, ohne dass dies den Grad von Spott erreichte. Er sah einen untersetzten, gedrungenen, kräftig gebauten Mann vor sich - er trug eine Jacke, die ihm zu groß war -, der mindestens vierzig sein musste. Und dieses Gesicht! Es war ein breites Gesicht mit sehr ausgeprägten Zügen, einem Mund, der zu einem Grinsen verzogen war - was kam dem denn eigentlich so witzig vor?-, einer breiten Nase mit bebenden Nasenflügeln, grünlichen Augen mit sandfarbenen Wimpern unter widerborstigen, sandfarbenen Brauen. Er trug einen kurzen, adretten, spitz geschnittenen Bart, der nicht zum Gesicht passte. Sein Haar war gelb und schien - wie sein Grinsen - auffallen und aufsässig wirken zu wollen, es fiel lang in einer Tolle nach vorn und in steifen Locken zu beiden Seiten herunter, als wolle es einen modischen Haarschnitt karikieren. Zu allem Überfluss sprach er mit wohlerzogener Stimme; machte er sich über ihn lustig? Der Beamte unterzog ihn dieser Minuten langen Musterung, weil er sich von Ben bis zum Grad der Verärgerung verunsichert fühlte. Er klang gereizt, als er schließlich sagte: »Sie können keine achtzehn sein. Na, los, wie alt sind Sie wirklich?«
Ben schwieg. Er war wachsam, jede seiner Fasern, denn er wusste, dass Gefahr lauerte. Er wünschte, er wäre nicht hierher gekommen, wo sich die Wände um ihn schließen konnten. Er hörte auf die Geräusche von draußen, um sich zu vergewissern, dass alles normal war. Ein paar Tauben unterhielten sich in einer Platane auf dem Gehsteig, und er war bei ihnen, dachte daran, wie sie da saßen und Zweiglein mit rosa Krallen griffen, die er sich um seinen eigenen Finger schließen fühlen konnte; sie waren guter Dinge, mit der Sonne auf ihren Rücken. Hier drinnen gab es Geräusche, die er nicht verstehen konnte, bis er jedes einzelne von den anderen getrennt hatte. Unterdessen wartete der junge Mann vor ihm, in seiner Hand den Kugelschreiber, der zwischen seinen Fingern hin und her glitt. Ein Telefon klingelte direkt neben ihm. Zu seinen Seiten saßen mehrere junge Männer und Frauen auch mit dieser Glasscheibe vor sich. Manche benutzten Instrumente, die klickten und rasselten, manche starrten auf Bildschirme, auf denen Worte erschienen und wieder verschwanden. Jede dieser lärmenden Maschinen, das wusste Ben, war ihm gegenüber wahrscheinlich feindselig. Jetzt bewegte er sich leicht zur Seite, um den Spiegelungen der Glasscheibe zu entgehen, die ihn störten und ihn nicht genau diese Person sehen ließen, die böse auf ihn war.
»Doch, ich bin achtzehn«, sagte er.
Er wusste, dass das stimmte. Als er vor drei Wintern zu seiner Mutter gegangen war - er blieb nicht, weil sein verhasster Bruder Paul hereinkam -, hatte sie in großen Buchstaben auf ein Stück Karton geschrieben:
Dein Name ist Ben Lovatt.
Deine Mutter heißt Harriet Lovatt. Dein Vater heißt
David Lovatt.
Du hast vier Brüder und Schwestern, Luke, Helen,
Jane und Paul. Sie sind älter als du.
Du bist fünfzehn Jahre alt.
Und auf der anderen Seite der Pappe hatte gestanden:
Du bist geboren am ...
Du wohnst in ...
Dieses Stück Pappe hatte Ben so sehr mit verzweifelter Wut erfüllt, dass er es seiner Mutter wegnahm und aus dem Haus rannte. Als erstes kritzelte er über den Namen Paul. Dann über die Namen der anderen Geschwister. Dann, als die Pappe zu Boden fiel und beim Aufheben die Rückseite sehen ließ, kritzelte er mit seinem schwarzen Kugelschreiber über alle Worte, die dort standen und hinterließ nur ein wildes Durcheinander von Linien.
Diese Zahl, fünfzehn, tauchte immer wieder in Fragen auf, die man ihm - so meinte er - ständig stellte. »Wie alt sind Sie?« Weil er wusste, dass sie so wichtig war, prägte er sie sich fest ein, und als das Jahr um die Weihnachtszeit wechselte, was niemand verpassen konnte, zählte er ein Jahr hinzu. Jetzt bin ich sechzehn. Jetzt bin ich siebzehn. Jetzt, wo der dritte Winter vorbei ist, bin ich achtzehn.
»Na gut, wann sind Sie also geboren?«
Seit er mit seinem zornigen, schwarzen Stift die ganze Rückseite der Pappe voll gekritzelt hatte, war ihm mit jedem Tag klarer geworden, welchen Fehler er da gemacht hatte. Und schließlich hatte er die ganze Pappe zerstört, in einem letzten Wutanfall, denn sie war wertlos geworden. Er kannte seinen Namen. Er kannte ›Harriet‹ und ›David‹, und er gab nichts um seine Brüder und Schwestern, die wünschten, dass er tot wäre.
Er erinnerte sich nicht daran, wann er geboren war.
Wie er jetzt so auf jeden Laut horchte, wurde er gewahr, dass die Geräusche in dem Besucherraum plötzlich lauter geworden waren, weil in einer Schlange von Leuten, die vor einer der Glasscheiben warteten, eine Frau begonnen hatte, den Beamten anzuschreien, der sie befragte, und wegen dieses Zorns, der sich Luft machte, begannen sich alle Schlangen zu bewegen und mit den Füßen zu scharren, und andere Leute murmelten und sagten dann laut wie ein Bellen kurze, wütende Worte wie Arschlöcher, Scheißkerle - und dies waren Worte, die Ben nur zu gut kannte, und vor denen er Angst hatte. Er spürte, wie Angstkälte von seinem Nacken das Rückgrat herunterkroch. Der Mann hinter ihm wurde ungeduldig und sagte: »Ich hab' nicht den ganzen Tag Zeit wie Sie.«
»Wann sind Sie geboren? An welchem Datum?«
»Ich weiß nicht«, sagte Ben.
Und jetzt zog der Beamte einen Schlussstrich unter die Sache und vertagte das Problem mit einem: »Besorgen Sie sich erstmal Ihre Geburtsurkunde. Gehen Sie zum Standesamt. Das wird die Sache klären. Sie wissen nicht mehr, wer Ihr letzter Arbeitgeber war. Sie haben keine Anschrift. Sie wissen Ihr Geburtsdatum nicht.«
Mit diesen Worten schweiften seine Augen von Bens Gesicht ab, und er bedeutete dem Mann hinter Ben mit einem Kopfnicken, dass er vortreten solle. Ben wurde abgedrängt und verließ schnurstracks das Amt, er hatte das Gefühl, als ständen ihm alle Haare an seinem Körper und die Haare auf seinem Kopf zu Berge, so ratlos und verängstigt war er. Draußen war ein Gehsteig mit Menschen, eine kleine Straße voller Autos, und unter der Platane, wo sich die Tauben gurrend und fröhlich bewegten, eine Bank. Er setze sich auf das eine Ende, weit entfernt von einer jungen Frau, die ihm einen Blick zuwarf, aber dann einen zweiten, die Brauen runzelte und fortging, wobei sie mit jenem Blick zu ihm zurücksah, den Ben kannte und erwartete. Sie hatte keine Angst vor ihm, dachte jedoch, dass sie bald welche haben könnte. Ihr Körper war voller Hast und Anspannung, wie auf der Flucht. Sie betrat mit einem Blick zurück einen Laden.
Ben hatte Hunger. Er besaß kein Geld. Auf dem Boden lagen ein paar zerbröselte Brotkrusten für die Tauben. Hastig, mit einem Blick in die Runde, sammelte er sie auf: Man hatte ihn schon früher wegen so etwas gescholten. Jetzt kam ein alter Mann und setzte sich auf die Bank, er starrte Ben lange an, beschloss jedoch, nicht auf das zu hören, was ihm seine Instinkte sagten. Er schloss die Augen. Die Sonne ließ das alte Gesicht leicht vor Schweiß glänzen. Ben blieb sitzen und dachte, dass er jetzt zu der alten Frau zurückgehen musste, doch sie würde enttäuscht von ihm sein. Sie hatte ihm gesagt, er solle auf dieses Amt gehen und Arbeitslosengeld beantragen. Der Gedanke an sie ließ ihn lächeln - ein sehr anderes Grinsen als das, das den Beamten geärgert hatte. Er saß da und lächelte, ein kleines Lächeln, das ein Strahlen von Zähnen in seinem Bart sehen ließ, und sah zu, wie der alte Mann erwachte und sich den Schweiß abwischte, der ihm über das Gesicht lief, wobei er zu dem Schweiß sagte: »Was? Was ist los?«, als habe der Schweiß ihn an etwas erinnert. Und dann sagte er, um sich zu rechtfertigen, in scharfem Ton zu Ben: »Worüber lachen Sie denn eigentlich so?«
Ben verließ die Bank und den Schatten des Baumes und die Gesellschaft der Tauben und ging ungefähr zwei Meilen weit durch die Straßen, er wusste, dass er in die richtige Richtung ging. Jetzt näherte er sich einer Gruppe großer Wohnblocks. Er ging direkt auf einen davon zu, und als er drinnen war, sah er den Fahrstuhl, der zischend und rumpelnd zu ihm herabgefahren kam. Er versuchte, sich selbst dazu zu bringen, ihn zu betreten, doch seine Angst vor Fahrstühlen brachte ihn zur Treppe. Eins, zwei, drei ... elf Fluchten grauer, kalter Treppen, wobei er den Fahrstuhl durch die Wand hindurch knirschen und krachen hörte. Auf dem Treppenabsatz gab es vier Türen. Er ging geradewegs auf eine von ihnen zu, aus der ein leckerer Geruch nach Fleisch drang und ihm das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ. Er drehte den Türknopf, rüttelte daran und trat dann zurück, um erwartungsvoll die Tür anzustarren, die sich öffnete. Und da stand eine alte Frau und lächelte. »Oh, Ben, da bist du ja«, sagte sie, legte ihren Arm um ihn und zog ihn in den Raum hinein. Drinnen stand er leicht geduckt und warf seine Blicke überallhin, zu allererst zu einer großen, argwöhnischen Katze, die auf einer Sessellehne saß. Ihr Fell sträubte sich. Die alte Frau ging zu ihr hinüber und sagte: »Na, na, ist ja schon gut, Mieze«, und unter den beruhigenden Händen der Frau legte sich ihre Angst und sie wurde wieder eine kleine, nette Katze. Jetzt ging die alte Frau zu Ben, mit den gleichen Worten: »Na, Ben, ist ja schon gut, komm her und setz dich.« Ben gestattete seinen Augen, von Mieze weg zu sehen, verlor jedoch seine Unruhe nicht und schickte Blicke in ihre Richtung.
In diesem Raum lebte die alte Frau ihr Leben. Auf einem Gasherd stand ein Kessel mit Eintopf, und das war es gewesen, was Ben auf dem Treppenabsatz gerochen hatte. »Ist ja schon gut, Ben«, sagte sie noch einmal und füllte Eintopf in zwei Schalen, legte große Stücke Brot neben eine der beiden für Ben, setzte ihre eigene ihm gegenüber und löffelte dann für die Katze eine Portion auf eine Untertasse, die sie neben dem Sessel auf den Boden stellte. Aber die Katze ging kein Risiko ein: Sie saß reglos da und hielt den Blick auf Ben gerichtet.
Ben setzte sich hin, und seine Hände wollten schon in den Fleischberg greifen, als er sah, wie die alte Frau den Kopf schüttelte. Er nahm einen Löffel in die Hand und gebrauchte ihn, aß vorsichtig, sich jeder Bewegung bewußt, langsam und ordentlich, obwohl es offensichtlich war, dass er großen Hunger hatte. Die alte Frau aß auch ein wenig, sah jedoch vor allem ihm zu, und als er fertig war, kratzte sie alles, was vom Eintopf übrig war, aus dem Kochtopf und lud es ihm auf den Teller.
»Ich habe nicht mit dir gerechnet«, sagte sie und meinte damit, dass sie sonst mehr gehabt hätte. »Iss dich mit Brot satt.«
Ben aß den Eintopf auf, dann das Brot. Mehr gab es nicht zu essen, außer einem Stück Kuchen, das sie zu ihm hinüberschob, aber er beachtete es nicht.
Jetzt war er nicht mehr abgelenkt, und sie sagte langsam, behutsam wie zu einem Kind: »Ben, bist du aufs Amt gegangen?« Sie hatte ihm erklärt, wie er dorthin gelangte.
»Ja.«
»Was ist geschehen?«
»Sie sagten: ›Wie alt sind Sie?‹«
Hierbei seufzte die alte Frau, fuhr sich mit der Hand ins Gesicht und rieb darin herum, als wolle sie schwierige Gedanken fortwischen. Sie wusste, dass Ben achtzehn war. Das sagte er immer wieder. Sie glaubte ihm. Doch sie wusste, dass das kein Achtzehnjähriger war, der da vor ihr saß, und sie hatte beschlossen, nicht weiter darüber nachzudenken, was das bedeutete. Es geht mich nichts an - was er wirklich ist, bringt auf den Punkt, was sie fühlte. Tiefer Abgrund! Schwierigkeiten! Besser heraushalten!
Er saß da wie ein Hund, der einen Tadel erwartet, und ließ seine Zähne mit jenem anderen Grinsen sehen, das sie kannte und inzwischen verstand, ein verzerrtes, die Zähne zeigendes Grinsen, das Angst bedeutete.
»Ben, du musst zu deiner Mutter zurückkehren und nach deiner Geburtsurkunde fragen. Sie wird sie haben, da bin ich mir sicher. Das würde dir all die Probleme und Fragen ersparen. Weißt du noch, wie du da hinkommst?«
»Ja, das weiß ich.«
»Nun, ich glaube, du solltest bald hingehen. Vielleicht morgen?«
Bens Augen ließen nicht von ihrem Gesicht ab und gewahrten jede Bewegung ihrer Augen, des Mundes, ihr Lächeln, ihre Eindringlichkeit. Es war nicht das erste Mal, dass sie ihm sagte, er solle nach Hause zu seiner Mutter gehen. Er wollte das nicht. Doch wenn sie sagte, dass er es tun müsse ... Für ihn war das Schwierige daran dies: Hier gab es Freundschaft für ihn, Wärme, Freundlichkeit, und hier gab es auch die eindringliche Forderung, dass er sich Schmerz und Verwirrung aussetzen sollte, und Gefahr. Bens Augen ließen nicht von jenem Gesicht ab, jenem lächelnden Gesicht, für ihn in diesem Augenblick das verwirrende Gesicht der Welt.
»Sieh mal, Ben, ich muss von meiner Rente leben. Ich habe nur das bisschen Geld zum Leben. Ich will dir helfen. Aber wenn du ein wenig Geld hättest - dieses Amt da würde dir Geld geben -, dann würde mir das helfen. Verstehst du das, Ben?« Ja, er verstand. Er kannte Geld. Er hatte diese harte Lektion gelernt. Ohne Geld bekam man nichts zu essen.
Und jetzt, als sei es keine große Sache, was sie da von ihm verlangte, nur eine Kleinigkeit, sagte sie: »Gut, dann ist das ja erledigt.«
Sie stand auf. »Schau mal, ich habe etwas, das, glaube ich, genau richtig für dich ist.«
Auf einem Stuhl lag zusammengefaltet eine Jacke aus einem Wohltätigkeitsladen, wo sie so lange gesucht hatte, bis sie eine mit breiten Schultern fand. Die Jacke, die Ben trug, war schmutzig, und zerrissen war sie auch.
Er zog sie aus. Die Jacke, die sie gefunden hatte, passte an den Schultern, war aber zu weit um die Taille. »Schau mal, du kannst sie enger machen.« Es gab einen Gürtel, den sie zuzog. Und da war auch ein Paar Hosen. »Und jetzt möchte ich, dass du ein Bad nimmst, Ben.«
Gehorsam zog er seine neue Jacke und die Hose aus, wobei er sie nicht aus den Augen ließ.
»Ich werde die alte Hose wegtun, Ben.« Und sie tat es. »Ich habe auch neue Unterhosen und Unterhemden.«
Nackt stand er da und beobachtete sie, wie sie nach nebenan in das kleine Badezimmer ging. Seine Nasenflügel bebten, als er das Wasser roch. Während er wartete, prüfte er alle Gerüche im Raum, den schwindenden Duft des leckeren Eintopfs, ein warmer, freundlicher Geruch; das Brot, das wie ein Mensch roch; dann ein stechender, wilder Geruch - die Katze, die ihn immer noch beobachtete; der Geruch eines Bettes, in dem geschlafen und dessen Decke über die Kissen gezogen worden war, die anders rochen. Und er lauschte auch. Der Fahrstuhl war still hinter zwei Wänden. Am Himmel konnte man ein Grollen hören, doch er kannte Flugzeuge, hatte keine Angst vor ihnen. Den Verkehr dort unten hörte er überhaupt nicht - er hatte ihn aus seinem Bewusstsein verbannt.
Die alte Frau kam zurück und sagte: »Komm, Ben.« Er folgte ihr, kletterte ins Wasser und hockte sich darin nieder. »Setz dich ruhig hin«, sagte sie. Er hasste es, sich der gefährlichen Glätte auszuliefern, doch jetzt saß er bis zur Taille im heißen Wasser. Er schloss die Augen, und mit entblößten Zähnen, diesmal durch ein resigniertes Lächeln, ließ er es zu, dass sie ihn wusch. Er wusste, dass dies Waschen etwas war, was er von Zeit zu Zeit tun musste. Man erwartete es von ihm. Eigentlich begann ihm das Wasser irgendwie zu gefallen.
Jetzt, da Bens Augen nicht mehr auf ihrem Gesicht ruhten, gestattete die alte Frau es sich, ihre Überraschung zu zeigen, der sie sonst nie nachgeben konnte.
Unter ihren Händen spürte sie einen starken, breiten Rücken, mit Zotteln braunen Haars auf beiden Seiten des Rückgrats und auf den Schultern eine Matte nassen Fells: Es fühlte sich so an, als bade sie einen Hund. Auf den Oberarmen wuchsen auch Haare, doch nicht so viele, nicht mehr als bei einem normalen Mann. Seine Brust war behaart, doch nicht wie ein Fell, sondern wie eine Männerbrust. Sie gab ihm die Seife, doch er ließ sie ins Wasser gleiten und suchte dann wütend mit den Händen danach. Sie fand die Seife, schäumte ihn kräftig ein und nahm dann eine kleine Handdusche, um alles abzuspülen. Er bäumte sich im Wasser auf, aber sie brachte ihn dazu, sich wieder hinzuhocken, und wusch seine Schenkel, sein Hinterteil und dann seine Genitalien. Er war sich dieser selbst gar nicht bewusst und so war sie es auch nicht. Und dann konnte er herauskommen, was er lachend tat und sich in dem Handtuch rieb, das sie ihm hielt. Es machte ihr Spaß, ihn lachen zu hören: Es war wie ein Bellen. Vor langer Zeit hatte sie einen Hund besessen, der so bellte.
| Reihe/Serie | btb-TB ; 72741 |
|---|---|
| Übersetzer | Lutz Kliche |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Ben, in the World |
| Maße | 118 x 187 mm |
| Gewicht | 211 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Literatur |
| Schlagworte | Taschenbuch / Belletristik/Erzählende Literatur • TB/Belletristik/Erzählende Literatur |
| ISBN-10 | 3-442-72741-3 / 3442727413 |
| ISBN-13 | 978-3-442-72741-4 / 9783442727414 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich