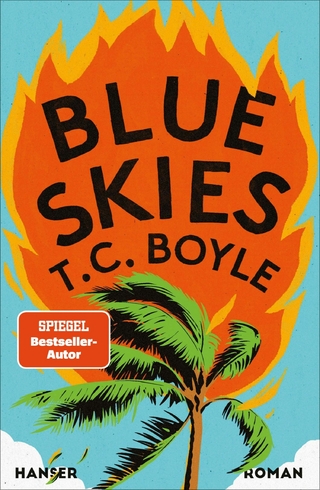Muriel (eBook)
316 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-560194-5 (ISBN)
Geno Hartlaub wurde 1915 in Mannheim als Tochter des Museumsdirektors G. F. Hartlaub geboren. Wegen der Amtsentlassung des Vaters aus politischen Gründen 1933, bekam sie keine Studienerlaubnis. Von 1945-1947 Lektorat bei der in Heidelberg erscheinenden literarischen Monatszeitschrift »Die Wandlung«, später Redakteurin des »Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatts«. Geno Hartlaub schrieb Romane und Erzählungen. Sie starb 2007 in Hamburg.
Geno Hartlaub wurde 1915 in Mannheim als Tochter des Museumsdirektors G. F. Hartlaub geboren. Wegen der Amtsentlassung des Vaters aus politischen Gründen 1933, bekam sie keine Studienerlaubnis. Von 1945–1947 Lektorat bei der in Heidelberg erscheinenden literarischen Monatszeitschrift »Die Wandlung«, später Redakteurin des »Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatts«. Geno Hartlaub schrieb Romane und Erzählungen. Sie starb 2007 in Hamburg.
I
Sie riefen über mich hinweg, mehrere Stimmen zugleich: «Muriel!» Das bin ich, kann es nicht leugnen, weiß es genau. Es gibt nur wenige Mädchen und Frauen in diesem Land, die so heißen. Sie tun alles, um mir das in Erinnerung zurückzurufen. Noch vor kurzem war ich niemand, ein ungeborenes Wesen. Ich schwamm im Fruchtwasser des Todes, in der Dämmerung großer Meerestiefen, hoffte, das Tageslicht, das in den Augen blendet, nicht noch einmal erblicken zu müssen. Mißtönend, grell, aus der Nähe, dann wieder von fern, dumpf wie durch Nebel- oder Watteschichten, klingen die Stimmen der Schwestern, stören mich auf, als ich wieder versinken möchte. Schön war es in dem Land, in dem es keine Menschen, keine Geräusche, Gerüche, nichts, was man schmecken kann, gab, nur noch Bilder mit unscharfen Umrissen, die sich im Zeitlupentempo an mir vorbeibewegten.
Muriel. Alle im Quisisana haben mich immer nur bei meinem Vornamen genannt. Ich kann Sveas singenden schwedischen Tonfall vom Krächzen der Oberschwester und von der tiefen Stimme des Schweizer Oberarztes unterscheiden. Was wollt ihr von mir? Ich gehöre nicht zu euch. Kein Liderzucken, kein Mundwinkelverziehen soll verraten, daß ich nicht mehr bewußtlos bin. Ich will weit weg sein, unerreichbar. Obgleich ihr genug Erfahrung habt, wird niemand das Täuschungsmanöver merken.
In Muriel war etwas wie Schadenfreude: Schreit euch nur heiser! Wenn ihr wüßtet, wie lächerlich euer «Muriel» für mich klingt. Ihre Lider klebten an der Wangenhaut, überm Gesicht lag noch immer eine weiße starre Schicht; sie hätte von einem Gipsabguß stammen können. Scham – das erste Gefühl, das sich in ihr regte. Mißlungen. Es war ihnen geglückt, sie aufzufischen, sie zappelte an ihrer Angel, ohne nach dem Köder geschnappt zu haben. Sie sollten endlich aufhören, ihr in Erinnerung zu rufen, daß sie Muriel war. So hieß sie, so würde das, was von ihr übriggeblieben war, weiter heißen.
Sie kam zu sich, die Sinne wachten auf. Das Gehör wurde schärfer: Hammerschläge, Vogelgezwitscher, dazu das Motorengeräusch eines Rasenmähers. Sie spürte Stiche in der Magengrube, hatte einen schlechten Geschmack im Mund. Ihre Hand, eben noch gedunsen und fühllos wie etwas, das nicht zu ihr gehörte, streckte sich nach der Wand mit der Rauhfasertapete aus. Dort, wo das Anstaltshemd sich hochgeschoben hatte, spürte sie das grobkörnige Laken des Klinikbettes an der Haut. Ein Blinzeln, versuchsweise. Als erstes erkannte sie das Fensterkreuz und das Bündel der Sonnenstrahlen auf dem Miniaturparkett des Fußbodens, den es so gemustert nur in einer einzigen Villa des Quisisana gab – im «Waldfrieden».
Auf einmal stand der Hohlwürfel des Zimmers auf dem Kopf, das Parkett war an der Decke, jeden Augenblick konnte das Bett in die Tiefe stürzen. Noch einmal schwamm sie im Traumwasser, doch es wurde immer seichter, ihre Bewegungen verlangsamten sich. Im Halbschlaf jagte sie noch einmal hinter der grünschwarzen Kapsel her – sie sah so schön giftig aus, als habe nur sie noch gefehlt, um das Ziel zu erreichen. Weiß, flach und unschuldig dagegen die Tabletten aus dem Röhrchen, die sie, in laues Leitungswasser aufgelöst, geschluckt hatte. Muriel fror, etwas kitzelte sie in der Nase. Es gab eine kleine Explosion, ein Geräusch, das zugleich schmerzhaft und befreiend aus ihrem Innern nach draußen drang – ein Niesen?
«Sie ist wieder da», hörte sie Svea sagen. Es war mißlungen, sie hatte versagt. Nicht einmal die Schwelle zu jenem Vorhof hatte sie überschritten, der erfüllt von Licht, Glück und Seligkeit sein sollte. Ihr zweites Leben, zu dem die unerwünschten Retter sie zwangen, würde blaß und schattenhaft sein, ohne Farbe und Tiefe.
Suizidverdächtig – wie lange würde das Wort noch auf ihrem Krankenblatt stehen? Jetzt spürte sie wieder das Gewicht ihres Körpers, das ihr abhanden gekommen war. Nicht weit genug weggelaufen. Eine Dilettantin, die alles nur halb und ungeschickt machte! Vielleicht lag es am Quisisana. Sie hätte es wissen müssen, sie kannte es gut genug von früher her. Auf einmal war alles wieder da. Sie hätte den Grundriß der Parkanlage – Lindenallee, Eingangstor, Rhododendrongebüsch, die Villen und Pavillons – aus dem Gedächtnis aufzeichnen können: die Kies- und Sandwege zwischen den Rasenflächen, die sternförmig auf das Rondell zuführten, wo der Brunnen plätscherte und die Sandsteinstatue Chronos Saturns auf ihrem Sockel saß, die weiße Bank, den Anlegesteg am Seeufer …
Muriel fühlte sich schwindlig, ihr war übel. Sie sehnte sich nach frischer Luft. Aber niemand war da, um das Fenster zum Park für sie zu öffnen. Alle lassen mich allein, dachte sie, bin ich es nicht einmal wert, daß jemand an meinem Bett Wache hält? Wo ist der Klingelknopf an der Wand? Ihr fehlte die Kraft, den Arm auszustrecken. Mit dem Ellbogen stieß sie an die Kante des Nachttischs.
Der Abschiedsbrief fiel ihr ein. Wenn ihn niemand entdeckt hatte, mußte er immer noch in der Schublade liegen. Weshalb hatte sie ihn geschrieben? Wen ging der Grund etwas an für ihren Entschluß, nicht mehr leben zu wollen? War es nicht Sache der Ärzte, nach einem Motiv zu suchen? Eins war Muriel trotz ihrer Benommenheit klar: Der Brief, falls er noch an seinem Platz war, mußte sofort verschwinden. Sie überlegte, auf welche Weise sie ihn vernichten konnte. Sollte sie ihn in kleine Fetzen reißen und in den Papierkorb werfen? Man hätte die Schnipsel wieder zusammensetzen können. Da man ihr Streichhölzer, Zigaretten und Feuerzeug weggenommen hatte, war es unmöglich, das Papier zu verbrennen. Vielleicht würde sie es schaffen, ohne einen neuen Schwindelanfall über den Flur zur Toilette zu gehen und den Brief, dessen Buchstaben sich in der Nässe sofort auflösen würden, wegzuspülen. Sie versuchte, sich im Bett aufzurichten. Es gelang ihr, die Schublade des Nachttischs aufzuziehen. Zwischen einem Kästchen mit Nähzeug und Schmuck und einem Stapel Papiertaschentücher lag – wie unberührt – der offene Briefumschlag ohne Namen und Adresse. Sie versteckte ihn unter der Bettdecke; sie hatte Angst, eine der Schwestern könnte sie, überraschen, wenn sie ihn noch einmal zu lesen versuchte.
Nachdem die Nachtschwester wortlos die Zimmertür hinter sich geschlossen hatte und es ganz still im Haus geworden war, zog Muriel die Nachttischlampe so nahe wie möglich an sich heran. Ihre Augen waren das Lesen nicht mehr gewöhnt, die Buchstaben verschwammen, sie bekam Kopfweh. Der Text kam ihr fremd vor, als habe ihn jemand anderes geschrieben. Sie wunderte sich, wie ordentlich sie die Buchstaben aneinandergereiht hatte, ohne Angst, ohne Hast, viel deutlicher, als sie sonst schrieb, wenn sie sich Notizen machte.
Anrede und Datum fehlten. Der Brief schien irgendwo in der Mitte anzufangen. Waren seine ersten Zeilen verlorengegangen? «Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn Du noch Augen hättest, um zu lesen, was ich schreibe.» Vom Flur her hörte Muriel ein Geräusch: Ein Patient hatte geklingelt, die Nachtschwester näherte sich mit eiligen Schritten, öffnete eines der Zimmer und lief dann noch schneller den Gang wieder zurück. Es schien eine unruhige Nacht zu werden.
«Nur Dir, der Du sie nicht mehr zur Kenntnis nehmen kannst, will ich die Geschichte erzählen», hieß es weiter in dem Brief an den Toten, «sie geht sonst niemanden etwas an: Gleich nachdem der Krieg zu Ende war, habe ich angefangen, nach Dir zu suchen. Mit meinem alten Fahrrad machte ich mich vom Quisisana aus auf den Weg über die Grenze. Drei Tage lang bin ich geradelt, zwischen Flüchtlingstrecks, Panzern und Menschen, die auf den Landstraßen scheinbar ziellos hin und her zogen. Das Wetter war schön, aber kühl, der Himmel wolkenlos. Auf einer Landkarte suchte ich den Ort, wo das Lager war, in dem wir Dich vermuteten. Ich habe am Wiesenrand im Schlafsack oder in Scheunen übernachtet. Als ich die Militärkontrollen hinter mir hatte und durch das Lagertor ging, wußte ich plötzlich, daß Du nicht mehr am Leben bist. Ich fragte mich durch bis zur Registrierbaracke. Dort zeigte man mir Deinen Namen auf einer Liste der Toten. ‹Typhus›, erklärte der diensthabende Soldat. Acht Tage, bevor die Befreier kamen, bist Du gestorben. Deine Feinde haben Dich nicht mit eigener Hand umbringen müssen.
Ich bin zusammengebrochen, als ich die Nachricht hörte. Sie haben mich auf eine Bank in der Baracke gelegt und mich nach meinen Papieren gefragt. Ein Sanitäter fand meine ‹Heimatadresse› heraus. Noch am gleichen Tag brachte mich ein Rotkreuzwagen über die Schweizer Grenze zurück, in drei oder vier Stunden war ich wieder ‹daheim›. All meine Wege scheinen im Quisisana zu enden.»
Die Luft vor Muriels Augen fing zu flimmern an. Entweder war die Lampe so schmerzend grell, daß sich die Buchstaben im Licht auflösten, oder sie litt an derselben weißen Überhelle in ihrem Kopf wie im Lager, kurz bevor sie das Bewußtsein verlor. Die letzten Worte des Abschiedsbriefs, die sie entziffern konnte, irgendwo unten auf der sich auflösenden Seite, lauteten:
«Ich werde den Schritt tun, der mich befreit. Ich werde Dir nachfolgen.»
Wie lange stand Gregor schon in seinem Arztkittel am Fußende des Bettes? Regungslos, klein, älter geworden, wie ihr schien, mit fast farblosen, aber scharfen Augen hinter der Brille. Warum sagte er kein Wort, weshalb tat er so, als sei sie nicht Muriel, sondern eine neu eingelieferte Patientin, die er noch nie gesehen hatte? Jetzt schrieb er ein paar Worte auf die Krankentafel, holte sein Stethoskop aus der Tasche, öffnete Muriels Anstaltshemd und hörte Herz und Lunge ab, kurz und routinemäßig. Bevor Gregor eintrat, hatte sie in der...
| Erscheint lt. Verlag | 15.4.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Berlin • Bremen • Deutschland • Drittes Reich • Familienroman • Historischer Roman • Roman • Schweiz • Weimarer Republik |
| ISBN-10 | 3-10-560194-5 / 3105601945 |
| ISBN-13 | 978-3-10-560194-5 / 9783105601945 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 757 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich