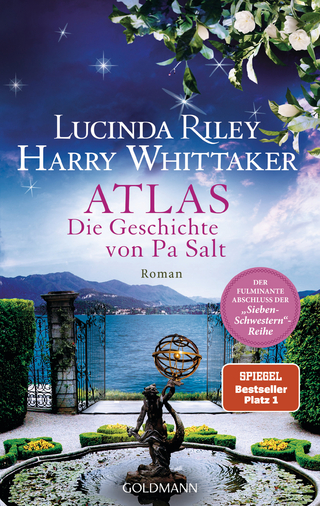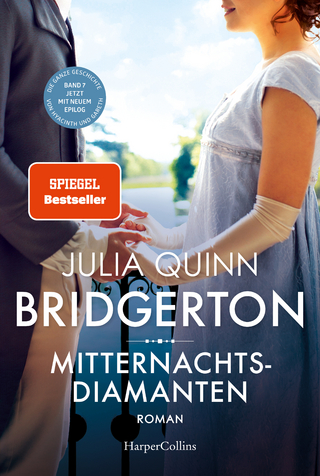Sehnsuchtsland
Francke-Buch (Verlag)
978-3-86827-591-9 (ISBN)
Doch dann bricht der Erste Weltkrieg aus und ihre Träume zerplatzen wie eine Seifenblase. Hildegard ahnt nicht, welch turbulente Zeiten ihr noch bevorstehen. Sie ahnt nicht, dass sie schon bald im Berlin der 20er-Jahre leben und nicht nur einen, sondern zwei Weltkriege wird meistern müssen. Vor allem aber ahnt sie nicht, welche Umwege das Leben sie noch führen wird, bevor sie endlich das findet, wonach sie sich am meisten sehnt: ein Zuhause.
Irma Joubert lebt in Südafrika. Sie studierte Geschichte an der Universität von Pretoria und war fünfunddreißig Jahre lang Lehrerin an einem Gymnasium. Nach ihrer Pensionierung begann sie mit dem Schreiben. Die Historikerin liebt es, gründlich zu recherchieren und ihre Romane mit detailreichen Fakten zu untermauern. In ihrer Heimat und den Niederlanden haben sich ihre historischen Romane zu Bestsellern entwickelt und sind mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden.
Prolog „Hildegard?“ Instinktiv schaut sie auf, blickt dann aber sofort wieder zu Boden. „Hildegard von Plötzke?“ Sie hört das Erstaunen in seiner Stimme. „Wahrhaftig, Hildegard von Plötzke aus Königsberg! Wie ... wie um alles in der Welt bist du denn hier gelandet?“ Ja, wie um alles in der Welt ist sie hier gelandet? Und dazu noch auf diese Weise! 1. Kapitel Das Früheste, an das sie sich erinnern kann, ist ein gelber Lichtschein, der durch die Fenster fällt, und an Nanny, die sich über sie beugt, während sie in ihrem Kinderbettchen liegt. Aber das sind ganz vage Erinnerungen, so verblasst wie die Fotos im Album ihrer Mutter, das sie immer noch besitzt. Sie meint, sich auch noch daran erinnern zu können, wie Papa am oberen Ende eines sehr langen Tisches sitzt. Doch dieses Bild ist ganz und gar verschwommen. Vielleicht erinnert sie sich auch nur an ein Foto, das sie einmal gesehen hat und nun nicht mehr aus ihrem Kopf bekommt. Die Erinnerung an die rote Nacht, in der Nanny sie aus ihrem großen Bett gerissen hat, ist deutlicher. In dieser Nacht mussten sie aus Russland fliehen. Irgendwo schreien Menschen. Es ist dunkel und sie ist noch ganz verschlafen, ihre Augenlider sind so schwer, dass sie sie kaum öffnen kann. Da schreien tatsächlich Menschen. Irgendwo weit weg. Sie hört, wie die Tür geöffnet wird, bevor sie es sieht. Nanny stürmt herein. „Komm, Hildegard!“ Bevor sie sich aufrecht hinsetzen kann, ist Nanny schon bei ihr, hüllt sie in ihre Decke und reißt sie aus dem Bett. Sie weiß nicht, was mit ihr geschieht. „Nanny?“ Nanny sagt kein Wort. Sie rennt mit kleinen, schnellen Schritten aus dem Zimmer. Nirgendwo brennt Licht. Doch von draußen fällt ein roter Lichtschein herein. „Warum ist alles so rot?“, will sie wissen. Auf der Treppe holt Papa sie ein. Er reißt sie Nanny aus dem Arm. „Holen Sie für das Kind Schuhe und eine Jacke und dann kommen Sie in mein Studierzimmer!“ „Yes, Herr von Plötzke.“ Papa rennt mit ihr die Treppe hinunter, wobei er immer zwei Stufen auf einmal nimmt. „Still, sei ruhig!“ Seine rauen Bartstoppeln kitzeln sie an der Wange, der leichte Brandgeruch seines Schnauzers kribbelt ihr in der Nase. Sie hat Angst und drückt ihren Körper fester an die breite Brust ihres Vaters. Dieser rennt durch das Esszimmer hindurch ins Studierzimmer. „Charlotte, ich hole Geld“, sagt er schnell und geht zum Schrank. „Mach erst die Tür auf“, hört sie die Stimme ihrer Mutter sagen. Die Stimme hört sich seltsam an, irgendwie verkniffen. Dann zaubert ihr Vater. Er zaubert wirklich, denn das ist kein magischer Trick: Er steht vor dem Schrank und sagt leise etwas – sie meint, vielleicht hat er wirklich so etwas wie „Abrakadabra“ gesagt – dann gleitet der gesamte Bücherschrank nach hinten weg. „Papa?“ Er zündet eine Lampe an und reicht sie ihrer Mutter. „Schnell, ich will nicht, dass irgendjemand das Licht sieht.“ „Papa?“ Diesmal antwortet ihre Mutter: „Hildegard, sei still.“ Daraufhin stellt sie keine weiteren Fragen mehr. Nanny nimmt sie an der Hand. „Pass auf, da sind Stufen runter.“ Nanny spricht ein komisches Deutsch. Der Boden unter Hildegards nackten Füßen wird auf einmal eiskalt, das Licht wird schwach, es ist nur noch ein gelber Schein in der schwarzen Finsternis. Vorsichtig steigt sie die Treppe hinunter. Ihre Mutter geht mit der Lampe voraus. Es sind schmale Treppenstufen, die ungewöhnlich hoch sind. „Ich kann nichts sehen“, sagt sie zu Nanny. „Mach schnell, Hildegard.“ Die Stimme ihrer Mutter klingt streng. Am unteren Ende der Treppe, tief im Bauch der Erde, tut sich vor ihr ein Gang auf. Verwundert bleibt Hildegard stehen. Dass es unter ihrem Haus einen geheimen Gang gibt, das hat sie nicht gewusst. Die bittere Kälte kriecht ihr nun langsam die Beine hinauf. Hinter ihr schiebt ihr Vater von innen die Tür zu und eilt hastig die Treppe hinunter. Er nimmt sie auf den Arm, jetzt sind ihre Füße nicht mehr kalt. So schnell sie können, schieben sie sich alle durch den engen Gang: vorneweg ihre Mutter mit dem Licht, dann Nanny mit der Federdecke und einem Kleiderbündel und am Schluss ihr Vater, der sie trägt. Irgendetwas stimmt nicht. „Papa, was ist denn los?“ „Nein, jetzt nicht, sei still.“ Am Ende des Gangs befindet sich eine Leiter und über ihr eine Falltür. Ihr Vater setzt sie ab, klettert die Leiter hinauf und öffnet die Tür. „Komm schnell, Charlotte, und macht die Tür wieder zu, wenn ihr alle draußen seid.“ Sie klettert die Leiter hinauf, Nanny folgt ihr dicht auf den Fersen. Irgendwo schnaubt leise ein Pferd. Als schließlich auch ihre Mutter mit dem Licht hinaufkommt, sieht Hildegard zum ersten Mal, wo sie ist. „Der Gang führt ja ins Warenlager.“ Nannys Stimme hört sich ein bisschen streng an. „Ja, da bist du recht. Aber jetzt steig in die Kutsche, ich helfe deinem Vater mit den Pferden.“ Irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas ist furchtbar verkehrt. Ihr Vater macht sich an etwas zu schaffen und fängt an zu fluchen. Das ist schlimm, denn Fluchen ist Sünde und dann kommt der Teufel und holt die Leute. Das weiß sie, weil Nanny es ihr erzählt hat. Endlich klettert auch Nanny in die Kutsche und macht hinter sich die Tür zu. Schon setzt sich die Kutsche in Bewegung. „Wo ist denn Papa?“, fragt Hildegard wie benommen. „Schhht!“ Nanny erstickt sie beinahe unter der Federdecke. Sie versucht sich aus der Decke zu wühlen, weil sie sehen möchte, was geschieht. „Hildegard, sitz still!“, schimpft ihre Mutter. Endlich bekommt sie den Kopf frei. „Ich will wissen, wo Papa ist.“ Nanny spricht leise: „Er fährt die Kutsche. Hier, zieh an deine Jacke. Und gib mir deine Füße, damit ich dir anziehen kann deine Schuhe.“ Jetzt ist sie sich sicher, dass etwas nicht stimmt. Ihr Vater hat noch nie auf dem Kutschbock gesessen. „Warum denn?“ „Hildegard, sei jetzt endlich still!“, verwarnt ihre Mutter sie sehr streng. Da ist sie still. Durch die kleinen Fenster sieht sie verschwommen die Sterne über ihnen. Draußen ist es finster, der Mond ist nicht zu sehen, nur ein rotes Glühen überall. Als sie sich umdreht, kann sie hinter ihnen die Umrisse des großen Hauses erkennen. Wie ein dunkler Schatten steht es vor der roten Glut. Das große Eisentor steht sperrangelweit offen. Das ist auch verkehrt, denn das Eisentor steht sonst nie offen. Jetzt muss sie aber wissen, was los ist. „Warum fahren wir, obwohl es dunkel ist?“, fragt sie Nanny im Flüsterton. „Was ist denn das für ein großes Feuer, da hinter dem Haus?“ Die Antwort kommt allerdings von ihrer Mutter und ihre Stimme hört sich merkwürdig an. „Das waren die Bolschewisten. Wenn dein Vater beizeiten auf mich gehört hätte, dann wären wir jetzt nicht in diesem Schlamassel. Ich habe nichts mitnehmen können, gar nichts.“ Die Pferde fangen an zu traben, die Kutsche holpert ruckend hinterher. „Meine Juwelen, meine Pelze, alles ...“ Ihre Mutter hört sich sehr zornig an. Nanny sagt leise: „Wir gehen für ein bisschen weg, Hildegard.“ Wir gehen für ein bisschen weg? Manchmal sind sie zu dem Haus am See gefahren, aber nur im Sommer, wenn es heiß war. Oder sie sind zum Herrn Baron von Schwarz gefahren. Ihr Vater geht dort zusammen mit anderen Männern auf die Jagd, während ihre Mutter dann mit anderen Frauen Tee trinkt. Aber nachts sind sie noch nie aufgebrochen. „Fahren wir weg, weil da ein Feuer ist?“ Nanny bedeutet ihr, dass sie ruhig sein soll, und streicht ihr übers Haar. Ihre Mutter seufzt. „Ach, erzähl dem Kind ruhig, was los ist. Ich habe keine Kraft mehr, mir seine ewige Fragerei anzuhören.“ Nanny tastet unter der Daunendecke nach ihrer Hand. „Wir fahren für eine Zeitlang weg.“ „Oh.“ Plötzlich fällt ihr etwas anderes ein. Ihr Herz beginnt zu springen und sie holt tief Luft. „Nanny, heißt das ...?“ Im selben Augenblick hallt der Knall eines Pistolenschusses durch die eisige Luft, unmittelbar danach ertönt ein zweiter. Hildegard zuckt vor Schreck zusammen. Die Pferde bäumen sich auf, die Kutsche schwankt gefährlich, mit einem Ruck setzt sie sich schneller in Bewegung. Die verängstigten Pferde laufen, so schnell sie können. Die Kutsche rattert hinterher und schwankt dabei so sehr, dass die Insassen von einer Seite zur anderen geworfen werden. Hildegard spürt, wie Nanny den Arm um sie legt. Erschrocken klammert sie sich an ihr fest. Es kommt ihr so vor, als würde die Kutsche jeden Augenblick umstürzen. „Herr, hilf uns! Herr, Herr, hilf uns!“, betet ihre Nanny leise. Ihr Vater hält das Fahrzeug auf dem Weg, bis die Pferde langsamer laufen und die Kutsche sich nur noch sanft hin und her bewegt. Vorsichtig öffnet Hildegard die Augen wieder. Der Herr hat ihnen geholfen, das weiß sie. Nanny erzählt ihr schließlich jeden Tag etwas vom Herrn. Sie müssen weit fahren. Hildegard gräbt sich tief in den weichen, warmen Schoß von Nanny. Dort ist sie sicher. Eigentlich ist es ganz schön, die Kutsche schwankt nur noch ein bisschen. Eine wohlige Schläfrigkeit macht sich in ihr breit. Unvermittelt bleibt die Kutsche stehen und Hildegard hebt neugierig den Kopf. „Wo sind wir?“ „Am Bahnhof, wir reisen jetzt weiter mit dem Zug“, antwortet Nanny. „Dein Vater geht Fahrkarten kaufen.“ Als die Kutschentüren wieder geöffnet werden, sagt ihre Mutter: „Ich hoffe, du hast Fahrkarten für die Erste Klasse bekommen. Bis nach Königsberg ist es eine weite Reise.“ Königsberg? Ihr Vater streckt seine Hand aus, um ihrer Mutter beim Aussteigen aus der Kutsche behilflich zu sein. „Komm schon, Charlotte. Ich habe die einzigen Karten gekauft, die es noch gab.“ Ihre Mutter richtet ihren Kopf in die Höhe, rafft ihren weiten Rock zusammen und steigt langsam die Stufen der Kutsche hinunter. „Komm, Hildegard.“ Ihre Stimme klingt eisig. Nanny steigt als Letzte aus der Kutsche, die Federdecke trägt sie wie ein Bündel in den Armen. Auf der untersten Stufe fällt sie beinahe über die Decke. Die Kälte schneidet Hildegard in Nase und Wangen. Sie versucht sich tiefer in ihre Jacke zu kuscheln und zieht die Arme ein, sodass auch ihre Hände in den Ärmeln verschwinden. Der Bahnhof ist klein, nicht so groß wie der von Sankt Petersburg. Am Bahnsteig wartet schon der Zug auf sie und bläst dabei weiße Rauchwölkchen in Richtung der Gleise. In Decken eingehüllt stehen auch noch andere Menschen herum, sie reden Russisch. Alle Knechte und Mägde, die im Haus gearbeitet haben, haben Russisch gesprochen. Hildegard kann Russisch verstehen. Auch Englisch, denn Nanny ist Engländerin. Am Zug angekommen hilft ihr Vater ihrer Mutter beim Einsteigen, dann steigt auch Nanny ein. Ihr Vater hebt Hildegard hoch und reicht sie an Nanny weiter, einfach so durchs geöffnete Fenster. „Kommt Papa auch mit?“ „Ja, Hildegard, ich komme auch mit.“ Ihr Vater ist ein großer Mann mit einer schönen Stimme. Sie sind lange unterwegs, Hildegard schläft auf Nannys breitem Schoß. Mittlerweile ist es Tag geworden und dann irgendwann Nachmittag. Außer ihnen sind noch andere Erwachsene im Bahnabteil. Aber ihre Mutter spricht mit niemandem, sie ist sehr wütend. Die Erwachsenen unterhalten sich manchmal, meist über den Krieg. Über den Krieg mit Japan weiß sie alles, Japan ist das Land, in dem Prinzessin Koong-se gewohnt hat. Nanny hat ihr die Geschichte von Prinzessin Koong-se und Chang erzählt. Das Bild dazu kann man auf einem blauen Teller in ihrem Esszimmer bewundern. Die Erwachsenen reden über Zar Nikolas II. Sie weiß, dass das der König von Russland ist und dass er wie Koong-se in einem Schloss wohnt. „Ich vermute, diese Bolschewisten wetzen ihre Messer vor allem gegen den deutschen Adel. Schließlich haben viele der Gutsbesitzer dabei geholfen, den Aufstand zu unterdrücken, vor allem in Sankt Petersburg“, sagt der Mann mit dem riesigen Schnauzbart. Bolschewisten – das ist ein merkwürdiger Name. Andererseits sind Koong-se und Chang auch merkwürdige Namen. Die Bolschewisten wetzen Messer, die sie in die Deutschen stechen wollen, hat der Mann gesagt. Messer sind eine gefährliche Sache, etwas, womit man sich schnell in den Finger schneiden kann, und dann fängt es an zu bluten. Hildegard mag kein Blut sehen. Die Erwachsenen reden über Lenin, über das Winterpalais und den Blutsonntag. Das Winterpalais hört sich nach einem Märchen an, aber Blut? Igitt! Und Blut am Sonntag ist bestimmt eine furchtbare Sünde. Das sind alles Schauergeschichten, entscheidet Hildegard schnell. Ihr Vater war ganz überrascht darüber gewesen, dass sie die Geschichte von Koong-se und Chang gekannt hatte. Er hatte einen Teller aus dem Schrank geholt, damit sie ihn anfassen konnte. „Die Kreuzritter haben die Geschichte damals aus China mitgebracht“, hatte er erklärt. Während der Zug die Anhöhen hinaufstampft und schnauft und die Abhänge immer schneller hinunterrattert, erzählt ihr Vater ihr von Kurland. Das ist die Gegend, in der die Vorfahren ihres Vaters immer gewohnt haben. Sie waren Ritter des Deutschen Ordens und haben Kleider aus Eisen getragen, sind auf Pferden geritten und haben mit Schwertern gekämpft und die Bibel in den Wilden Osten gebracht. Hildegard versteht: Sie sind genauso wie die Kreuzritter gewesen, die Koong-ses und Changs Geschichte aus China hergebracht haben. „Ich gehöre auch noch zum Ritterorden, weißt du, Hildegard. Aber wir tragen keine eiserne Kleidung mehr und kämpfen auch nicht mehr mit Schwertern. Wir helfen jetzt den Menschen, die es schwer haben.“ Ihr Vater ist wirklich tapfer. „Mmm“, macht ihre Mutter und schaut aus dem Zugfenster. Ihr Vater tut so, als habe er es nicht gehört. Hildegard versucht so etwas auch manchmal, aber immer wenn sie es probiert, funktioniert es nicht. „Wir werden in Königsberg wohnen. Mama und ich haben dort ganz am Anfang auch schon gewohnt, bevor wir nach Russland gezogen sind.“ „Und ich? Und Nanny?“ „Nein, du bist erst zur Welt gekommen, als wir schon in Sankt Petersburg gewohnt haben.“ „Ist Königsberg in Kurland?“ „Das gehört jetzt alles zu Preußen, Königsberg ist die Hauptstadt von Ostpreußen.“ Das sind schöne Worte, Königsberg und Kurland. Die Nacht ist dunkel und voller fremder Geräusche, angsteinflößender Geräusche, sodass man nicht schlafen kann. Wir sind den Bolschewisten entkommen, denkt Hildegard. Wie sieht so ein Bolschewist wohl aus? Doch das Bild, das plötzlich in ihrem Kopf auftaucht, das Bild von wilden, behaarten Monstermenschen mit aufgeblasenen Backen, langen Armen und scharfen Messern in den Händen, mit denen sie Jagd auf Deutsche machen, flößt ihr solch einen Schrecken ein, dass sie sofort an etwas anderes denken möchte. Als Koong-se und Chang geflohen sind, ist ihr Vater mit einer Peitsche in der Hand über eine Brücke hinter ihnen hergerannt. Wenn er sie zu fassen bekommen hätte, hätte er sie sicherlich totgeschlagen, hat Nanny immer gesagt. Und selbst als sie später auf einer einsamen Insel gewohnt haben, haben sie die Soldaten schließlich doch gefunden. Zum Glück hat Gott sie in zwei Tauben verwandelt, sodass sie so weit wegfliegen konnten, dass sie niemand mehr hat finden können. Aber Hildegard möchte eigentlich keine Taube werden. Die Räder der Eisenbahn rattern immer weiter weg von dem blauen Teller im Glasschrank ihres Esszimmers in Sankt Petersburg. Nanny ist noch nie in dem Haus in der Nähe von Königsberg gewesen. Es handelt sich um ein kaltes Schlösschen mit Gängen und Zimmern und vielen Türen, die einen schnell durcheinanderbringen können. In diesem Haus ist Hildegards Mutter groß geworden. Alle dort kennen Mama und Papa, nur Hildegard und Nanny sind Fremde. Sie betrachten sich die Küche, den Speisesaal mit seinem langen Tisch, das Wohnzimmer, das Musikzimmer, die Bibliothek, das Raucherzimmer der Männer. „Smoking room“, sagt Nanny und rümpft die Nase. Hildegard klammert sich fest an ihre Hand. Die fremde Haushälterin, Frau Wagner, zeigt ihnen alles. Sie geht sehr aufrecht und spricht Deutsch, kein Russisch. Über die breite Treppe gehen sie nach oben und schauen ins Zimmer ihrer Mutter und in ihr Boudoir. „Was ist das?“, will Hildegard wissen. Nanny bedeutet ihr still zu sein. Hildegard weiß, dass Nanny ihr hinterher alles erklären wird. Sie betrachten das Zimmer ihres Vaters, sein Studierzimmer, die Gästezimmer und noch einen Raum voller Bücher. Durch die vorderen Fenster kann man einen Blick auf den großen Garten werfen und in der Ferne sind die Gebäude von Königsberg zu erkennen. Hinter dem Haus sind die Stallungen und der Schweinepferch und die Reihen von Zimmern, in denen die Knechte und Dienstmägde schlafen. Als sie am äußersten Ende des Ganges angekommen sind, sagt Frau Wagner: „Hier ist dein Zimmer.“ Hildegard blickt sich in dem großen Raum um. Sie sieht ein hohes Prinzessinnenbett mit einem Vorhang drum herum. Da steht auch ein Spiegeltisch mit einer Waschschüssel und einem Krug. Die Haarbürste, der Kamm und der Handspiegel sind mit pinken Röschen verziert. Im Spiegel sieht Hildegard ihre hellen Haare, die Nanny zu zwei festen Zöpfen geflochten und mit einem breiten Band zusammengebunden hat. Sie hat noch nie eine Prinzessin gesehen, die so steife Zöpfe gehabt hätte. In der Ecke steht ein Kachelofen, das Feuer darin wärmt den ganzen Raum. Außer dem Bett und dem Spiegeltisch gibt es keine weiteren Möbel. Da macht Frau Wagner eine andere Tür auf. „Hier ist dein Spielzimmer.“ Es ist ein kleiner Raum mit einem Bücherregal und einem Schaukelpferd. Auf dem Boden liegt ein großer, bunter Teppich und vor dem Fenster steht ein Lehnstuhl. Hildegard blickt sich um. „Wo ist denn das Zimmer von Nanny?“ Frau Wagner hat eine lange, spitze Nase und strenge Augen. Haben nicht auch die Bolschewisten solche langen, spitzen Nasen, die wie ein Messer aus ihren aufgeblasenen Backen herausstechen? Frau Wagners Stimme ist so streng wie ihre Augen: „Sie wohnt in den Quartieren hinter der Küche.“ Hinter der Küche? Hildegard kommt es so vor, als würde ihr ein schwerer Stein um ihren Hals die Luft abschnüren. Hinter der Küche? Das ist ja auf der anderen Seite des Hauses! „Ich kann nicht ...“ Nanny legt ihr den Finger auf den Mund. „Wir reden später darüber“, sagt sie sanft. Die Worte verschwinden, aber der Stein bleibt, wo er ist. Schließlich dreht sich Frau Wagner um: „Wir essen pünktlich um sieben Uhr, ihr esst im Frühstückszimmer.“ Als die Tür hinter ihr ins Schloss fällt, wendet sich Hildegard augenblicklich Nanny zu: „Ich schlafe hier nicht allein und ich glaube, dass die Frau eine Bolschewistin ist.“ „Eine Bolschewistin? Nein, nein, Bolschewisten sprechen Russisch. Komm, lass uns schauen, was in dem Schrank hier ist“, antwortet sie und öffnet die Schranktür. „Nein!“ Hildegard stampft fest mit dem Fuß auf den Boden. „Ich habe Angst vor den Bolschewisten und ich will nicht allein schlafen!“ Nanny setzt sich auf den großen Lehnstuhl vor dem Fenster und streckt die Beine aus. Sie hat schwarze Schuhe an mit Schnürsenkeln und langen, dicken Strümpfen. „Ich bin doch immer im Haus.“ „Nein, nein, du bist ganz, ganz weit weg von meinem Zimmer. Du wirst es nicht hören, wenn ich nachts rufe.“ „Ich werde jede Nacht kommen und schauen, ob du ruhig schläfst. Du darfst jetzt keinen Aufstand machen, das ist nicht schön für ein Mädchen, verstehst du?“ Ein wütendes Schreien braut sich tief in ihr zusammen. Doch Hildegard beschließt, lieber zu weinen, denn ihr Weinen erregt immer Nannys Mitleid. „Ich kann nicht allein schlafen. Ich bin noch zu klein.“ Nanny holt ihr Taschentuch hervor. „Ach, nein, hör doch auf, Hildegard, du bist nicht mehr so klein. Es dauert nicht mehr lange, dann wirst du sechs Jahre alt, das ist schon groß. Komm, komm her, setz dich hier zu mir. Ach nein, weine doch nicht.“ Nanny hat einen breiten, weichen Schoß und sanfte Arme, die sich um einen legen. „Aber ich ...“ Da geht die Tür auf und ihr Vater kommt herein. „Was ist hier los?“ Ihr Vater mag es nicht, wenn sie weint. Und so schluckt Hildegard schnell ihre Tränen hinunter und setzt sich aufrecht hin. „Ich will nicht, dass Nanny unten neben der Küche wohnt. Das ist zu weit weg von mir.“ Kerzengerade steht ihr Vater da und sieht plötzlich streng aus. „Hildegard, ich möchte diesen Unsinn nicht noch einmal hören. Wenn du ein Junge wärst, dann würdest du mit sechs Jahren in ein Kadetteninternat gehen. Du musst jetzt anfangen, selbständig zu werden. Miss Jones, sind Sie mit Ihrem Quartier zufrieden?“ Nanny schiebt Hildegard sanft von ihrem Schoß und steht auf, wobei sie Schwierigkeiten hat, sich aus dem Lehnstuhl zu erheben. „Ich habe mein Quartier noch nicht gesehen, Herr von Plötzke, aber ich bin mir sicher, dass es in jeder Hinsicht zufriedenstellend sein wird.“ „Dann schlage ich vor, dass Sie sich dorthin begeben. Die Schneider kommen morgen, um Maß zu nehmen, das Kind soll Kleider und Sie eine Uniform bekommen. Hildegard, spiel mit deinem Spielzeug.“ In der Regel ist ihr Vater freundlich, aber er kann auch ganz schön ungeduldig sein. Nach Tagen und Wochen kommt Hildegard das neue Haus allmählich bekannt vor, sie lernt auch die fremden Menschen kennen. Die Köchin, Madame Dubois, kommt aus Frankreich, sie spricht Französisch und kocht auch französisches Essen. „Das ist üppig, sie nimmt zu viel Sahne“, sagt Nanny und bestreicht Hildegards Brot mit einer dünnen Schicht Gänseleberpastete. Dann schneidet sie sorgfältig die Kruste ab. Hildegards Zähne graben sich tief ins weiche Brot. Morgens kommt Frau Faber, sie ist die Gouvernante und bringt Hildegard das Lesen, Schreiben und Rechnen bei. Sie erzählt ihr auch von Adam und Eva, von Noah und Vater Abraham und Moses und seinem Binsenkörbchen und von Daniel in der Löwengrube. Sie erzählt ihr auch die Geschichte von Maria und Josef und dem Jesuskind, die nach Ägypten fliehen mussten. „Wir mussten auch fliehen, vor den Bolschewisten“, sagt Hildegard. Sie lernt die Geschichte von Kurland kennen, aber nicht die von den tapferen Rittern in ihrer eisernen Kleidung, die den wilden Menschen aus dem Osten die Bibel gebracht haben – die hat ihr Vater ihr schon erzählt. Stattdessen hört sie so viel über die unterschiedlichen Kriege, dass ihr der Kopf schwirrt. „Das sind keine schönen Geschichten“, sagt sie nachmittags zu Nanny. „Warum müssen die Menschen nur immer Krieg machen?“ „Das ist alles der alte Teufel“, antwortet Nanny und schlingt die Wolle geschickt um die Stricknadeln. Nanny bringt Hildegard das Stricken bei, sie kann es schon ganz gut. Erst wollte sie sich ein Kleid stricken, aber jetzt strickt sie ein Halstuch für ihre Puppe. Sie lernt, wie man Kreuzstiche macht und Assisi-Stickerei. Nanny ist sehr genau, alle Kreuzchen müssen an derselben Stelle über Kreuz gehen und auf der Rückseite müssen alle Stiche ein einheitliches Muster ergeben. An einem anderen Tag bringt Nanny Hildegard das Spitzenklöppeln bei. Dabei sitzt sie ordentlich auf ihrem Stuhl, das Lernkissen auf dem Schoß. Nanny zeigt ihr vorsichtig, wie sie die Baumwollfäden ineinanderschlingen und verknoten muss, damit sie eine saubere Kante formen. Das ist allerdings ziemlich schwierig und Hildegard würde lieber Vater-Mutter-Kind spielen. Wenn es nicht zu kalt ist und nicht regnet, gehen sie und Nanny in den Garten. Aber Hildegard darf dann nicht rennen, denn Damen machen schöne kleine Schritte. Sie gehen die Küken und Kälber anschauen und die runden, rosa Ferkel. Nanny geht langsam und erklärt ihr die Blumen und die Insekten. Nach ihrem siebten Geburtstag bekommt Hildegard an drei Nachmittagen in der Woche Musikunterricht. Meister Schroeder kommt mit einem Pferdewagen zu ihrem Haus, sie zieht die Decke von dem Klavier und öffnet den Tastendeckel. „Sind deine Hände sauber?“, fragt er. „Ja, Meister Schroeder.“ „Na gut, dann setze dich aufrecht vor das Klavier, das Kinn hoch, die Finger leicht gekrümmt, die Handflächen rund. Und denke daran, deine linke Schulter nicht zu bewegen.“ „Das verstehe ich nicht, Meister.“ „Du schwingst deine Schulter im Rhythmus mit. Lass das.“ „Gut, Meister.“ Sie lernt alle Noten zu spielen, angefangen vom eingestrichenen C bis hin zu den schwarzen Tasten. Im darauffolgenden Jahr kommt er jeden Nachmittag, jetzt bringt er ihr zusätzlich an zwei Tagen in der Woche auch das Geigespielen bei. Das ist ziemlich schwer und Hildegard tun die Finger weh, während sie die Saiten herunterdrückt. Dann fangen auch noch ihre Beine an zu jucken, weil sie die ganze Zeit kerzengerade stehen muss, während sie spielt. Manchmal sieht sie durch das Fenster, wie die Kinder der Arbeiter draußen herumtollen. „Ich wünschte, ich könnte mit ihnen spielen“, sagt sie abends zu Nanny. „Nein, das wäre nicht gut“, antwortet Nanny. Aber daraufhin erzählt Nanny Hildegards Vater, dass seine Tochter auch gern eine Spielkameradin hätte. Jetzt kommt Brigitte, die Enkelin von Herrn Baron Müller, dienstagabends zum Spielen vorbei. Dazu kommen auch noch andere Mädchen mit ihren zu Locken gedrehten Haaren und hellen Zöpfen. Sie spielen im Spielzimmer mit Puppen und essen Plätzchen und trinken kalte Getränke, die ihnen ein Küchenmädchen nach einer Weile vorbeibringt. Weil Nanny vergessen hat, das Fenster wieder zuzumachen, weht jetzt der Wind die Gardinen vor und zurück, vor und zurück. Der Mond scheint durch die Zweige bis auf Hildegards Bett. Die Zweige sind lange Arme mit Greifhänden, so wie die der Bolschewisten. Voller Furcht steckt Hildegard den Kopf unter die Decke und zieht die Knie an, bis sie unter ihrem Kinn drücken. Aber die Angst ist schon immer mit ihr zusammen ins Bett gekrochen. Wenn sie sehr schnell aus dem Bett steigt und ihre Zimmertür fest zumacht, können ihr die Greifhände der Zweige nicht folgen. Dann muss sie sehr leise die Treppe hinuntergehen, damit ihr Vater nicht wach wird. Auf diese Weise kann sie zu Nanny ins Bett schlüpfen, bevor die Zweige überhaupt merken, dass sie weg ist. Sie zögert einen Augenblick. „Du darfst nicht wieder hierherkommen, Hildegard“, hat Nanny ihr beim letzten Mal gesagt. „Herr von Plötzke wird das sicher nicht dulden. Bete, dann wird dir der Herr Jesus selbst die Hand halten.“ Doch das Handhalten wird heute Nacht nichts helfen. Nur die weichen Arme von Nanny können sie vor den bolschewistischen Greifzweigen beschützen. „Ach, Hildegard“, seufzt Nanny, aber sie streckt ihr dennoch die Arme entgegen. „Hat mein Töchterlein einen bösen Traum gehabt?“ „Nein, die Zweige wollten mich festhalten, weil das Fenster offen war.“ Nanny hält sie fest. Das ist der schönste Ort auf der ganzen Welt, das Bett von Nanny. Nanny drückt sie fest an sich und streichelt ihr über das Haar. Nannys müssen so etwas wie einen Kissenkörper haben, den sie um Töchterlein legen können. „Ist die Angst jetzt weg?“, fragt Nanny nach einer Weile. „Ja, Nanny.“ Sie wäre gern noch ein bisschen geblieben. Aber sie weiß, dass das eigentlich nicht statthaft ist. Nanny bringt sie in ihr Bett zurück, hüllt sie stramm in ihre Decke und macht das Fenster ordentlich zu. „Schlaf jetzt schön, Hildegard“, sagt sie. Nanny ist der liebste Mensch auf der ganzen, weiten Welt. Jeder im Haus hat seine eigene Aufgabe. Hildegards Aufgabe ist es, ihr Essen zu essen, ihre Lektionen zu lernen, ihre Musik zu üben und friedlich zu schlafen. Das friedliche Schlafen ist allerdings ihre allerschwierigste Aufgabe. Nanny hat die schönste Aufgabe. Sie muss Hildegard Geschichten erzählen und mit ihr spielen. Frau Nowak ist die Waschfrau, sie ist die freundlichste von allen und sehr dick. Wenn sie die Bügeleisen auf dem Ofen heiß macht, wird ihr dabei warm. Im Sommer krempelt sie sich die Ärmel ganz weit hoch und wäscht die Laken und Tischdecken, dass die Schaumwolken nur so über den Waschzuber rollen. Sie macht Hildegard einen Bart aus Schaum, sodass sie aussieht wie der Nikolaus, und dann lacht sie aus vollstem Herzen mit ihr. Eigentlich hat sie keine Zähne mehr und sie ist schon ziemlich alt, denn sie war schon die Waschfrau von Oma, die schon lange tot ist, und hat sich um Mama gekümmert, als die noch ein kleines Mädchen war. Frau Nowak kann Hildegard viele Geschichten über die Zeit erzählen, als Oma und Opa noch gelebt haben und Mamas Brüder und Mama noch klein waren. Sie spricht Polnisch, genauso wie die Putzfrau, und weil Hildegard so gern Geschichten hört, lernt sie schnell, Polnisch zu verstehen. Hildegards Vater ist Pelzhändler – er fertigt und verkauft Pelzjacken und -mäntel, Pelzmützen, Umhänge, Handschuhe, alles, was man aus Pelz machen kann. Er macht das alles nicht selbst, sondern ist der Chef einer Fabrik, in der solche Dinge hergestellt werden, und von mehreren Geschäften, in denen sie verkauft werden. Er geht regelmäßig mit einer Reihe von Herren auf die Jagd, aber sie jagen nur Hirsche mit großen Geweihen und Vögel mit hellen Federn. Andere Leute jagen wegen der Pelze in weit entfernten und einsamen Orten, das sind Leute mit dicken Mützen und langen Bärten. Papa kauft ihnen dann die Felle ab. „Das war eigentlich das Geschäft von deinem Großvater, er hat damit angefangen“, erklärt Frau Nowak, während sie die Laken bügelt und dabei die Hängesäckchen unter ihren Oberarmen hin und her schwanken. „Der Vater von deiner Mutter, Herr Schneider ...“ „Aber der ist jetzt tot.“ „Ja, den hast du nie kennengelernt. Das war ein guter Mann, aber mit einer strengen Frau. Der älteste Bruder von deiner Mutter ist jetzt der große Herr im Geschäft.“ „Und wo wohnt der?“ „In Paris, glaube ich, und der jüngste, Konrad, hat das Geschäft in Spanien übernommen, aber wo der andere ist, weiß ich nicht.“ „Und Papa ist jetzt hier, in Königsberg?“ Frau Nowak tauscht zuerst die Bügeleisen aus. Sie stellt das schwere Eisen auf den Ofen, wickelt sich den dicken Lappen wieder fest um die Hand und nimmt das andere Eisen. Sie spuckt auf die untere Fläche, um zu sehen, ob sie schon heiß genug ist. Spucken ist ein Zeichen von schlechten Manieren, aber das sagt Hildegard Frau Nowak nicht. Wenn es zischt, ist das Eisen heiß genug. Für die Laken muss das Bügeleisen sehr heiß sein. „Deine Mutter ist das jüngste Kind und die einzige Tochter. Nachdem sie deinen Vater geheiratet hat, haben die beiden zunächst bei deinen Großeltern hier in Königsberg gewohnt und dein Vater hat gelernt, wie der Pelzhandel funktioniert. Dann hat ihn dein Großvater nach Sankt Petersburg geschickt, um auch dort ein Geschäft zu eröffnen. Das war, kurz bevor du geboren wurdest.“ „Mama wollte schon lange nach Königsberg zurückkommen, lange bevor die Bolschewisten so wütend auf die Adligen geworden sind“, erzählt Hildegard. „Och, dein Vater wollte sicher seine neuen Fabriken und Läden nicht im Stich lassen.“ Jetzt müssen erst wieder die Bügeleisen ausgetauscht werden – sie werden immer so schnell wieder kalt. „Dein Vater ist ein guter Mann. Es ist nur schade, dass ...“ „Was ist schade, Frau Nowak?“ „Ach, lass gut sein.“ „Frau Nowak, wie sieht so ein Bolschewist eigentlich aus?“ „Na, woher soll ich das denn wissen? Fellmütze, sicher, ein schwarzer Bart? Nein, frag doch lieber deinen Vater.“ Ihr Vater runzelt jedoch nur die Stirn. „Wie kommst du denn nur auf so eine Frage?“ „Macht es dir Spaß, ein Pelzhändler zu sein, Papa?“, fragt sie. Er zuckt mit den Schultern. „Es ist ein gutes Leben, Hildegard. Ich will nie wieder arm sein.“ In der Stunde vor dem Abendessen darf Hildegard ihre Mutter besuchen. Sie und Nanny essen zunächst allein zu Abend, dann badet Nanny sie und zieht ihr das Nachthemd und Pantoffeln an, bevor sie leise an Mamas Tür klopfen darf. Ihre Mutter ist in ihrem Boudoir. In die hölzernen Möbel sind kleine, vergoldete Bilder geschnitzt und die Kissen sind glatt gestrichen und glänzen. Für Hildegard ist dies das schönste Zimmer im ganzen Haus. Wenn ihre Mutter abends ausgeht oder Papa und Mama eine Soiree im Haus haben, ist das Zimmermädchen damit beschäftigt, ihrer Mutter beim Anziehen zu helfen und ihre langen Haare zu frisieren. Dann darf Hildegard die Juwelen ihrer Mutter anfassen, die in dem Tresor mit der schweren Tür liegen. Langsam lässt sie die lange Perlenkette über die Finger gleiten. „Vorsicht, lass sie nicht fallen. Und sorge dafür, dass alles wieder in sein eigens dafür vorgesehenes Samtsäckchen zurückkommt.“ Die Perlen kommen auch aus Japan, genauso wie Koong-se und Chang, die jetzt Tauben sind. Taucher haben sie tief aus dem Meer herausgeholt, hat ihre Mutter ihr einmal erzählt. Manchmal bekommt Hildegard von ihrer Mutter eine Geschichte vorgelesen. Sie sitzt dann neben Mama auf einem besonderen Sofa mit goldenen Füßen. Das Sofa ist nicht groß und ihre Mutter nimmt sehr viel Platz ein, deshalb muss sich Hildegard eng an sie pressen, um auch noch aufs Sofa zu passen. „Mama, hast du auch Angst gehabt, wenn es dunkel war und du allein warst?“, fragt sie plötzlich. Ihre Mutter wirkt verstört. „Sei nicht albern, Hildegard. Es gibt nichts, wovor du Angst haben müsstest.“ Sie will ihr lieber nicht erzählen, dass sie in manchen Nächten leise aufsteht und durch das dunkle Haus in Nannys Zimmer geht. Mittlerweile kennt sie das Haus schon so gut, dass sie allein die Treppe hinuntergehen kann, dann durch den langen Speisesaal und die gruselige Küche bis zur richtigen Tür. Sie braucht nicht anzuklopfen, sondern macht sie einfach auf und steigt zu Nanny in ihr großes, warmes Bett. Manchmal wird Nanny noch nicht einmal wach, sie schnarcht ein wenig, wenn sie schläft. Früh am Morgen, wenn es noch ziemlich dunkel ist, schleicht sich Hildegard dann wieder in ihr eigenes Bett zurück, damit niemand merkt, dass sie dort nicht geschlafen hat. Eines Abends erzählt ihre Mutter: „Dieses Haus und der Hof hier haben der Familie meiner Mutter gehört, sie haben Landwirtschaft betrieben. Aber mein Vater ist kein Landwirt gewesen. Er hat einen großen Teil der Ländereien verkauft und mit dem Geld Geschäfte und Fabriken finanziert. Dann hat er sich als Pelzhändler einen Namen gemacht und hat sehr viel Geld verdient, weil er sehr erfolgreich war.“ Ihre Mutter klingt stolz. „Alle meine Brüder sind auch Pelzhändler und mittlerweile hat sich das Geschäft meines Vaters über die ganze Welt ausgedehnt.“ „Papas Vater und Großvater waren Ritter mit eiserner Rüstung“, sagt Hildegard. „Vor ein paar hundert Jahren mögen die Vorfahren deines Vaters zwar Ritter gewesen sein, aber als dein Vater noch ein Kind war, hatten seine Eltern nur einen kleinen Bauernhof und kein Geld. Wenn er mich nicht geheiratet hätte, wäre er immer noch arm wie eine Kirchenmaus.“ Als Nanny kurz darauf leise an die Tür klopft, um sie abzuholen und ins Bett zu bringen, ist Hildegard froh drüber. Im Lauf der Jahre werden ihre Schularbeiten allmählich schwieriger. Hildegard muss alles über Martin Luther lernen, über den Dreißigjährigen Krieg und den Siebenjährigen Krieg („Noch ein Krieg, kannst du dir das vorstellen, Nanny?“) und alles von Bis-marck bis Kaiser Wilhelm II. Manchmal spricht ihr Vater von Kaiser Wilhelm II., denn er bewundert den Kaiser sehr. „Der Kaiser hat gesagt“, beginnt ihr Vater seine Sätze dann immer. Und niemand darf ihm dann widersprechen, denn der Kaiser ist rechtschaffen, untadelig, strikt, sein Wort ist Gesetz. Manchmal beobachtet Hildegard immer noch sehnsüchtig durch das Fenster die Arbeiterkinder, die draußen Ball spielen, aber sie versteht es jetzt: Sie ist eine Adlige, eine Dame, eine, die bald elf Jahre alt wird. Wenn sie eines Tages dreizehn wird, darf sie ihre Haare zu einem Knoten zusammenstecken und gelegentlich im Speisezimmer unter den Erwachsenen essen, vielleicht sogar mit ihnen ins Theater gehen. Doch im Augenblick ist sie noch zehn, und wenn die Dunkelheit zu duster wird, wartet immer noch Nannys warmes Bett auf sie. Draußen ist es noch finster und sie weiß nicht, wie spät es ist. Neben sich fühlt sie Nannys weichen, warmen Körper. Sie muss eingeschlafen sein. Das war ein Fehler, denn in Nannys Bett sollte sie nicht einschlafen. Sie kuschelt sich noch eine oder zwei Minuten fest an Nannys Rücken. Nanny atmet ein und aus und macht dabei immer ein leises Schnarchgeräusch, das sich anhört, als würden kleine Ferkelchen zufrieden an ihrer großen Schweinemutter herumnuckeln. Schließlich steht Hildegard auf und geht auf Zehenspitzen zur Tür. Der Boden knarrt, aber das macht gar nichts, denn Nanny hört nicht mehr so gut. Leise zieht sie die Tür von Nannys Zimmer hinter sich zu und schleicht durch die Küche und das Esszimmer zur Treppe im Eingangsportal. Plötzlich öffnet sich die Haustür. Hildegard zuckt zusammen und bleibt wie angewurzelt stehen. Ihr Vater kommt herein. Er schaltet das Licht an und der Eingangsbereich ist mit einem Mal blendend weiß. Er hängt seine Jacke und seinen Hut an die Garderobe. Noch immer steht Hildegard wie versteinert da, das Herz schlägt ihr bis zum Hals. Dann dreht sich ihr Vater um und sieht aus, als wäre auch er erschrocken. „Hildegard?“ „Ich … gehe jetzt in mein Zimmer.“ Ihre Stimme hört sich seltsam an, sie blinzelt mit den Augen wegen des grellen Lichtes. „Wo bist du gewesen?“ „In Nannys Zimmer. Ich … ich hatte Halsschmerzen.“ Das ganze Gesicht ihres Vaters sieht streng aus und seine Augen wirken kalt. „Geh jetzt auf dein Zimmer.“ Sie rennt die Treppe hinauf und den Gang hinunter bis zu ihrem Zimmer. Dort zieht sie sich die Federdecke über den Kopf, rollt sich zu einem kleinen Bündel zusammen und kneift die Augen zu. Wild pumpt ihr Herz das Blut durch ihren ganzen Körper. Sie betet, aber nirgendwo fühlt sie die Hand des Herrn Jesus. Denk an eine Geschichte oder sing in deinem Kopf ein paar Lieder, sagt sie zu sich selbst. Doch das Gesicht und die Stimme ihres Vaters wollen nicht verschwinden. Ihr Vater wird mit Nanny reden, sie weiß, dass er es tun wird. Und Nanny weiß nichts davon, dass sie furchtbare Halsschmerzen gehabt hat, Nanny weiß noch nicht einmal, dass sie bei ihr unter die Decke gekrochen ist. Nanny hat einfach weitergeschlafen, als Hildegard sich an ihren Rücken gekuschelt und ihre Arme um Nannys weichen Körper geschlungen hat. Später wird ihr Vater sie in sein Studierzimmer zitieren. Er wird böse sein, nicht nur, weil sie in Nannys Zimmer geschlichen ist, sondern auch, weil sie ihn deswegen angelogen hat. Sie wird sagen, dass sie tatsächlich Halsschmerzen gehabt hat, aber weil Nanny geschlafen hat, hat sie es ihr nicht sagen können. Niemand wird wissen können, ob sie damit lügt oder nicht. Doch wenn ein Mensch lügt, dann weiß das der Herr. Plötzlich fragt sie sich, wo ihr Vater wohl gewesen ist, dass er so früh am Morgen mit seinem vornehmen Abendanzug in der Tür steht. Pünktlich um acht Uhr kommt Frau Faber, so wie jeden Morgen. Sie lesen und schreiben. Vor lauter Angst hat Hildegard Bauchschmerzen. Wann wird ihr Vater sie in sein Studierzimmer rufen lassen? Sie rechnen. Wird Papa ihr die Geschichte mit den Halsschmerzen glauben? Muss sie so eine Lüge erzählen? „Hildegard, passt du auf?“ „Ja, Frau Faber.“ Um halb elf klopft eines der Küchenmädchen an die Tür und bringt ihnen belegte Brote, Milch für Hildegard und Tee für Frau Faber. Davon, dass Hildegard ins Studierzimmer kommen soll, sagt sie nichts. Die beiden fangen wieder an zu arbeiten – Frau Faber erzählt ihr, dass die Erde rund ist, so wie eine große Pampelmuse, während die Sonne so etwas wie ein stillstehender Kürbis ist –, dann hört Hildegard, dass ihr Pferdewagen vor der Eingangstür anhält. Sie hofft, dass es ihr Vater ist, der irgendwo hinmuss. Vielleicht ist er dann nicht mehr so böse wegen heute Morgen. Zwei Küchenmädchen kommen aus dem Haus, sie tragen Säcke, eine Reisetasche und eine Hutschachtel. Hildegard runzelt die Stirn. Wer wird denn …? „Hildegard!“ „Ich höre Ihnen zu, Frau Faber.“ „So, dann schau dir einmal die Erde an. Ich frage dich: Wo, denkst du, scheint die Sonne am heißesten? Am Äquator oder hier oben am Nordpol?“ Aus den Augenwinkeln sieht Hildegard, wie jemand aus der Eingangstür kommt und mit Hilfe einer kleinen Trittleiter auf den Pferdewagen klettert. Sie denkt nicht nach, sondern springt auf und rennt ans Fenster. Das ist Nanny. Sie fliegt geradezu los und rennt die Treppe hinunter, dabei nimmt sie zwei Stufen mit einem Schritt. „Hildegard!“, hört sie die Stimme von Frau Faber hinter sich. Doch jetzt gibt es nichts Wichtigeres. „Nanny! Nanny!“ An der Eingangstür ergreift ihr Vater sie beim Arm und hält sie fest. „Hildegard!“ Sie schüttelt sich und ruckt hin und her. „Lass mich los!“ Ihre Beine treten wild um sich, ihr freier Arm schlägt auf ihren Vater ein. „Aua! Lass mich los! Du tust mir weh! Lass mich los!“ Doch die Finger ihres Vaters halten sie wie Stahlklammern fest. Mit seiner anderen Hand schließt er die Eingangstür. „Benimm dich, Hildegard.“ „Ich möchte Nanny wiederhaben!“ „Geh zurück in dein Schulzimmer und mach deine Arbeit.“ „Das werde ich nicht tun!“ Sie kann ihre Stimme nicht unter Kontrolle bringen, auch nicht die Tränen, die ihr wie Rinnsale über die Wangen laufen. „Das werde ich nicht tun, das werde ich nicht! Nie wieder werde ich in dieses Schulzimmer gehen, bis Nanny zurückgekommen ist.“ Das Gesicht ihres Vaters ist bleich, seine Augen sind eisblau. „Miss Jones wird nicht mehr zurückkommen. Ab morgen bekommst du ein Zimmermädchen, das dir zur Verfügung steht.“ Hildegard spürt, wie ihre Tränen festfrieren und ihr Herz kalt wird. Sie fühlt, wie ihr Gesicht ebenfalls kalt wird und ihre Augen eisblau. „Wenn Nanny nicht mehr zurückkommt, dann werde ich dich für immer und ewig hassen“, erwidert sie bedächtig. Ihr Vater presst die Lippen zusammen. „Keine Dame benimmt sich so gegenüber einem Herrn, Hildegard. Hör auf mit deiner kindischen Ungehobeltheit und geh auf dein Zimmer.“ Nun ist ihre Welt finster geworden – und kalt. Sie kann ihre Aufgaben nicht lesen, weil ihre Kehle voller Schmerz ist. Beim Rechnen verschwimmen die Aufgaben vor ihren Augen, ständig wirft sie einen kurzen Blick auf das große Tor am Ende der Einfahrt. „Nein, um Himmels willen, Hildegard, konzentriere dich endlich!“, schimpft Frau Faber. In der Musikstunde hat Meister Schroeder noch weniger Geduld, ärgerlich schlägt er ihr mit dem Zeigestock auf die Finger. „Bekommst du eigentlich mit, wie du dich anhörst? Wie ein Elefant, der mit seinen Dreckfüßen über die Noten trampelt! Fühle die Musik, mein Kind. Sie ist leicht, so wie fallende Blätter oder Schneeflocken.“ Die Tränen stauen sich hinter ihren Augen, das Notenblatt verschwimmt, die schwarzen und weißen Tasten fließen ineinander. „Geh, putz dir die Nase und wasch dir die Hände“, fordert Meister Schroeder sie auf. Das Essen bleibt ihr in der Kehle stecken. Als sie es endlich hi- nuntergeschluckt hat – denn Madame Dubois ist sehr streng –, fühlt es sich an, als hätte ihr jemand das Essen nach unten in den Magen gedrückt. „Nanny hätte mir niemals so viel aufgetan“, wagt sie eines Mittags einen Versuch. „Nanny ist weg, iss deinen Teller leer“, erwidert Madame Dubois. „Da“, und sie gibt Hildegard trotzdem ein Plätzchen. Aber Plätzchen helfen nicht. Und der kleine Teddy ist auch nicht so warm wie der von Nanny. Nur Frau Nowak hört ihr wirklich zu. Sie schöpft mit der Hand etwas Seifenschaum. „Du liebe Güte, du armes, kleines Ding. Komm her, dann mache ich dir einen Nikolausbart.“ Als ob das helfen würde. Die Nächte sind am schlimmsten. Hildegard möchte nicht ins Bett gehen, denn zwischen den Laken wartet schon die Angst auf sie. Schlafen will sie nicht, denn dann kommen vielleicht die Träume. Und es gibt niemanden, dem sie sie erzählen kann, niemanden, der sie festhält. Der Bauch tut ihr weh und auch ihr Herz schmerzt, sehr sogar. Selbst tagsüber denkt sie nur an Nanny. Es gibt so viel, was sie noch mit Nanny besprechen wollte, was sie nur Nanny fragen kann, zum Beispiel warum die Dienstmädchen mit den Augen rollen und sich plötzlich in Schweigen hüllen, sobald sie ein Zimmer betritt. Sie ist Nannys Töchterlein, Nanny hat keine anderen Kinder. Das hat sie selbst zu Hildegard gesagt. „Ich habe dich deshalb so lieb, weil du mein Töchterlein bist“, hat Nanny immer gesagt. Sie möchte Nanny nach der Hand des Herrn fragen und nach dem Tod, möchte von ihr etwas über das Knoblauchsäckchen wissen, das Frau Nowak um den Hals trägt, und warum ihre Oberarme immer so schwabbeln, wenn sie sich bewegt. Sie möchte wissen, ob die Geschichte von Bileam und seinem Esel wirklich wahr ist und wie weit der Mond von der Erde entfernt ist. „Wo wohnt Nanny denn jetzt?“, fragt sie nach einer Woche. „Sie ist zurück nach England gezogen. Dort wird sie bei einer anderen Familie wohnen und auf deren Kinder aufpassen“, antwortet Frau Nowak und wischt sich mit einem großen, ausgebleichten Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Da ist Hildegard mit einem Mal nicht mehr traurig, sondern wütend. Wütend auf ihren Vater. Das ist alles seine Schuld, alles. Er denkt vielleicht, er sei groß und schlau, aber sie weiß, dass er eine dumme Entscheidung getroffen hat. So etwas würde sie ihren Kindern niemals antun. Können Erwachsene dumme Entscheidungen treffen? Ja, das können sie, entscheidet Hildegard. Denn sie wissen auch nicht immer alles. Vielleicht sollte sie von jetzt an ihre eigenen Entscheidungen treffen. Vielleicht weiß sie besser, was gut für sie ist. Aber ob ihr Vater das zulassen würde, das weiß sie nicht. Er ist furchtbar streng. Auf Nanny ist sie auch stinksauer. Denn wenn Nanny sie wirklich lieb gehabt hätte, so wie ihr eigenes Töchterlein, dann hätte sie sie niemals, niemals im Stich gelassen und sie wäre auch nicht nach England zurückgegangen, um dort auf andere Kinder aufzupassen. Sie ist wütend auf sie. Wütend, wütend. Und trotzdem … Ihr fällt noch so viel ein, was sie Nanny gern gefragt hätte.
Prolog
"Hildegard?"
Instinktiv schaut sie auf, blickt dann aber sofort wieder zu Boden.
"Hildegard von Plötzke?" Sie hört das Erstaunen in seiner Stimme. "Wahrhaftig, Hildegard von Plötzke aus Königsberg! Wie ... wie um alles in der Welt bist du denn hier gelandet?"
Ja, wie um alles in der Welt ist sie hier gelandet?
Und dazu noch auf diese Weise!
1. Kapitel
Das Früheste, an das sie sich erinnern kann, ist ein gelber Lichtschein, der durch die Fenster fällt, und an Nanny, die sich über sie beugt, während sie in ihrem Kinderbettchen liegt. Aber das sind ganz vage Erinnerungen, so verblasst wie die Fotos im Album ihrer Mutter, das sie immer noch besitzt.
Sie meint, sich auch noch daran erinnern zu können, wie Papa am oberen Ende eines sehr langen Tisches sitzt. Doch dieses Bild ist ganz und gar verschwommen. Vielleicht erinnert sie sich auch nur an ein Foto, das sie einmal gesehen hat und nun nicht mehr aus ihrem Kopf bekommt.
Die Erinnerung an die rote Nacht, in der Nanny sie aus ihrem großen Bett gerissen hat, ist deutlicher. In dieser Nacht mussten sie aus Russland fliehen.
Irgendwo schreien Menschen.
Es ist dunkel und sie ist noch ganz verschlafen, ihre Augenlider sind so schwer, dass sie sie kaum öffnen kann.
Da schreien tatsächlich Menschen. Irgendwo weit weg.
Sie hört, wie die Tür geöffnet wird, bevor sie es sieht. Nanny stürmt herein. "Komm, Hildegard!"
Bevor sie sich aufrecht hinsetzen kann, ist Nanny schon bei ihr, hüllt sie in ihre Decke und reißt sie aus dem Bett. Sie weiß nicht, was mit ihr geschieht. "Nanny?"
Nanny sagt kein Wort. Sie rennt mit kleinen, schnellen Schritten aus dem Zimmer.
Nirgendwo brennt Licht. Doch von draußen fällt ein roter Lichtschein herein. "Warum ist alles so rot?", will sie wissen.
Auf der Treppe holt Papa sie ein. Er reißt sie Nanny aus dem Arm. "Holen Sie für das Kind Schuhe und eine Jacke und dann kommen Sie in mein Studierzimmer!"
"Yes, Herr von Plötzke."
Papa rennt mit ihr die Treppe hinunter, wobei er immer zwei Stufen auf einmal nimmt.
"Still, sei ruhig!"
Seine rauen Bartstoppeln kitzeln sie an der Wange, der leichte Brandgeruch seines Schnauzers kribbelt ihr in der Nase. Sie hat Angst und drückt ihren Körper fester an die breite Brust ihres Vaters.
Dieser rennt durch das Esszimmer hindurch ins Studierzimmer. "Charlotte, ich hole Geld", sagt er schnell und geht zum Schrank.
"Mach erst die Tür auf", hört sie die Stimme ihrer Mutter sagen. Die Stimme hört sich seltsam an, irgendwie verkniffen.
Dann zaubert ihr Vater. Er zaubert wirklich, denn das ist kein magischer Trick: Er steht vor dem Schrank und sagt leise etwas - sie meint, vielleicht hat er wirklich so etwas wie "Abrakadabra" gesagt - dann gleitet der gesamte Bücherschrank nach hinten weg.
"Papa?"
Er zündet eine Lampe an und reicht sie ihrer Mutter. "Schnell, ich will nicht, dass irgendjemand das Licht sieht."
"Papa?"
Diesmal antwortet ihre Mutter: "Hildegard, sei still."
Daraufhin stellt sie keine weiteren Fragen mehr.
Nanny nimmt sie an der Hand. "Pass auf, da sind Stufen runter." Nanny spricht ein komisches Deutsch.
Der Boden unter Hildegards nackten Füßen wird auf einmal eiskalt, das Licht wird schwach, es ist nur noch ein gelber Schein in der schwarzen Finsternis. Vorsichtig steigt sie die Treppe hinunter. Ihre Mutter geht mit der Lampe voraus. Es sind schmale Treppenstufen, die ungewöhnlich hoch sind. "Ich kann nichts sehen", sagt sie zu Nanny.
"Mach schnell, Hildegard." Die Stimme ihrer Mutter klingt streng.
Am unteren Ende der Treppe, tief im Bauch der Erde, tut sich vor ihr ein Gang auf. Verwundert bleibt Hildegard stehen. Dass es unter ihrem Haus einen geheimen Gang gibt, das hat sie nicht gewusst. Die bittere Kälte kriecht ihr nun langsam die Beine hinauf. Hinter ihr schiebt ihr Vater von innen die Tür zu und eilt hastig die Treppe hinunter. Er nimmt sie auf den Arm, jetzt sind ihre Füße nicht mehr kalt. So schnell sie können, schieben sie si
| Erscheinungsdatum | 25.05.2016 |
|---|---|
| Übersetzer | Thomas Weißenborn |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Immer wes |
| Maße | 135 x 215 mm |
| Gewicht | 679 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Literatur ► Historische Romane |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | 1. Weltkrieg / Erster Weltkrieg; Romane/Erzählungen • 1. Weltkrieg; Romane/Erzählungen • 2. Weltkrieg; Romane/Erzählungen • 2. Weltkrieg / Zweiter Weltkrieg; Romane/Erzählungen • Adel • Afrika • Belletristik: religiös, spirituell • Berlin • Deutsch-Südwestafrika • Familienleben • Familienroman • Familiensaga • Generationenromane, Familiensagas • Historischer Roman • Königsberg • Liebe • Nachkriegsdeutschland • Trümmerfrauen • Weltkrieg • Westeuropa |
| ISBN-10 | 3-86827-591-6 / 3868275916 |
| ISBN-13 | 978-3-86827-591-9 / 9783868275919 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich