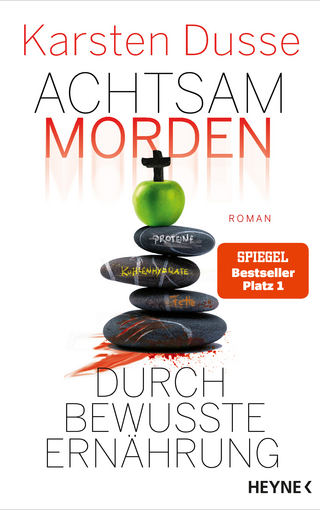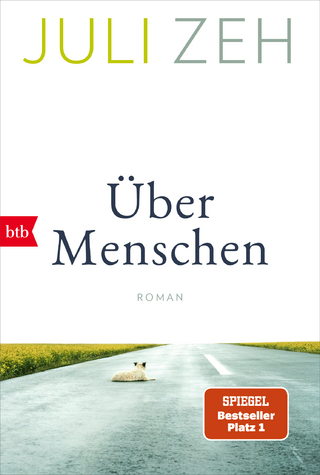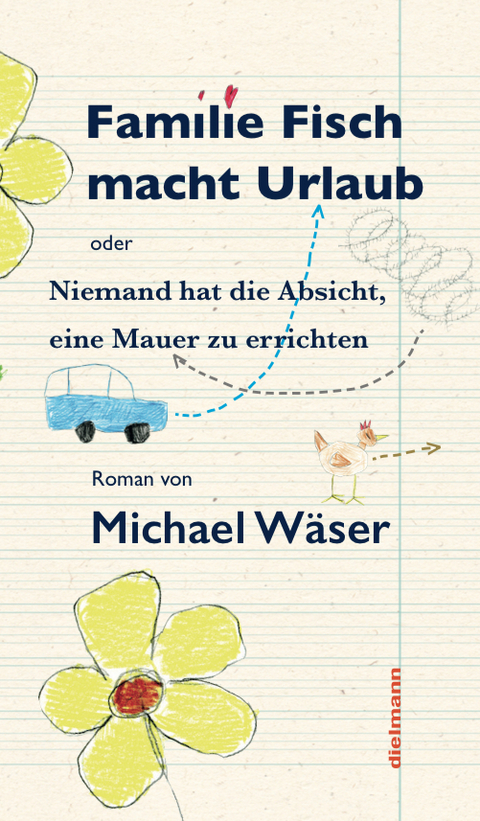
Familie Fisch macht Urlaub
Dielmann, Axel (Verlag)
978-3-86638-291-6 (ISBN)
Michael Wäser wurde 1964 im Saarland geboren, war als Schauspieler an verschiedenen deutschen Staatstheatern tätig. Er ist Mit-Organisator der Pankower Lesebühne So noch nie, Berlin, wo er auch lebt. Neben den bei mir veröffentlichten Romanen ist »Warum der stille Salvatore eine Rede hielt« eine ganz großartige Lektüre, einer der bewegendsten Romane, die ich gelesen habe! Mehr über den Autor Michael Wäser auf seinem Blog www.konsonaut.wordpress.com und bei literaturport.de sowie unter unseren Veranstaltungshinweisen.
Kommt ein Wölkchen angeflogen Irgendwann würde Hempel fliegen, das wusste Carla ganz genau. Hempel war das allerschönste und liebste Huhn von allen Hühnern der Familie Fisch, fand jedenfalls das Mädchen, und deshalb hatte Carla ihm auch einen Namen gegeben. Sie wusste nicht, ob Hempel ein Hahn oder eine Henne war. „Das kann man bei Hühnern erst später erkennen“, sagte Carlas Mutter immer. „Aber fliegen können diese Hühner nicht.“ Wenn man erst viele Wochen nach dem Schlüpfen sehen konnte, ob Hempel eine Henne oder ein Hahn war, warum sollte das Tier nach ein paar Wochen nicht auch fliegen können? Es war ein ganz besonderes junges Huhn. Hempel kam Carla immer entgegengerannt, wenn die Achtjährige über den alten Schulhof lief, der zur Betriebsberufsschule des „VEB Hochbau Erfurt“ gehörte. Dann hob Carla Hempel vom Boden hoch und herzte sie – oder ihn. Das braun-weiße, halbwüchsige Huhn fühlte sich weich an wie Seide und pickte zärtlich gegen Carlas Nase. Jeden Abend wünschte Carla Hempel eine gute Nacht, bevor sie selbst ins Bett musste. Carlas Eltern wussten nicht, dass ihre zweitjüngste Tochter ein Lieblingshuhn hatte, auch nicht, dass es Hempel hieß. Das war Carlas Geheimnis. Für Carlas Vater, Rainer Fisch, Hausmeister der Schule, waren die Hühner einfach gut, um die Familie mit frischen Eiern zu versorgen, ab und zu auch mal mit einer schönen Hühnersuppe oder einem Brathähnchen. Bei sieben und nun bald acht Kindern, die satt werden wollten, durfte man natürlich nicht so häufig Hühner schlachten, sonst wären bald keine mehr übrig gewesen, die Eier legen konnten. Rainer dachte da ganz praktisch. Er war Stadtkind, in Erfurt groß geworden, von seiner Mutter gleichzeitig verwöhnt und beherrscht und gegenüber den Geschwistern bevorzugt. Seinen Vater hatte er nie kennengelernt, seine Mutter Lisa weigerte sich noch heute, die Identität seines Vaters preiszugeben, und falls seine Geschwister, allesamt älter als er, sie kannten, hatten sie bisher absolut dichtgehalten. Warum er nicht als Geschichtslehrer arbeitete, wie er es eigentlich wollte, verstand Carla nicht. Schließlich hatte er vom Krieg eine kaputte Hand und konnte manche Hausmeisterarbeiten nur mit Mühe erledigen. Er ärgerte sich darüber aber seltener, als es Carlas Mama tat. Sie ärgerte sich ziemlich häufig und schimpfte auf irgendwen, auf „die da“. Besonders, wenn sie sich unbeobachtet fühlte, schimpfte sie ganz allein vor sich hin. Carlas Mama Erika mochte die Gegenwart der Hühner, weil diese gleichermaßen gewöhnlichen wie urtümlichen Vögel sie an ihre Kindheit erinnerten. Sie war auf einem kleinen Bauernhof in der Nähe von Stralsund aufgewachsen, mit vielen Geschwistern und einem ewig besoffenen Stiefvater. Ihre Mutter Anna hatte in dem rückständigen Dorf als Hexe gegolten, weil sie mit ihren Tieren sprach wie mit Menschen. Vor allem, wenn ein Tier krank war, zog sich Anna mit ihm in den Stall zurück und redete mit ihrem Patienten. Meistens ging es dem Tier bald wieder besser. Vielleicht hatte sich diese Vorliebe oder Fähigkeit von der Großmutter auf Carla vererbt. Manchmal schien es Erika, als habe die kleine Carla zwischen ihren zarten, hellblonden Locken hochempfindliche Antennen für die Dinge, die in der Luft lagen. Was Erika wohl zu den intimen Gesprächen zwischen ihrer Tochter und Hempel gesagt hätte? Ihre Kinder waren ihr ohnehin manchmal unheimlich, und so war es wohl besser, dass sie nichts davon wusste. Carla verfügte tatsächlich über eine Art Antennen, natürlich nicht auf ihrem Kopf, sondern in ihrem sensiblen Wesen, ihrer ausgeprägten Fantasie, die immer irgendwie in Verbindung mit dem stand, was sie umgab. Carlas besonderes Gespür für die Dinge hatte das Mädchen auch veranlasst, seine besondere Freundschaft mit Hempel nicht an die große Glocke zu hängen. Ihre Geschwister hätten sie bloß gehänselt, vor allem Siegfried und Norbert. Die beiden interessierten sich überhaupt nicht für die Hühner, Norbert jagte sie sogar manchmal mit seinem klapprigen Holzroller wie ein Verrückter über den Schulhof, und Siegfried pfiff dazu auf den Fingern. Wenn Carla das sah, wurde sie immer fuchsteufelswild. Zum Glück wollten ihre Eltern auch nicht, dass die Hühner gejagt wurden. Indem sie drohte, sie zu verpetzen, konnte Carla sogar ihren frechen jüngeren Brüdern Einhalt gebieten. Sonst machte sie so etwas nicht. Petzen hasste Carla. Aber für Hempel, für ihr geliebtes kleines Huhn würde sie alles tun. An diesem Abend aber würde sie Hempel später als gewöhnlich gute Nacht sagen. Dieser Abend vor dem letzten Schultag war nicht wie sonst. Heute würde etwas Besonderes geschehen. So besonders, dass Carla sich nach dem Abendessen freiwillig zu ihren Brüdern „Sigi“ und „Bemme“ auf das alte Sofa im Wohnzimmer setzte, oben in der Dachwohnung der Hausmeisterfamilie Fisch: Heute Abend, so hatte ihr Papa angekündigt, habe er eine riesengroße Überraschung für seine Familie. Er meinte damit das nagelneue Fernsehgerät, das er zusammen mit seinem Jugendfreund Otto im Wohnzimmer aufbaute. Carla hatte allerdings das Gefühl, dass der Fernseher an diesem Abend des 6. Juli 1961 nicht die größte Überraschung sein würde. Otto Schimmelpfennig und Rainer Fisch waren Freunde, seit sie sich erinnern konnten. Sie hatten in der Volksschule dieselbe Klasse besucht, hatten die Streitereien der Roten und der Nazis in Erfurt vom Fenster aus beobachtet wie ein Fußballspiel, hatten sich gemeinsam vor der HJ gedrückt, hatten ihre Lehre in den ersten Kriegsjahren absolviert – Rainer als Schlosser, Otto als Klempner. Gegen Ende des Krieges waren sie gerade alt genug gewesen, dass man sie noch in die Wehrmacht einzog. Otto hatte dabei mehr Glück und konnte wegen seiner totalen Unfähigkeit, eine Waffe zu benutzen, die Monate in Deutschland im Innendienst abreißen. Rainer schickte man nach Frankreich und Russland, wo es ihn im letzten Kriegsjahr bei einem Granatenangriff so schlimm erwischte, dass man ihn für tot hielt. Nur durch Zufall bemerkte jemand, dass sich einer der schlimm zugerichteten Körper auf der blutigen Ladefläche des Pferdewagens bewegte. Zahlreiche Splitter hatten Rainers Gesicht verletzt, seine Jacke durchsiebt und drei Finger seiner rechten Hand abgerissen – danach sah er einfach genau so tot aus wie die anderen zerfetzten Soldaten. Die anschließenden Operationen retteten zwar Rainers Leben, aber sein Gesicht und seine Hand blieben entstellt, sein Körper von Narben und eingeschlossenen Splittern übersät. Otto war danach der Einzige gewesen, vor dem sich Rainer nicht schämte, und mit ihm zusammen hatte er sich nach dem Krieg wieder auf die Straße, sogar eine Reise nach Berlin gewagt. Otto hatte auch nach dem Krieg an der alten Rollenverteilung festgehalten: Rainer produzierte die Ideen, Otto machte mit. Wie wichtig er für Rainer in Wirklichkeit war, begriff er nicht, er machte sich darüber auch keine Gedanken. Rainer war sein bester Freund, und zu seinem besten Freund hält man eben, unverbrüchlich. Für dieses Prinzip gab es nur eine einzige, heimliche und gerade deshalb so schmerzvolle Ausnahme, von der sich Otto einfach nicht befreien konnte, so sehr er es auch wünschte – jedenfalls noch nicht. Am Abend dieses ersten heißen Julitages im Jahr 1961 bedeutete Freundschaft für Otto, mit Rainer das erste Fernsehgerät der Familie Fisch vier Stockwerke hoch ins Wohnzimmer zu schleppen, auszupacken und sich dann erschöpft und schweißüberströmt auf den Teppich zu setzen. „Papaaa! Weg! Weeheeeg!“ „Weg da Papa!!!“ „Der will nich, dass wir gucken! Das neue Fernsehn!“ Rainer Fischs Rücken war, obwohl der gelernte Maschinenschlosser nur ein ausgeleiertes Unterhemd trug, eindeutig zu breit für die ungeduldigen Kinder auf dem Sofa, aber der Empfang haute einfach noch nicht hin, andauernd musste die Antenne neu gedreht werden, bis das Bild für kurze Zeit stimmte. Der mehrfache Vater war kein großer Mann, aber auch kein kleiner. Seine Behinderung machte er durch besondere Ausdauer wett und dadurch, dass er keine Scheu vor körperlicher Anstrengung hatte. Das konnte man seinem bis vor Kurzem noch recht hageren Körperbau immer deutlicher ansehen. Die Entbehrungen der Nachkriegsjahre hatten seine äußere Erscheinung lange geprägt, doch jetzt zeigte sich mehr und mehr, dass der Sechsunddreißigjährige eigentlich ein sportlicher und muskulöser Mann war, dessen Vitalität nicht mehr nur durch seine braunen Augen blitzte. Wenn er sich mit Freunden zum Skat traf, konnte er vollkommen die Zeit vergessen, und die Kraft, mit der er zuweilen eine Karte auf den Spieltisch drosch, flößte seinen Kindern einige Ehrfurcht ein. Auch ihm selbst entging diese körperliche Veränderung nicht, und, kurz gesagt, er genoss sie. Sein zerrüttetes Selbstbewusstsein konnte womöglich in dieses neue Volumen hineinwachsen. Eine derartige Energie wie beim Skatspielen legte er jedoch nicht überall und jedem gegenüber an den Tag, was natürlich ganz vernünftig war, doch wie sehr er sich bei manchen Gelegenheiten noch immer in Unentschiedenheit, Passivität oder auch schlichte Abwesenheit flüchtete, missfiel vor allem seiner Ehefrau und hatte keinen geringen Anteil an dem, was sehr bald auf ihn, seine Frau und seine Familie zukommen würde. „Immer wenn sich jemand bewegt, geht alles wieder zum Teufel“, brummte Rainer, fast ebenso ungeduldig wie die drei Zwerge auf dem Sofa. Er war allerdings der Einzige im Raum, der sich wirklich bewegte. Der lange, schmale Otto saß völlig erledigt auf dem Teppich und wischte sich abwechselnd den Schweiß von der Stirn und den Dunst von seinen beschlagenen Brillengläsern, damit er überhaupt eine Chance hatte, etwas zu sehen. Jenseits des Sofas fütterte die zwölfjährige Maren, älteste Tochter der Fischs, am Esstisch die Jüngste, Manuela, die schon in wenigen Monaten nicht mehr das jüngste Kind der Familie sein würde, mit Brei. Am anderen Ende des Tisches las Marens älterer Bruder Franz in einem uralten Hans-Dominik-Abenteuer, das er unter dem Dach gefunden hatte, und kümmerte sich kaum um den neuen Fernseher. Beide waren große Talente im Kunstturnen und besuchten statt der Regelschule die Erfurter Kinder- und Jugendsportschule. Wer auf eine solche Schule ging, musste nicht nur ein außergewöhnlicher Sportler sein, sondern auch gute Noten schreiben. Sie hatten sich vor Kurzem sogar beide für die Jugend-Spartakiade im nächsten Jahr in Moskau qualifiziert. Man sollte meinen, dass man als Schüler dieser Schule und mit solchem Erfolg im Rücken über ein gesundes und begründetes Selbstvertrauen verfügen konnte, doch zu Maren war diese Erkenntnis offenbar noch nicht durchgedrungen. Während Franz trotz seiner buchstäblich aus allen Poren hervordringenden Pubertät gänzlich in sich zu ruhen schien, war Marens Ego so empfindlich wie eine Pusteblume im Hochsommer. Und nicht nur das. Sie zog Missgeschicke geradezu an, steckte in einem wahren Teufelskreis von banger Erwartung und realem Unglück, das nicht selten aus ihrer Unsicherheit resultierte, welche wiederum Folge ihrer Erwartung war … Nur beim Turnen verflog ihre Angst und verwandelte sich in konzentrierte, ja verbissene Hartnäckigkeit, die sie über Rückschläge hinwegtrug und Maren zur Musterschülerin ihrer Turntrainerin machte. Den Flick-Flack auf dem Schwebebalken absolvierte Maren mit verblüffender Selbstverständlichkeit. Am Boden jedoch, mit Anlauf und in Verbindung mit einem hohen Schraubensalto, der sie wieder mit dem Gesicht in ihre Lauf-, beziehungsweise Flugrichtung und mit den Füßen sicher auf den Boden bringen sollte, verlor sie ihre Kontrolle und Form irgendwo vor dem Scheitelpunkt ihres Fluges, verwandelte sich von einem elegant springenden Fischlein in ein grotesk verrenktes, panisch nach Halt suchendes Insekt, und landete vorzeitig und meist schmerzhaft auf irgendeinem Körperteil, das nicht Maren, sondern der Zufall bestimmte. Was ein atemberaubend hoher und weit gespannter Bogen werden sollte, brach immer wieder in einem verzagten Purzeln zusammen. Doch gerade deswegen übte Maren diesen Sprung, wann immer sie Gelegenheit – und genügend Polster am Boden – dafür fand. Momentan machte sie dabei zwar keine Fortschritte, aber das war ein rein mentales Problem, das sich irgendwann würde lösen lassen. Nicht mehr lange, und sie würde bei großen, internationalen Wettkämpfen antreten, da war die Trainerin sich ganz sicher. Was Franz’ Karriere anging, war sich dessen Trainer nicht ganz so sicher. Franz hatte unbestreitbar großes Potenzial und sichtlich Spaß am Turnen, aber er nahm die Sache nicht immer ernst, kasperte lieber herum, als sich an einem Problem festzubeißen und sich zu stellen. Seltsamerweise schien das Kaspern manchmal, nicht immer, zu helfen. Franz konnte plötzlich einfach, was andere nur durch mühsames Training erreichten. Aber verlassen wollte und konnte sich sein Trainer darauf nicht. Er war einer der alten Schule und hatte einen ebenso einfachen wie fantasielosen Grundsatz: Ohne Schweiß kein Preis. So viel Prinzipientreue konnte sich Erika Fisch nicht leisten. Die momentan sieben Kinder, die sie mit ihrem Mann großzog, sorgten schon dafür, dass sich sowohl die Anzahl der eisernen Regeln als auch ihre Gültigkeitsdauer in überschaubaren Grenzen hielten. Erika hatte im Laufe der Jahre zu einer stillen, aber bestimmten Art gefunden, wie sie das alltägliche Chaos in praktikable Bahnen lenkte, und meistens funktionierte das ganz gut. Große Sprünge hatte sie in ihrem ganzen Leben noch nicht machen können, das erwartete sie auch nicht. Sie wollte einigermaßen zurechtkommen, ihre Kinder gut versorgen, das nächste Kind gesund zur Welt bringen und es nicht wieder wenige Wochen nach der Geburt verlieren, wie sie schon einmal eines verloren hatte. Was sollte man denn groß anstreben? Jetzt besaßen sie sogar ein Fernsehgerät. Das hatte sie ihrem Mann kaum zugetraut. Niemand in der Nachbarschaft hatte einen Fernseher, jedenfalls keinen neuen. Richtig stolz war sie an diesem Abend auf ihren Rainer. Ein regelrechtes Geheimnis hatte er daraus gemacht, und auch jetzt noch rückte er nicht damit heraus, wie er an dieses funkelnagelneue Gerät gelangt war und woher er soviel Geld übrig hatte. Beim Abwaschen des Abendbrotgeschirrs lugte sie immer mal wieder ins Wohnzimmer, um den kollektiven Fortschritt bei der Sicherstellung des TV-Empfangs zu verfolgen. Gerade schien das Fernsehbild klar zu sein, und die Kinder starrten elektrisiert auf das kleine Männchen, das ihnen eine Gutenachtgeschichte erzählen wollte. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht! Ich hab euch etwas mitgebracht. Rainer stemmte die Arme in die Hüften. „Na, Kinners? Erika? Is das ’n Ding? Hat noch keiner in der ganzen Straße! Otto! Otto?“ „Was? Ja, doll, ja“, keuchte Otto blinzelnd und war eigentlich mit der Frage beschäftigt, welcher Sandmann da aus dem Gerät, auf dem „Patriot“ stand, zu ihnen sprach, ob es der erwünschte, der patriotische Sandmann war oder der unerwünschte. Besser, man ging kein Risiko ein. Mit einem Risiko zu leben, strengte die Nerven wahnsinnig an, das war ihm nur allzu klar. Die Wohnungstür sprang auf. Markus, der Älteste, wusste genau, dass er das Abendessen verpasst hatte, obwohl er gerannt war. Daher tat er lieber so, als habe er etwas ganz Dringendes zu tun, und wollte das Wohnzimmer so schnell er konnte durchqueren. Sein Vater, der die Prinzipien in der Familie gerne auch mal lautstärker und auffälliger durchzusetzen versuchte, baute sich vor ihm auf, was ihn wieder in ungünstige Position für den Fernsehempfang brachte und die Kinder hell aufschreien ließ. „Weg, Papa!“ „Psssst!“ „Blödi.“ „He Markus! Papaaa!“ Rainer gab den Durchgang für Markus frei. Das flimmernde Fernsehmöbel entging dem Fünfzehnjährigen mit Elvis-Tolle natürlich nicht. „Da guckste, was? Wo kommst du her jetzt? Kriegst du woanders besser zu essen?“, fragte Rainer. Markus schickte seinem Vater ein leidlich anerkennendes „Hey! Hast du den beschafft?“ entgegen, bevor er seine Schultasche auf einen Stuhl schmiss und das Badezimmer ansteuerte. „Klar hab ich. Euer Vater tut was für die Familie!“, rief Rainer ihm hinterher. Das sollte ruhig die ganze Familie hören, jetzt waren ja alle beisammen. „Markus, ’s gibt noch Brot in der Küche“, ließ Erika ganz schlicht vernehmen, als sie aus der Küche ins Zimmer trat. Markus war einfach anders als ihre anderen Kinder, er verbrachte seine Zeit lieber außerhalb der Familie. Das war inzwischen für alle seine Geschwister ganz normal, auch wenn sie nicht wussten, warum er anders war. Erika wusste es. Rainer wusste es. Dabei sollte es auch bleiben. Ob Markus selbst es wusste? Manchmal kam es Erika so vor, zumindest erschien er ihr dann so, als wisse oder ahne er es. Von ihr hatte er jedenfalls nichts erfahren. Besser gar nicht darüber reden. „Wir haben noch wegen der Russischarbeit morgen gesessen!“, rief Markus aus dem Bad. „Bei deinem Kumpel oder bei seiner Schwester?“, parierte Rainer. „Leise! Papaaa!“, zischten die Kinder vom Sofa, denn die unglaubliche Geschichte, die das Sandmännchen ihnen präsentierte, erforderte ihre volle Aufmerksamkeit. „Bei Manni!“, kam es aus dem Bad. Rainer öffnete Markus’ Schultasche und fand darin neben dem Schulzeug zwei Elvis-Singles „Russischarbeit, am letzten Schultag vor den Ferien!“ Erikas Hand senkte sich auf Rainers Schulter und verhinderte, dass er sich wieder in Spott hineinsteigerte. „Bin stolz auf dich“, sagte sie und lenkte den Blick ihres Mannes wieder auf den Fernseher, das neue Familienmitglied. In diesem Moment schrie Maren auf, als habe sie eine tote Ratte im Babybrei gefunden. Alle drehten sich zu ihr um. Der Brei hatte ihr Gesicht gefunden, direkt aus Manuelas Mund. Das kleine Mädchen quietschte vor Vergnügen. „Mama, die Manuela … hat mir … den ganzen Brei …“ „Kann sie doch wieder ablecken!“, grölte Sigi. „Iiiih!“, schrie Maren, hilflos und gelähmt vor Scham. Schon wieder war ihr etwas passiert. Immer nur ihr. Norbert nahm seinen Bruder beim Wort und leckte ihm eine volle Breitseite über die Backe. „Ääääh, du Sau!“, schrie der, stieß den kleinen Bemme von sich weg direkt auf Carla, die kicherte, und rieb seine Backe wie wild an der Sofalehne trocken. Bemme und Carla lachten sich krumm. „Du stinkst vom Mund!“, ächzte Norbert mit letzter Kraft, doch Sigi ließ sich nicht provozieren. „Selber, du Sau!“, gab er mit rotem Kopf zurück und schaute demonstrativ wieder zum Sandmännchen. Erika reichte Maren ihr Geschirrtuch. „Ihr müsst euch eigentlich auch unseren Sandmann ansehen. Wenn ihr in der Schule gefragt werdet, erzählt ihr nichts von dem hier, ja?“ Sie hatten zwar bisher noch kein Fernsehgerät gehabt, aber über das TV-Kinderprogramm und das dahingehende Interesse der Lehrer war man informiert – aus der Wochenzeitschrift wusste Erika, dass der Sandmann im DDR-Fernsehen kurz nach dem West-Männchen gesendet wurde, von ihren Kindern hörte sie, dass die Lehrer ihre Schüler zunehmend nach den Sendungen ausfragten, die sie sahen. „Jaaaa! Zwei Sandmännchen!“, johlten die Kinder. Die Existenz zweier konkurrierender deutscher Staaten hatte unbestreitbare Vorteile. „Also, Sandmännchen und Sandmann. Erzählen dürft ihr nur vom Sandmann. O.K.?“ „Aber den Sandmann gibt’s doch nur einmal. Wie den Weihnachtsmann!“, schlaumeierte Sigi. „Is doch egal! Gucken wir beide!“, klärte Carla. „Ich schau mal, dass ich den reinkrieg“, sagte Rainer und drehte am Knopf herum. Das Sandmännchen hatte sich – „Auf Wiedersehn und schlaft recht schön.“ – bereits verabschiedet, daher fand der eifrige Vater für den Senderwechsel die Unterstützung seiner Kinder. Der westdeutsche Kanal verabschiedete sich jedoch nicht so schnell wie gewünscht, außerdem wurden Rainers Bemühungen von einem kräftigen Türklingeln unterbrochen. So musste der inzwischen wieder etwas erholte Otto weiter vor dem riskanten Fernsehprogramm am Boden sitzen, was in diesem Moment für ihn noch erträglich war, im nächsten aber die reinste Qual, denn dem Klingeln an der Tür folgten zwei Geräusche, die er ebenso gut kannte wie fürchtete – das Hecheln eines schwer gestörten Dalmatiners namens Cäsar und die stampfenden Schritte von Lisa Fisch. Weshalb Rainers schwergewichtige Mutter manchmal die Klingel an der Wohnungstür im Dachgeschoss benutzte und manchmal nicht, war allen ein Rätsel, denn sie wartete ohnehin nie, bis ihr jemand öffnete. Niemand, der mit der Familie verwandt oder befreundet war, tat das, es galt hier und in vielen Familien als Selbstverständlichkeit, einfach einzutreten, wenn man irgendwie dazugehörte, allenfalls klopfte man vorher an und betrat dann die Wohnung. Es gab an der Außenseite wie an der Innenseite der Tür eine normale Klinke, und wenn jemand zu Hause war, wurde auch niemals abgeschlossen. Nur die Haustür im Erdgeschoss sperrten Rainer oder Erika abends ab, weil sie auch Zugang zu Räumen der Berufsschule bot. Das Klingeln ließ die Fischs daher jemand Fremden erwarten und gab Lisas Auftritten eine Unberechenbarkeit, die ihr sehr gelegen kam. Unberechenbarkeit verlieh eine gewisse Macht, und Lisa war kein Mensch, der auch nur den kleinsten Fetzen Macht zurückwies oder freiwillig hergab, und bestand sie auch nur darin, der Ehefrau ihres Sohnes auf die Nerven gehen zu können. „Aaaah, da ist ja das gute Stück!“, keuchte Lisa grußlos mit Blick auf den Fernseher, während sich Cäsar drohend und knurrend auf den zurückweichenden Otto zubewegte, soweit es die Hundeleine in Lisas Hand zuließ. Die drei Kinder auf dem Sofa brachten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit, bevor ihre ungeliebte Großmutter ihre beachtliche Masse dem nächstbesten Möbel überantwortete, und das war eben das Sofa. „Na, Rainer, deine Mutter sorgt für dich!“, dröhnte sie so laut, dass es Erika, der eigentlichen Adressatin, auf keinen Fall entgehen konnte, womit auch das Geheimnis, wie Rainer als einfacher Hausmeister ein so begehrtes und so gut wie unerreichbares Gerät hatte beschaffen können, gelüftet war. Entsprechend betreten blickte Rainer kurz zu seiner Frau, die nur seufzend, aber nicht überrascht, den Kopf schüttelte. „Platz, du zerreißt ja dein schönes Halsband!“ Damit meinte Lisa natürlich ihren Hund, der kein Geheimnis daraus machte, dass er Otto gerne an Ort und Stelle ausgeweidet hätte. „N’Abend Mama. Is ja ne Überraschung …“, stammelte ihr Sohn, der in seinen kurzen Hosen und dem Feinripp-Unterhemd plötzlich dem kleinen Jungen auf der Fotografie sehr ähnelte, die hinter dem Fernseher an der Wand hing. Sie zeigte Lisa, Anfang der dreißiger Jahre, ein kesses Blumenhütchen auf ihrem breiten, lockenumkränzten Schädel, steif posierend mit den kurz geschorenen, storchenbeinigen Buben Rainer und Otto bei einem sommerlichen Spaziergang mit einem von Cäsars Vorgängern. Schon damals hatte sich Otto offensichtlich und mit gutem Grund um größtmöglichen Abstand zu Lisas Dalmatiner bemüht, der auf dem Bild vor lauter Zerren und Aufbäumen nur unscharf zu erahnen war. Das Tier auf dem Foto sah aus wie ein schwarzweiß geflecktes Monster, das soeben seine Verwandlung von einer Riesenfledermaus mit Schlangenschwanz in einen dreibeinigen Barracuda vollzog, um sich wild geifernd auf Otto zu stürzen, und das dabei von allen Anwesenden, inklusive Otto, so gut es eben ging, ignoriert wurde, weil man vor einem Fotografen stillzustehen hatte. „Hab ich’s nicht gesagt, Rainer? Lass mich nur machen, ich hab meine Beziehungen. Und du, Otto, übertriffst dich wieder mal selbst? Ich nehme einen Kaffee bitte. Und Wasser für Cäsar. Sieht ja schon wieder aus wie in Russisch-Polen hier. Und die Kinder noch nicht im Bett?“ Lisa musste sich nicht die Mühe machen, die jeweils Gemeinten anzusehen, deshalb tat sie es auch nicht. Rainer fummelte wieder am Sendereinstellknopf herum. Er wollte sich nicht unbedingt noch einen dieser Blicke seiner Frau einfangen, aber der Westsender wollte und wollte nicht weichen. War der Knopf vielleicht schon im Eimer? Der neue Fernseher schon ein Fall für die Reparatur? „Ich find den Sandmann nicht …“ Erika mochte nicht länger mit ansehen, wie die Kinder, inzwischen auf Stühle und Teppiche emigriert, ihrer Großmutter hinter ihrem Rücken Grimassen schnitten. Bevor Lisa oder Rainer sich darüber echauffieren konnten, schickte sie ihre Brut lieber ins Bett. „Kinder, ab in die Federn! Carla, bring dem Hund bitte eine Schüssel Wasser.“ Die Proteste der drei Kleinen hielten sich sehr in Grenzen, ihnen war klar, dass sie heute auf keinen Fall den zweiten Sandmann zu sehen bekommen würden. „Ich bring dir deinen Kaffee, Lisa. Otto, du noch ein Bier?“ „Nee, lass man, Erika, ich mach mich mal lieber auf die Socken … Schönen Dank.“ Otto drückte sich an der Wand entlang Richtung Wohnungstür und wunderte sich, wie der wahnsinnige Köter gleichzeitig knurren und trinken konnte. „Bis dann, Rainer. Frau Fisch …“ Rainer hob dankbar seine Linke zum Gruß, und Otto verdrückte sich. „Rainer, hilfst du mir mal in der Küche?“, rief Erika, als Otto die Tür hinter sich geschlossen hatte. Lisa blickte schon die ganze Zeit irritiert auf den Fernsehbildschirm, jetzt dämmerte ihr, dass da etwas nicht so war, wie sie es sich vorgestellt hatte. „Rainer, was ist denn das für ein Fernsehprogramm da? Das ist aber nicht unseres!“ „Ja, Schatz, ich komme!“ Rainer blieb nur die Flucht aus der Hölle ins Fegefeuer, das ihn in der Küche ohne Zweifel erwartete. „Und, was soll ich helfen?“, fragte er noch in der offenen Tür zur Küche. „Komm erst mal rein.“ Erika sah, wie drinnen in der Stube Carla in ihre Schläppchen schlüpfte. „Carla?“ „Hab nur was vergessen!“, rief sie, da war sie auch schon im Treppenhaus. „Was die nur immer macht abends. Weißt du das?“, fragte Erika ihren Mann, der nur ein Schulterzucken entgegnen konnte. Sie zog Rainer sanft, aber bestimmt von der Tür weiter in die Küche hinein, aus dem Blickfeld seiner Mutter, und senkte die Stimme. „Deine Mutter hat den Fernseher beschafft.“ „Na, ist doch nett von ihr!“, sagte Rainer lächelnd, glaubte aber selbst nicht, dass der Beschwichtigungsversuch ihm viel nützen würde. „War es deine Idee oder ihre?“, fragte Erika, und als Rainer so tat, als müsse er überlegen, sah sie den Zeitpunkt gekommen, wieder einmal etwas klarzustellen: „Rainer, deine Mutter macht keine Geschenke.“ „Ist doch aber eins.“ „So was macht sie nicht ohne Gegenleistung. Also: Was will sie?“ Nein, das schien Rainer kein geeigneter Augenblick zu sein, länger über das Thema zu reden. Nicht so, in der Zange zwischen Wohnzimmer und Küche, nicht, wenn seine Mutter da war und Erikas Stimmung drückte. Herunterspielen. Später reden. Wenn Erika wieder gut gelaunt war. Wenn sich Erika und Lisa nicht mehr hassen würden. Irgendwann. Nie. „Ach Schatz, sie will einfach nur nett sein.“ Jetzt wurde Erika wirklich sauer. „Nett? Sie hat mir in sechzehn Jahren nicht ein einziges Mal guten Tag gesagt!“ Aus dem Wohnzimmer drang Lisas Stimme in ihrer charakteristischen Mischung aus Nachtigallgesang und Geschützdonner: „Habt ihr mich vergessen? Bekomme ich denn keinen Kaffee?“ Rainer drückte Erika schnell einen Kuss auf die Wange, schnappte sich die Kaffeetasse, die schon bereitstand, und verschwand aus der Küche. „Hempel! Hempel! Hempelpempel!“ Heute Abend machte es sogar das Huhn spannend – es versteckte sich irgendwo im Hühnerstall, einem alten, seitlich ans Haus gezimmerten Holzschuppen auf dem Schulhof. „Ich muss ins Bett, Hempelchen!“, rief Carla und presste sich gegen die Tür, deren rostige Angeln das Öffnen und Schließen eher behinderten als ermöglichten. Endlich hatte sie den Türspalt so weit geöffnet, dass sie hindurchpasste. Licht fiel ins Innere, einige Hühner blinzelten Carla an, doch ihr Liebling war nicht zu sehen. „Hempel! Willst du kein Küsschen?“ Da kam Hempel gelaufen. Sofort nahm Carla das Tier und drückte es an ihre Wangen. „Warum versteckst du dich denn, Dummerchen. Tu dir doch nix. Oben sitzt die Oma Liese. Diiiie ist vielleicht blöd! Aber die tut dir auch nix, das verspreche ich dir. Die tut nur Mama und Papa was. Mama schimpft immer am nächsten Tag, wenn Oma Liese da war. Da schimpft sie immer ganz alleine. Morgen schimpft sie bestimmt ganz viel. Sag mir Gutnacht, ja?“ Manchmal schimpfte ihr Papa auch, wenn seine Kinder ihre Oma „Liese“ und nicht Lisa nannten, denn es erschien ihm respektlos und zu nah an der spöttischen Wendung „dumme Liese“. Man konnte seiner Mutter vieles nachsagen, aber ganz bestimmt nicht Dummheit. Carla hielt Hempel direkt vor ihre Nase und schnäbelte ein bisschen mit ihr. „Bald wissen wir, ob du ein Weibchen oder ein Männchen bist, bald bist du groß. Meine kleine Hempel.“ Solange über Hempels Geschlecht keine Klarheit herrschte, redete Carla ihr geliebtes Huhn mal als Er und mal als Sie an. Sie setzte Hempel wieder ab und schlüpfte durch den Türspalt. „Naahaacht, bis morgen!“ Die Frage, wer in welchem Zimmer schlief, stellte sich für die Familie Fisch immer von Neuem, je größer die Kinder wurden, denn im Unterschied zu den Kindern wuchs der wenige ihnen zur Verfügung stehende Wohnraum nicht von allein. Die Wohnung war eigentlich zu klein für die Großfamilie, was aber selten für Verdruss sorgte, denn die Fischs kannten es nicht anders und hatten ihr Zusammenleben entsprechend organisiert. Allerdings würden in etwa vier Monaten aus neun Familienangehörigen zehn geworden sein. (Zumindest gingen die schwangere Erika und die Kinder von dieser Zahl aus, daher galt zukünftig, ab Spätherbst, eine neue Ordnung, die allerdings einen Umbau im Dachgeschoss erforderte. Dass die Anzahl der zu berücksichtigenden Familienmitglieder auch eine höhere sein könnte und dass es Rainer war, der diese Möglichkeit ernsthaft und nicht ganz freiwillig in Betracht zog, verschwieg der Familienvater.) Der momentane Status lautete jedenfalls: Ein Wohnzimmer mit Esstisch diente tagsüber zusammen mit der kleinen Küche als familiäres Zentrum, ein Schlafzimmer nutzten die Eltern Erika (39) und Rainer (36) mit der kleinen Manuela (1), ein kleines Kinderzimmer gab es für die beiden ältesten Jungs Markus (15) und Franz (14) und ein etwas weniger kleines für die vier Kinder Maren (12), Carla (8), Siegfried (6) und Norbert (4). Da das Badezimmer auch die einzige Toilette der Wohnung enthielt, galt das Abschließen seiner Tür als absolutes Privileg der Eltern. Nahm sich einmal eins der Kinder dieses Recht heraus, wurde dies von den Geschwistern meist mit lautem Geschrei und Poltern gegen die Tür, nicht selten auch mit sofortiger Anzeige bei der Mutter geahndet, denn dann war in der Regel Gefahr in Verzug. Das heißt, wer aufs Klo musste, musste dringend aufs Klo. Erika hatte die schmutzige Wäsche ohne Waschmaschine zu bewältigen, weshalb sie raue Hände bekam und ein besonderes Interesse daran zeigte, dass vor allem ihre kleineren Kinder möglichst ungehindert die Toilette aufsuchen konnten. Die Anzahl der Betten betrug, rechnete man die beiden Doppelstockbetten als jeweils zwei und das kleine Gitterbettchen Manuelas als eins, nur sieben, denn die Eltern teilten sich ein breites Ehebett und die beiden Jungs Siegfried und Norbert ein einfaches Bett. Diese Aufteilung hatte bei den jeweiligen Bettgenossen durchaus ähnliche und auch ähnlich widersprüchliche Folgen. Einerseits sorgte das körperliche Beieinander für eine nächtliche Geborgenheit, andererseits war es nicht selten der Grund für mehr oder weniger heftige Auseinandersetzungen, die sich bei Erika und Rainer um „Erwachsenen-Themen“ drehten wie Kinder, Schwiegermütter, Lust (Rainer) oder keine Lust (Erika) auf Sex, zu wenig (Erika) oder zu viel (Rainer) Haushaltsgeld, bei Siegfried und Norbert um Körperhygiene, Besitzansprüche auf Spielzeug und Bettdecke, Verdauungsgase oder den Bewegungsspielraum im Bett. In jüngster Zeit kam Sigis Neigung, mit seinem bevorstehenden Schuleintritt zu prahlen und Norbert deswegen als „Baby“ zu titulieren, verschärfend hinzu. Da Norbert kein Junge war, der Schmähungen unerwidert über sich ergehen ließ, wuchs das Konfliktpotenzial im vollsten Schlafzimmer der Familie spürbar und verlangte ebenfalls nach einer Neuordnung der Wohnverhältnisse. Außerdem hörte Maren langsam auf, ein Kind zu sein, sodass die Eltern in Zukunft getrennte Zimmer für Jungs und Mädchen als unerlässlich ansahen. Maren schlief im unteren Teil des Doppelstockbettes, weil sie, die Kunstturnerin, fürchtete, nachts aus dem oberen herauszufallen. (Sie fiel nie aus ihrem Bett, blieb aber mehrfach auf sehr schmerzvolle Weise mit ihren dunkelblonden, langen Haaren in dem dehnbaren Drahtgeflecht hängen, das die obere Matratze hielt, und zog dabei, nicht minder schmerzhaft, den Spott ihrer kleinen Brüder auf sich.) Markus und Franz hatten auf ihre, genauer betrachtet auf Franz’ Weise schon vor etwa zwei Jahren geregelt, wer das begehrte obere Bett in ihrem Zimmer haben durfte – sie hatten sich darum geprügelt. Wenig überraschend hatte dabei der jüngere, aber körperlich und mental weit überlegene Franz gewonnen, indem er seinen älteren Bruder derart in den Schwitzkasten genommen und ihn so tief in das Gefühl vollkommener Machtlosigkeit gestürzt hatte, dass dieser gut eine Stunde brauchte, um sich zumindest körperlich davon zu erholen. Die seelische Niederlage überwand er nie, und wenn je ein Verhältnis zwischen zwei Brüdern nicht „brüderlich“ genannt werden konnte, dann dieses. Immerhin waren sie beide kluge Jungs, und nun hatten sie ihre Territorien, fast ohne Überschneidungen, sauber abgesteckt und vermieden auf diese Weise weitere Großkämpfe. Franz wurde vom Sport stark beansprucht und betätigte sich in seiner Freizeit als Helfer seiner Mutter und als unauffällige Leseratte, Markus übte sich als Jäger seltener und staatlicherseits unerwünschter Rock ’n’ Roll – Schallplatten, die er am liebsten allein oder in Gesellschaft einiger Jugendlicher hörte, die mit ihm diese Leidenschaft teilten, und zwar stets außerhalb seiner Familie. Bis die ältesten Kinder die Familie verlassen und Platz schaffen würden, musste nun die Anzahl der Zimmer irgendwie erhöht werden. Geplant war daher, eine bisher als Stauraum genutzte Dachkammer bis zur Geburt des nächsten Kindes bewohnbar zu machen, um die Belegung der Zimmer neu ordnen und den veränderten Umständen anpassen zu können. Norbert und Siegfried sollten demnach im Herbst das neue Zimmer bekommen, die kleine Manuela zu den beiden anderen Mädchen ziehen und ihr Bettchen im Elternschlafzimmer für das Baby freimachen. So war der Stand der Dinge an diesem Juliabend unterm Dach der Betriebsberufsschule des VEB Hochbau Erfurt, als Erika Fisch die vier Kinder Norbert, Siegfried, Carla und Maren ins Bett brachte und glaubte, zumindest für die kommenden zwei bis drei Jahre sei die Frage, wer in welchem Zimmer schlief, geklärt. „Den ganzen Brei in dein Gesicht ausgekotzt! Buääääärrr!“ Carla kringelte sich vor Lachen, während sie unter ihre Bettdecke krabbelte, die wegen des heißen Wetters nur aus einem leeren Bettbezug bestand. Maren stand beleidigt vor dem Doppelstockbett und streckte ihrer kleinen Schwester die Zunge raus. „Die Manuela hat überhaupt nich gekotzt! Du bist so blöd!“ Dann warf sie sich viel zu heftig in ihre Bettkoje, donnerte mit dem Kopf gegen die hintere Wand, schaltete ihre Leselampe an, drehte sich mit dem Gesicht zur Blümchentapete und weinte vor Schmerz und Scham. Mit ihren zwölf Jahren musste sie eigentlich nicht mehr mit den Kleinen schlafen gehen, aber sie schreckte noch davor zurück, nicht mehr als „klein“ zu gelten. Solange sie „klein“ war, mochte man ihr die andauernden Missgeschicke nachsehen, für eine junge Dame waren sie eine riesige, unentschuldbare Blamage. Natürlich musste sie, je älter sie wurde, immer mehr Aufmerksamkeit darauf verwenden, ihr wahres Alter und ihre wirkliche Reife zu verbergen, was wiederum ihre Ungeschicklichkeit verstärkte, ja geradezu ins Groteske steigerte. Sie musste damit aufhören, und zwar bald. Sie musste endlich anfangen, wenigstens ein „großes Mädchen“ zu sein. Dann würde sie immer noch genug Zeit haben, eine Frau zu werden. Vielleicht war ja die neue Aufteilung der Kinderzimmer im Herbst eine gute Gelegenheit für diesen Anfang. Das jedenfalls dachte dieses weinende Mädchen mit einer Beule auf der Stirn, das auf dem Schwebebalken so sicher turnte wie keine Gleichaltrige in der ganzen DDR. „Ich berühr dich nie mehr!“, quiekte Carla. „Dich hat sie auch schon angespuckt, tu doch nich so!“, schluchzte Maren leise in ihre Decke. „Du stinkst vom Mund!“, dröhnte Norbert mit seiner für einen so kleinen Jungen erstaunlich lauten und tiefen Stimme und zappelte angewidert so sehr unter dem Bettbezug herum, dass er seinen Bruder mit dem Knie in den Bauch traf. Der entließ einen gewaltigen Rülpser und stieß Norbert zischend von sich weg. Im selben Moment trat Erika ins Zimmer. „Äääääh! Du stinkst! Du stinkst!“ Norbert hatte den Rülpser voll abbekommen. „Norbert, schrei nicht so, jetzt wird geschlafen“, beschwichtigte seine Mutter. „Alle gewaschen, gekämmt, Zähne geputzt?“ „Mama, der Sigi stinkt vom Mund, der soll hier nicht schlafen! „Sigi, du sollst nicht immer die Bierflaschen vom Hof austrinken. Ich sag es dem Rainer noch mal, dass die Lehrlinge da unten heimlich saufen.“ Siegfried spielte das Unschuldslamm. „Mach ich doch gar nich. Mama, is die blöde Oma Liese morgen immer noch da?“ „Mama, die Carla is so doof!“, wimmerte Maren, als läge sie in den letzten Zügen. Niemand hörte sie. „Die dicke Oma Liese!“, kicherten Carla und Norbert gleichzeitig. Erika hielt es für das Beste, die harschen Urteile der Kinder über die jüngere ihrer beiden Großmütter weder zu bestätigen noch zu dementieren. „Leise, Kinder. Ruhe jetzt. Schlaft schön, bis morgen.“ Sie löschte das Licht. Nur noch Marens Leselampe und der schwache Schein des Abendlichts, der durch die dicken Vorhänge drang, erhellten den Raum ein wenig. Carla zog ihre Augenlider zu schmalen Schlitzen zusammen. Sie liebte dieses Zwielicht. Vor ihren Augen begann es dann stets zu flimmern. Das, dachte sie, seien die Bazillen, die in der Luft herumschwirrten und die man nur sehen konnte, wenn es nicht hell, aber auch nicht ganz dunkel war. Es gab ziemlich viele von diesen Bazillen im Zimmer. „Ääääh, Stinker!“, brummte Norbert. „Ich mach dir deinen Roller kaputt!“, gab Siegfried zurück. „Buääääär!“, ahmte Carla wieder das Kotzgeräusch nach. Alle kicherten, auch Maren. Carla dachte, vielleicht würde sie weniger Bazillen sehen, wenn die zwei Jungs nicht mehr im gleichen Zimmer schliefen. Das war sogar sehr wahrscheinlich. Sie hörte, wie Maren ihr Buch aufschlug, und schloss die Augen. Heute war ja doch nichts Schlimmes passiert, dachte sie. Erika hatte noch einen Moment an der Tür gelauscht, bis die Kinder still waren. Sie zerbrach sich nicht den Kopf darüber, warum Maren immer noch mit ihren kleinen Geschwistern schlafen ging. Ihr war es eigentlich ganz recht so. Sie genoss die abendliche Ruhe, wann immer sie konnte, und es war um so ruhiger, je mehr Kinder schliefen. Bald würde es damit für sie ohnehin wieder vorbei sein, mit dem nächsten Baby. Die vier im Kinderzimmer schienen für heute tatsächlich alle Energie verbraucht zu haben, und Manuela träumte bereits eine ganze Weile in ihrem Bettchen. Die beiden großen Jungs hatten sich auch schon in ihr Zimmer verdrückt. Klar, Oma Lisa war zu Besuch. Da wollte keiner unnötig viel Zeit mit ihr im selben Raum verbringen. Erika griff in die Tasche ihrer Kittelschürze und holte eine Schachtel Zigaretten heraus. Die hatte sie sich jetzt verdient, dachte sie und hob den Kopf. Aus dem Wohnzimmer vernahm sie gedämpfte Stimmen und Unterhaltungsmusik vom Fernseher. Von dieser Stelle im Flur konnte sie nicht in die Stube sehen, und die beiden dort drinnen konnten sie nicht sehen. Lisa schien zu flüstern. Erika lauschte erneut, doch nun in diese Richtung. „Wann sagst du’s ihr denn nun?“, hörte sie ihre Schwiegermutter. Nach einer Weile antwortete Rainer, unwillig und ebenfalls flüsternd: „Eilt doch nich, oder?“ „Es gibt immerhin eine Menge zu tun, Junge. Wenn ich das Zimmer der zwei Jungs bekomme, musst du schon vorher die Dachkammer fertig haben für die beiden, oder glaubst du, ich teile auch nur eine Minute mein neues Zimmer mit den Gören?“ „Ich mach schon. Ich red mit Erika,“ lavierte Rainer, wie immer. Lisa setzte ihre Kaffeetasse geräuschvoll auf der Untertasse ab. „Die soll nur was sagen. Bringst du mich jetzt nach Hause?“ Erika griff nach der Zigarettenschachtel. Leer. Ihre Hände zitterten. Alle Zigaretten lagen vor ihr verstreut auf den Dielen. Als Rainer Fisch den mütterlichen Auftrag erfüllt und Lisa mit der Straßenbahn in ihre geräumige Wohnung gebracht hatte, in der sie schon seit dem Krieg lebte, wartete Erika, einen Kriminalroman lesend, im Bett auf ihn. Er wusch sich rasch im Badezimmer, zog sich aus und schlüpfte, wie immer nackt, unter seine Bettdecke, seiner Frau den Rücken zugewandt. All dies tat er, ohne ein Wort zu sprechen. Er drückte seinen Kopf ein paarmal in sein Kissen, wie er es immer vor dem Einschlafen tat, und ließ ein undeutliches „Gute Nacht, Schatz“ vernehmen. Erika nahm ihre Lesebrille ab. „Du wolltest mit mir reden.“ Rainer, wie aus tiefen Träumen auftauchend, öffnete seine Augen ein klein wenig und atmete vorsichtig ein und wieder aus. „Was?“, brummte er. „Du hast eben zu deiner Mutter gesagt, dass du mit mir reden willst.“ Rainer drehte sich auf den Rücken, blickte zum Lampenschirm, der an der Decke über ihnen baumelte. Die Glühbirne hatte schon eine schwarze Stelle, fiel ihm auf. Sie würde nicht mehr lange halten. Das Gute an seinem Job war, dass er sich um Dinge wie Glühbirnen nicht groß Sorgen machen musste. Er hatte ein kleines Materiallager im Keller der Schule, wo es immer einen gewissen Vorrat gab, auch an Glühbirnen. Natürlich waren sie nicht im Überfluss vorhanden wie im Westen, dachte er, aber hier im Osten nutzte eben jeder die Möglichkeiten, die er hatte, und Rainers besondere Möglichkeiten bestanden zum Beispiel aus der einen oder anderen Glühbirne, die er problemlos aus dem Vorrat abzweigen konnte. Das war das Mindeste, was er als Ausgleich für die ihm vorenthaltene Lehrertätigkeit erwarten durfte. Gleich morgen würde er eine neue Glühbirne aussuchen und bereitlegen, beschloss er. „Ich hab dir doch gesagt, sie macht keine Geschenke. Aber das wusstest du ja schon.“ Erikas Ton wurde eindringlicher, aber nicht lauter. „Entschuldigung“, sagte Rainer und ließ es offen, wofür er sich entschuldigte – dafür, dass er noch nicht mit seiner Frau über den Plan seiner Mutter gesprochen hatte, dafür, dass er diesem Plan offensichtlich nichts entgegenzusetzen gewillt war, oder für beides zusammen. Für Erika spielte es in diesem Moment auch keine Rolle. „Sie will wirklich zu uns ziehen? Hier in unsere Wohnung? Sag, dass es ihre Idee war und nicht deine.“ „Es war ihre.“ Erika hatte keinen Anlass, ihrem Mann nicht zu glauben, denn die ganze Affäre passte von A bis Z zu ihrer Schwiegermutter. Sie drehte sie sich zu Rainer, mühsam, was an ihrem immer runder werdenden Bauch lag und dem anstrengenden Tag, den sie hinter sich hatte, und legte ihre Hand auf die Schulter ihres Gatten. „Rainer. Von deiner Mutter erwarte ich nichts anderes. Die hat nie verschmerzt, dass ihr Rainer eine Frau hat. Die kann nicht verlieren. Weiß der Teufel, warum sie so ist. Sie hasst mich eben. Und wenn die hier bei uns wohnt … dann hat sie gewonnen, dann … Ich würde mir so wünschen, dass du mal Nein sagst zu ihr.“ Rainer lächelte verlegen. „Ich hab doch dich zum Neinsagen.“ Erika begann, sich für ihre Langmut selbst zu bewundern. „Ich stehe immer nur zwischen dir und ihr. Wie stellst du dir das vor, hier in unserer Wohnung, von morgens bis abends, sieben Tage die Woche? Glaubst du, Lisa verlässt die Wohnung überhaupt noch, wenn sie mal hier wohnt? Sie quält sich jeden Tag die Treppen runter und wieder rauf? Nee, niemals. Glaubst du wirklich, wir könnten so leben? Und die Kinder, die kriegen wieder kein drittes Zimmer? Das gibt Mord und Totschlag. Was soll ich machen, wenn du Lisa nicht fernhältst? Stacheldraht ums Haus ziehen? Glaubst du wirklich, wir könnten hier mit deiner Mutter leben?“ „Warum denn nicht?“ Erika stieß sich von Rainers Schulter ab und ließ sich wieder auf den Rücken rollen. „Sag es bitte. Sag Nein. Sag es ihr selbst.“ „Gute Nacht, Schatz.“ Rainer drehte sich wieder auf die Seite. Erika suchte mit ihrem Blick irgendeinen Halt. Die Glühbirne hatte einen schwarzen Fleck, fiel ihr auf. Sie würde bestimmt bald durchbrennen.
Kommt ein Wölkchen angeflogenIrgendwann würde Hempel fliegen, das wusste Carla ganz genau. Hempel war das allerschönste und liebste Huhn von allen Hühnern der Familie Fisch, fand jedenfalls das Mädchen, und deshalb hatte Carla ihm auch einen Namen gegeben. Sie wusste nicht, ob Hempel ein Hahn oder eine Henne war. "Das kann man bei Hühnern erst später erkennen", sagte Carlas Mutter immer. "Aber fliegen können diese Hühner nicht." Wenn man erst viele Wochen nach dem Schlüpfen sehen konnte, ob Hempel eine Henne oder ein Hahn war, warum sollte das Tier nach ein paar Wochen nicht auch fliegen können? Es war ein ganz besonderes junges Huhn. Hempel kam Carla immer entgegengerannt, wenn die Achtjährige über den alten Schulhof lief, der zur Betriebsberufsschule des "VEB Hochbau Erfurt" gehörte. Dann hob Carla Hempel vom Boden hoch und herzte sie - oder ihn. Das braun-weiße, halbwüchsige Huhn fühlte sich weich an wie Seide und pickte zärtlich gegen Carlas Nase. Jeden Abend wünschte Carla Hempel eine gute Nacht, bevor sie selbst ins Bett musste. Carlas Eltern wussten nicht, dass ihre zweitjüngste Tochter ein Lieblingshuhn hatte, auch nicht, dass es Hempel hieß. Das war Carlas Geheimnis.Für Carlas Vater, Rainer Fisch, Hausmeister der Schule, waren die Hühner einfach gut, um die Familie mit frischen Eiern zu versorgen, ab und zu auch mal mit einer schönen Hühnersuppe oder einem Brathähnchen. Bei sieben und nun bald acht Kindern, die satt werden wollten, durfte man natürlich nicht so häufig Hühner schlachten, sonst wären bald keine mehr übrig gewesen, die Eier legen konnten. Rainer dachte da ganz praktisch. Er war Stadtkind, in Erfurt groß geworden, von seiner Mutter gleichzeitig verwöhnt und beherrscht und gegenüber den Geschwistern bevorzugt. Seinen Vater hatte er nie kennengelernt, seine Mutter Lisa weigerte sich noch heute, die Identität seines Vaters preiszugeben, und falls seine Geschwister, allesamt älter als er, sie kannten, hatten sie bisher absolut dichtgehalten. Warum er nicht als Geschichtslehrer arbeitete, wie er es eigentlich wollte, verstand Carla nicht. Schließlich hatte er vom Krieg eine kaputte Hand und konnte manche Hausmeisterarbeiten nur mit Mühe erledigen. Er ärgerte sich darüber aber seltener, als es Carlas Mama tat. Sie ärgerte sich ziemlich häufig und schimpfte auf irgendwen, auf "die da". Besonders, wenn sie sich unbeobachtet fühlte, schimpfte sie ganz allein vor sich hin.Carlas Mama Erika mochte die Gegenwart der Hühner, weil diese gleichermaßen gewöhnlichen wie urtümlichen Vögel sie an ihre Kindheit erinnerten. Sie war auf einem kleinen Bauernhof in der Nähe von Stralsund aufgewachsen, mit vielen Geschwistern und einem ewig besoffenen Stiefvater. Ihre Mutter Anna hatte in dem rückständigen Dorf als Hexe gegolten, weil sie mit ihren Tieren sprach wie mit Menschen. Vor allem, wenn ein Tier krank war, zog sich Anna mit ihm in den Stall zurück und redete mit ihrem Patienten. Meistens ging es dem Tier bald wieder besser. Vielleicht hatte sich diese Vorliebe oder Fähigkeit von der Großmutter auf Carla vererbt. Manchmal schien es Erika, als habe die kleine Carla zwischen ihren zarten, hellblonden Locken hochempfindliche Antennen für die Dinge, die in der Luft lagen. Was Erika wohl zu den intimen Gesprächen zwischen ihrer Tochter und Hempel gesagt hätte? Ihre Kinder waren ihr ohnehin manchmal unheimlich, und so war es wohl besser, dass sie nichts davon wusste.Carla verfügte tatsächlich über eine Art Antennen, natürlich nicht auf ihrem Kopf, sondern in ihrem sensiblen Wesen, ihrer ausgeprägten Fantasie, die immer irgendwie in Verbindung mit dem stand, was sie umgab. Carlas besonderes Gespür für die Dinge hatte das Mädchen auch veranlasst, seine besondere Freundschaft mit Hempel nicht an die große Glocke zu hängen. Ihre Geschwister hätten sie bloß gehänselt, vor allem Siegfried und Norbert. Die beiden interessierten sich überhaupt nicht für die Hühner, Norbert jagte sie sogar manchmal mit seinem klapprigen Holzroller
| Erscheinungsdatum | 22.10.2019 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main / Niederrad |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 125 x 210 mm |
| Gewicht | 450 g |
| Themenwelt | Literatur |
| Schlagworte | DDR-Fernsehen • DDR-Gründung • Erfurt • Hausmeister • Mauerbau • Mauerfall • Offenen Lesebühne Pankow • Offenen Lesebühne Pankow • Ost-Berlin • Republikflucht • Sandmännchen • Stacheldraht • Stasi • Ulbricht • Westen |
| ISBN-10 | 3-86638-291-X / 386638291X |
| ISBN-13 | 978-3-86638-291-6 / 9783866382916 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich