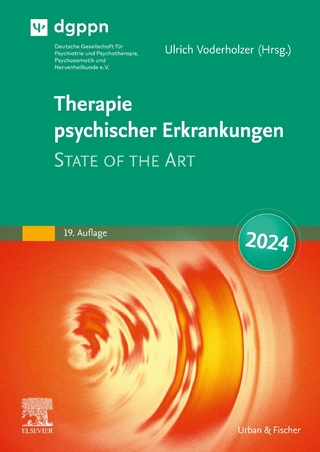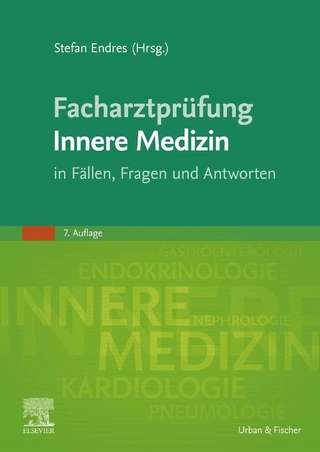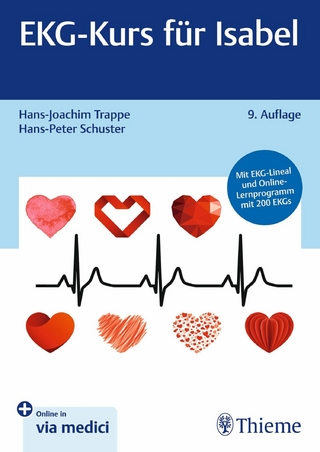Michael Fehr, Anja Ewringmann, Martina Warschau: Frettchen 1
Innentitel 4
Impressum 5
Vorwort 6
Inhaltsverzeichnis 7
Anschriften 17
Autorenvorstellung 18
Teil 1 Das Frettchen als Heimtier 20
1 Einführung 21
1.1 Domestikation 21
2 Arten, Rassen und Farben 23
2.1 Häufige Zuchtformen 23
3 Haltung 26
3.1 Haltungsformen 26
3.1.1 Innenhaltung 26
3.1.2 Außenhaltung 28
3.1.3 Gesellschaft und Vergesellschaftung 28
3.1.4 Auslauf und Beschäftigung 30
3.1.5 Häufige Haltungsfehler 31
4 Ernährung 32
4.1 Allgemeines 32
4.2 Futtermittel 33
4.2.1 Einzelfuttermittel 33
4.2.2 Kommerzielle Mischfutter 33
4.3 Bedarfsangaben 34
4.3.1 Jungtiere 34
4.3.2 Bedarfsangaben erwachsener Frettchen 35
4.4 Trinkwasser 35
4.5 Grundregeln der Fütterung 36
4.6 Häufige Fütterungsfehler 37
5 Verhalten 38
5.1 Sozialverhalten 38
5.2 Aktivitäts- und Ruheverhalten 38
5.3 Spielverhalten 39
5.4 Aggressionsverhalten 40
5.5 Kommunikation 40
5.5.1 Geruch und Markierverhalten 40
5.5.2 Lautäußerungen 40
5.5.3 Körpersprache 41
6 Fortpflanzung 42
6.1 Einfluss der Tageslichtlänge 42
6.2 Weiblicher Geschlechtszyklus 42
6.3 Männliche Fortpflanzung 43
6.4 Paarung 44
6.5 Trächtigkeit 44
6.6 Geburt 45
6.6.1 Geburtsanzeichen 45
6.6.2 Geburtsvorgang 45
6.7 Säugephase und Entwicklung der Neonaten 45
6.7.1 Mutterlose Aufzucht 46
6.8 Fortpflanzungsdaten 47
7 Anatomie und Physiologie 48
7.1 Haare, Haut und Hautanhangsdrüsen 48
7.2 Skelett 48
7.3 Sinnesorgane 49
7.3.1 Augen 49
7.3.2 Gehör 50
7.3.3 Tastsinn 50
7.3.4 Geruchs- und Geschmackssinn 50
7.4 Muskulatur 50
7.5 Respirationssystem 50
7.6 Verdauungsorgane 51
7.6.1 Zähne und Maulhöhle 51
7.6.2 Speicheldrüsen 52
7.6.3 Ösophagus 52
7.6.4 Magen 52
7.6.5 Dünndarm 52
7.6.6 Dickdarm 52
7.6.7 Leber 53
7.6.8 Pankreas 54
7.6.9 Daten zur Verdauung 55
7.7 Herz-Kreislauf-System 55
7.8 Lymphatische Organe 55
7.9 Harnapparat 56
7.10 Geschlechtsorgane 56
7.10.1 Weiblicher Genitaltrakt 56
7.10.2 Männlicher Genitaltrakt 56
7.11 Endokrine Organe 57
7.11.1 Nebennieren 57
7.11.2 Schilddrüse und Nebenschilddrüse 58
7.12 Physiologische Daten 58
Teil 2 Diagnostik und Erkrankungen 60
8 Allgemeinuntersuchung 61
8.1 Transport 61
8.2 Handling 61
8.2.1 Fixationstechniken 62
8.2.2 Öffnen des Maules 64
8.2.3 Zwangsfütterung 64
8.3 Geschlechtsbestimmung 65
8.4 Altersbestimmung 65
8.5 Untersuchungsgang 66
8.5.1 Anamnese 66
8.5.2 Allgemeinuntersuchung 66
9 Spezielle Untersuchungsmethoden 74
9.1 Blutuntersuchung 74
9.1.1 Blutentnahme 74
9.1.2 Labordiagnostische Referenzbereiche 75
9.2 Kotuntersuchung 77
9.3 Harnuntersuchung 77
9.3.1 Harngewinnung 78
9.3.2 Harnuntersuchung 78
9.4 Bildgebende Verfahren 79
9.4.1 Röntgenuntersuchung 79
9.4.2 Ultraschalluntersuchung 85
9.4.3 Echokardiografie 88
9.4.4 Elektrokardiografie (EKG) 89
9.4.5 Endoskopie 90
9.4.6 CT und MRT 90
10 Applikation von Arzneimitteln 92
10.1 Injektionstechniken 92
10.1.1 Intravenöse Injektion 92
10.1.2 Intramuskuläre Injektion 92
10.1.3 Subkutane Injektion 93
10.1.4 Intraperitoneale Injektion 93
10.2 Orale Applikation 93
11 Differenzialdiagnosen/ Leitsymptome 94
11.1 Alopezie 94
11.2 Anämie 94
11.3 Ataxie 94
11.4 Aufgetriebenes Abdomen 95
11.5 Dermatitis 95
11.6 Diarrhö 96
11.7 Dyspnoe 96
11.8 Erbrechen 97
11.9 Hämaturie 97
11.10 Hodenschwellung 98
11.11 Hypersalivation 98
11.12 Juckreiz 98
11.13 Krämpfe 98
11.14 Parese der Hinterhand 99
11.15 Spenomegalie 99
11.16 Vulvaschwellung 100
12 Erkrankungen 101
12.1 Traumata 101
12.1.1 Pneumothorax 101
12.1.2 Frakturen 102
12.2 Fütterungsbedingte Krankheiten 103
12.2.1 Adipositas 103
12.2.2 Mangelernährung 104
12.2.3 Trächtigkeitstoxikose 105
12.2.4 Zahnerkrankungen 106
12.2.5 Urolithiasis 107
12.2.6 Botulismus 109
12.3 Haltungsbedingte Krankheiten 109
12.3.1 Bissverletzungen 109
12.3.2 Adipositas 111
12.4 Umweltbedingte Erkrankungen 111
12.4.1 Hyperöstrogenismus der Fähe bei persistierender Ranz 112
12.5 Virale Infektionskrankheiten 112
12.5.1 Tollwut 112
12.5.2 Staupe 113
12.5.3 Influenza 115
12.5.4 Aleutenkrankheit 116
12.5.5 Epizootische katarrhalische Enteritis (ECE, „green slime disease“) 117
12.5.6 Systemisches granulomatös-entzündliches Syndrom (systemische Coronavirusinfektion) 118
12.5.7 Rotavirusinfektion 119
12.6 Bakterielle Infektionskrankheiten 120
12.6.1 Helicobacter mustelae 120
12.6.2 Colibazillose 121
12.6.3 Campylobacteriose 122
12.6.4 Salmonellose 122
12.6.5 Lawsonia-intracellularis-Infektion 123
12.6.6 Mykobakteriose 124
12.6.7 Botulismus 125
12.6.8 Infektionen mit Staphylokokken und Streptokokken 126
12.6.9 Bakteriell bedingte Pneumonie 127
12.6.10 Bakterielle Erkrankungen des Harn- und Geschlechtstrakts 129
12.7 Pilzinfektionen 131
12.7.1 Dermatophytose 131
12.7.2 Systemische Mykosen 133
12.8 Endoparasitosen 134
12.8.1 Kokzidiose 134
12.8.2 Kryptosporidien 136
12.8.3 Giardiasis 137
12.8.4 Toxoplasmose 137
12.8.5 Nematoden 138
12.8.6 Dirofilaria immitis (Herzwurmerkrankung) 139
12.8.7 Zestoden 141
12.9 Ektoparasitosen 141
12.9.1 Ohrräude 141
12.9.2 Flöhe 143
12.9.3 Sarkoptesräude 144
12.9.4 Myiasis 145
12.10 Hauterkrankungen 146
12.10.1 Infektionsbedingte Dermatitiden 146
12.10.2 Alopezie 148
12.10.3 Erkrankungen der Analbeutel 151
12.10.4 Pododermatitis 152
12.10.5 Hauttumoren 154
12.10.6 Seltene Hauterkrankungen 155
12.11 Augenerkrankungen 157
12.11.1 Angeborene Erkrankungen 157
12.11.2 Exophthalmus 157
12.11.3 Konjunktivitis 158
12.11.4 Ophthalmia neonatorum 159
12.11.5 Keratitis/Korneaulkus 160
12.11.6 Katarakt 161
12.11.7 Linsenluxationen 162
12.11.8 Glaukom 163
12.11.9 Uveitis 163
12.11.10 Erkrankungen der Retina 165
12.11.11 Tumoren des Auges 165
12.12 Ohrerkrankungen 166
12.12.1 Otitis externa 166
12.12.2 Otitis media 167
12.13 Erkrankungen der Muskulatur 169
12.13.1 Disseminierte, idiopathische Myofasciitis (DIM)/Myositis 169
12.13.2 Myasthenia gravis 170
12.13.3 Neoplasien der Muskulatur 171
12.14 Erkrankungen des Respirationstrakts 171
12.14.1 Bronchitis 171
12.14.2 Pneumonie 171
12.14.3 Neoplasien des Respirationstrakts 174
12.15 Herz-Kreislauf-Erkrankungen 175
12.15.1 Kreislaufschock 175
12.15.2 Hitzschlag 177
12.15.3 Herzerkrankungen 178
12.15.4 Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) 181
12.15.5 Herzklappenerkrankungen 181
12.15.6 Seltenere Erkrankungen des Herzens 183
12.16 Erkrankungen der Maulhöhle und der Zähne 184
12.16.1 Zahnstein, Gingivitis und Parodontitis 184
12.16.2 Zahnfrakturen/Zahnabrieb 188
12.16.3 Hypodontie/Zahnverlust 189
12.16.4 Mukozele der Speicheldrüsen (syn. Sialozele, Speichelzyste) 190
12.16.5 Tumoren der Maulhöhle 191
12.17 Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts 192
12.17.1 Megaösophagus 192
12.17.2 Gastrointestinale Fremdkörper, Fremdkörperileus 193
12.17.3 Gastritis und Magenulzera 195
12.17.4 Enteritis 197
12.17.5 Neoplastische Erkrankungen 203
12.17.6 Rektumprolaps 204
12.18 Lebererkrankungen 205
12.18.1 Hepatitis 205
12.18.2 Lipidose 206
12.18.3 Leber- und Gallengangzysten 207
12.18.4 Neoplastische Erkrankungen 208
12.19 Erkrankungen der Harnorgane 209
12.19.1 Urolithiasis 209
12.19.2 Nephrokalzinosen 211
12.19.3 Akutes Nierenversagen 211
12.19.4 Chronisches Nierenversagen 213
12.19.5 Zystitis 215
12.19.6 Hydronephrose 215
12.19.7 Nierenzysten 217
12.19.8 Neoplasien des Harntrakts 218
12.20 Erkrankungen der Geschlechtsorgane 219
12.20.1 Prostataerkrankungen 219
12.20.2 Neoplasien des männlichen Genitaltrakts 221
12.20.3 Vaginitis 222
12.20.4 Pyometra 222
12.20.5 Mastitis 224
12.20.6 Trächtigkeitstoxikose 226
12.20.7 Dystokie 227
12.20.8 Neoplasien des weiblichen Geschlechtstrakts 228
12.21 Endokrinologische Erkrankungen 229
12.21.1 Insulinom 229
12.21.2 Hyperöstrogenismus der Fähe bei persistierender Ranz 232
12.21.3 Nebennierenerkrankung 234
12.21.4 Diabetes mellitus 237
12.22 Neurologische Erkrankungen 238
12.22.1 Allgemeininfektionen mit Beteiligung des ZNS 240
12.22.2 Stoffwechselerkrankungen mit neurologischen Symptomen 240
12.22.3 Vergiftungen mit neurologischen Symptomen 240
12.22.4 Neoplasien des ZNS 241
12.22.5 Diskopathie 241
12.23 Neoplasien 242
12.24 Angeborene Erkrankungen 245
12.24.1 An Felllänge und -farbe gekoppelte Gendefekte 245
12.24.2 Herzerkrankungen 245
12.24.3 Augenerkrankungen 245
12.24.4 Nierenerkrankungen 246
12.24.5 Brachyzephalie 246
12.25 Zoonosen 246
12.26 Vergiftungen 248
12.26.1 Allgemeine Maßnahmen 248
12.26.2 Vergiftung durch Reinigungs- oderWaschmittel 249
12.26.3 Nikotinvergiftung 249
12.26.4 Vergiftung mit Schokolade 250
12.26.5 Pflanzenvergiftungen 250
12.26.6 Insektizidvergiftungen 251
12.26.7 Rodentizidvergiftungen 251
12.26.8 Arzneimittelvergiftungen 252
Teil 3 Narkose und OP 254
13 Analgesie, Narkose und Sedation 255
13.1 Physiologische Besonderheiten 255
13.2 Indikationen für Narkose oder Sedation 255
13.3 Narkosevorbereitung 256
13.3.1 Nahrungskarenz 256
13.3.2 Untersuchung auf Narkosefähigkeit 256
13.3.3 Prämedikation 256
13.4 Lokalanästhesie 257
13.4.1 Lumbosakrale Epiduralanästhesie 257
13.5 Injektionsnarkose 258
13.5.1 Sedativa und Narkotika 258
13.5.2 Medikamentendosierung 259
13.6 Inhalationsnarkose 260
13.6.1 Inhalationsanästhetika 261
13.6.2 Intubation 261
13.7 Narkoseüberwachung 262
13.7.1 Reflexe und Muskeltonus 262
13.7.2 Kreislaufparameter 262
13.7.3 Atemparameter 262
13.7.4 Körpertemperatur 263
13.8 Narkosezwischenfälle 263
13.9. Narkosestadien 264
13.10 Aufwachphase 264
13.11 Postoperative Analgesie 265
14 OP-Techniken 266
14.1 OP-Vorbereitung 266
14.1.1 Präoperative Maßnahmen 266
14.1.2 Postoperative Maßnahmen 266
14.2 Operationen 267
14.2.1 Laparotomie 267
14.2.2 Kastration männlich 269
14.2.3 Ovariohysterektomie 270
14.2.4 Kaiserschnitt 271
14.2.5 Insulinom-Operation 271
14.2.6 Adrenalektomie 273
14.2.7 Prostatazysten/Prostataabszess 275
14.2.8 Gastrointestinale Fremdkörper 277
14.2.9 Zystotomie 279
14.2.10 Analbeutelexstirpation 279
14.2.11 Splenektomie 281
14.2.12 Zahnoperationen 281
15 Euthanasie 282
15.1 Allgemeines 282
15.2 Durchführung 282
15.2.1 Sedation/Narkose 282
15.2.2 Euthanasie 283
15.2.3 Feststellung des Todes 283
Teil 4 Anhang 284
16 Therapiegrundsätze 285
17 Medikamentenverzeichnis 287
18 Literaturverzeichnis 314
19 Abbildungsverzeichnis 320
Sachverzeichnis 321
3 Haltung
Anja Ewringmann
3.1 Haltungsformen
Frettchen sind sehr beliebte Heimtiere, allerdings sind die quirligen Tiere hinsichtlich ihrer Haltungsanforderungen recht anspruchsvoll.
Frettchen sollten, da sie äußerst soziale Tiere sind, nicht alleine gehalten werden. Sie benötigen zudem ein ausreichend großes Platzangebot sowie genügend Auslauf und abwechslungsreiche Beschäftigungsmöglichkeiten.
3.1.1 Innenhaltung
Der überwiegende Teil der Heimtierfrettchen wird in der Wohnung gehalten. Hierbei überwiegen die Haltung in Käfigen oder Volieren mit beaufsichtigtem Freilauf sowie die Haltung in eigens für die Tiere eingerichteten Zimmern. Vereinzelt dürfen sich Frettchen jedoch auch dauerhaft frei in der Wohnung bewegen.
Beim Freilauf in der Wohnung ist generell zu beachten, dass viele Gefahren lauern können. Da Frettchen extrem agile Tiere sind, die aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer schlanken Körperform in jeden Winkel gelangen können und zudem noch gut klettern können, ist es äußerst schwierig, eine Wohnung tatsächlich frettchensicher zu gestalten. Als Gefahrenquellen müssen z.B. Giftpflanzen oder Stromkabel ausgeschaltet werden, die von den Tieren angefressen werden können. Arznei-, Wasch- oder Reinigungsmittel müssen verschlossen werden und auch Herdplatten, Backöfen oder Waschmaschinen stellen potenzielle Gefahren dar. Zudem haben Frettchen eine extrem hohe Affinität zu Gummi. Gegenstände aus diesem Material (z.B. Ohrstöpsel, Unterlagen, die als Gleitschutz für Teppiche dienen) werden gerne angefressen und verschluckt, woraus nicht selten ein ▶ Fremdkörperileus resultiert.
3.1.1.1 Käfighaltung
Für die Käfighaltung von Frettchen sollte eine Grundfläche von 2 m2/Tier nicht unterschritten werden. Selbst wenn diese Anforderung erfüllt ist, muss den bewegungsaktiven Tieren dennoch ausreichend zusätzlicher Freilauf gewährt werden.
Im Zoofachhandel erhältliche Frettchenkäfige sind ungeeignet, da sie viel zu klein sind, sodass Frettchenhalter in den meisten Fällen Eigenbauten herstellen. Gut geeignet sind hierfür insbesondere ausgediente Kleiderschränke. Diese sind von 3 Seiten geschlossen; an der Vorderseite können mit Vierkantdraht vergitterte Türen angebracht werden. Alternativ können große Vogelvolieren als Frettchenkäfig umfunktioniert werden.
Ein Frettchenkäfig sollte mit mehreren Etagen ausgestattet sein, die über Rampen oder Röhren miteinander verbunden sind (▶ Abb. 3.1). Besonders bewährt haben sich Röhren, die außerhalb des Käfigs entlanglaufen, um die Ebenen miteinander zu verbinden. Auf diese Weise wird kein Platz für Verbindungslöcher zwischen den Etagen verschwendet und ein Herunterfallen von Einrichtungsgegenständen kann verhindert werden.
Abb. 3.1 Frettchenvoliere.
(Simone Fiebig-Succar und Kay Succar, Berlin)
Jede Ebene sollte eine Höhe von etwa 50 cm aufweisen, damit sich die Tiere aufrichten können. Der Etagenboden sowie die bodennahen Seitenwände sollten verfliest oder mit stabilem PVC-Boden ausgelegt sein, um eine gute Reinigung zu ermöglichen.
Für jedes Frettchen sollte mindestens eine Schlafmöglichkeit zur Verfügung stehen. Hierzu eignen sich beispielsweise Holzhäuser, stabile Pappkartons oder Hängematten, die mit zusätzlichen kleinen Decken oder Tüchern versehen werden, damit sich die Tiere einkuscheln können (▶ Abb. 3.2).
Abb. 3.2 Schlafplätze.
(Birgit Köbernik, Berlin)
Abb. 3.2a
Abb. 3.2b
Der Käfig muss zudem mit einer ausreichenden Anzahl an Toiletten versehen werden. Hier können Katzenklos mit Katzenstreu verwendet werden.
Futter- und ▶ Wassernäpfe müssen aus stabilem und gut zu reinigendem Material (z.B. Ton, Keramik) bestehen. Sie sollten, falls die oberen Ebenen durch Einstieglöcher zu erreichen sind, in der untersten Käfigetage platziert werden, damit sie nicht herunterfallen können. Gut geeignet sind zudem Metallnäpfe, die mit Halterungen an der Gittertür befestigt werden können (Papageienbedarf). Um Streitigkeiten bei der Fütterung zu verhindern, hat es sich bewährt, pro Tier einen Futternapf zur Verfügung zu stellen.
3.1.1.2 Haltung im Frettchenzimmer
Die Haltung von Frettchen in eigenen Zimmern bietet den Tieren ein Optimum an Bewegung. Ein Frettchenzimmer sollte mit einem gut zu reinigenden Bodenbelag ausgestattet sein. Es sollte zudem hell sein, sich aber insbesondere in den Sommermonaten nicht zu stark erwärmen, da Frettchen ▶ Hitze nicht gut tolerieren.
In dem Zimmer sollte ein ▶ Käfig als Rückzugsmöglichkeit zur Verfügung stehen. Dieser wird wie oben beschrieben ausgestattet. Das übrige Zimmer kann beliebig als „Spielwiese“ gestaltet werden. Zum Klettern eignen sich beispielsweise Kratzbäume für Katzen oder selbstgebaute Klettergerüste aus Holz. Als Versteckmöglichkeiten dienen Röhren (z.B. flexible Drainageröhren aus dem Baumarkt, Durchmesser mindestens 20 cm), Holzhäuser oder Pappkartons.
3.1.2 Außenhaltung
Eine ganzjährige Haltung von Frettchen im Freien ist möglich. Voraussetzung ist jedoch, dass die Tiere mindestens zu zweit gehalten werden und sich in einem guten Gesundheitszustand befinden. Zudem sollten die Frettchen bereits im späten Frühjahr in ein Außengehege einziehen, damit sie sich an die klimatischen Bedingungen gewöhnen können.
Ein Außengehege muss eine ausreichend große Grundfläche besitzen, wobei pro Tier 3 m2 veranschlagt werden. Das Gehege/die Voliere sollte sich an einem Standort befinden, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Zumindest ein Teil des Geheges sollte überdacht sein, um ihn vor Regen und Schnee zu schützen. In diesem trockenen Bereich kann dann eine kombinierte Schlaf- und Futterhütte aufgestellt werden. Zu beachten ist weiterhin, dass das Gehege so gesichert sein muss, dass die Frettchen weder ausbrechen, noch andere Tiere hineingelangen können. Da Frettchen gerne buddeln, muss daher auch der Untergrund abgesichert werden.
Als Schutzhütte können doppelwandige Holzhäuser dienen, zwischen deren Holzschichten Styropor als Isolationsmaterial eingefügt wurde. Hierbei ist wichtig, dass das Isoliermaterial vollständig abgedeckt ist, damit es von den Frettchen nicht angefressen und verschluckt werden kann. Als „Nistmaterial“ für das Schlafhaus eignen sich v.a. Tücher und kleine Decken. Heu und Stroh neigen sehr leicht zur Schimmelbildung, wenn sie feucht werden.
Die Ausstattung eines Außengeheges kann prinzipiell so gestaltet werden wie die eines ▶ Frettchenzimmers, wobei als Klettermöglichkeiten auch große Wurzeln, dicke Äste oder Baumstämme verwendet werden können.
3.1.3 Gesellschaft und Vergesellschaftung
Merke
Frettchen sind, im Gegensatz zu ihrem Vorfahren, dem Europäischen Iltis, keine Einzelgänger, sondern sehr soziale und gesellige Tiere. Sie sollten daher nicht einzeln, sondern mindestens paarweise oder auch in Gruppen gehalten werden.
Zwar können der Mensch oder auch andere Haustiere – Frettchen sind oft gut an Hunde oder Katzen zu gewöhnen – als Spielpartner dienen, sie können jedoch auf Dauer keine Artgenossen mit frettcheneigenem Sozialverhalten ersetzen.
Bei der Neuanschaffung von Frettchen empfiehlt es sich, direkt mindestens 2 Tiere aufzunehmen. Am einfachsten ist hier die Anschaffung von Welpen, die dann in der Regel problemlos miteinander aufwachsen. Ist bereits ein einzelnes Frettchen vorhanden, das einen neuen Partner bekommen soll oder werden 2 halbwüchsige oder ausgewachsene Tiere aufgenommen, so muss eine beaufsichtigte Vergesellschaftung durchgeführt werden.
Für die Vergesellschaftung von Frettchen gibt es keine allgemeingültigen Regeln, die auf alle Tiere anwendbar sind. Der Verlauf und der Erfolg einer Vergesellschaftung sind individuell sehr unterschiedlich und hängen von den bisherigen Erfahrungen, dem Verhalten und dem Charakter der beteiligten Tiere ab. Prinzipiell gilt jedoch, dass eine Vergesellschaftung von Welpen und Jungtieren bis zu etwa 1 Jahr sowie von gut sozialisierten älteren Frettchen meist deutlich unkomplizierter ist als von älteren Frettchen, die bereits lange Zeit keinen Kontakt mehr zu Artgenossen hatten.
Eine Vergesellschaftung sollte immer möglichst auf neutralem Boden erfolgen, sodass keines der Tiere das Bedürfnis hat, sein Revier verteidigen zu...
| Erscheint lt. Verlag | 22.10.2014 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Heimtier und Patient |
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Medizin / Pharmazie |
| Veterinärmedizin | |
| Schlagworte | Anatomie • Diagnostik • Ernährung • Frettchen • Haltung • Krankheit • Medizin • Narkose • Operationen • Tiermedizin • Veterinärmedizin • Zucht |
| ISBN-10 | 3-8304-1248-7 / 3830412487 |
| ISBN-13 | 978-3-8304-1248-9 / 9783830412489 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 5,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
Größe: 9,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich