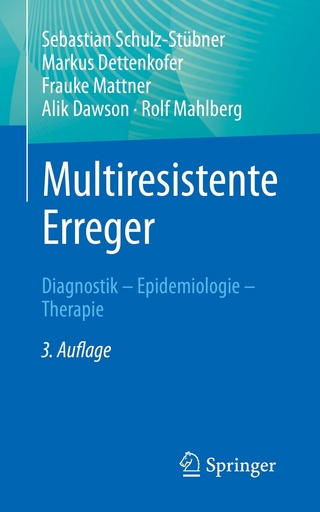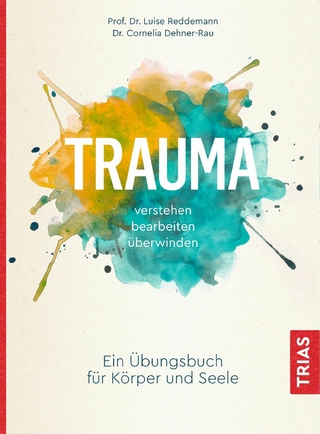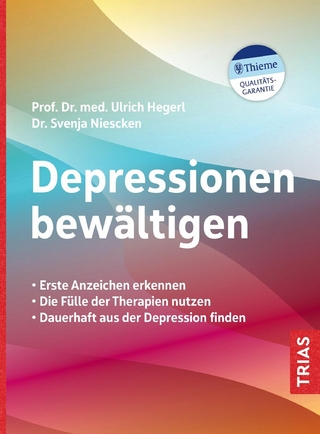Konfettiregen im Kopf - Leben mit Borderline (eBook)
172 Seiten
Trias (Verlag)
978-3-432-11262-6 (ISBN)
Jennifer Wrona, in Süddeutschland geboren, lebt in Bremerhaven und studiert Digitale Medienproduktion. Schon früh in ihrer Jugend merkte sie, dass etwas nicht stimmte. Viele Diagnosen, Therapeut*innengespräche und Klinikaufenthalte später kann sie selbst alles besser einordnen und spricht seit 2017 über das Thema "Mental Health", um Tabus zu brechen und der Stigmatisierung Betroffener entgegenzuwirken. Durch eine Reportage mit dem Bayrischen Rundfunk (auch auf YouTube) das erste Mal auch in den Medien. Seitdem gibt sie Interviews und hält Vorträge rund um das Thema Psyche. Inzwischen ist sie zu einem Gesicht für Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen geworden. Mit viel Feingefühl, Empathie und Herz für die Sache schreibt sie eine Kolumne für die Stuttgarter Zeitung (Stadtkind) unter dem Motto #letstalkaboutmentalhealth. Mit viel Leichtigkeit, Ehrlichkeit und wissenschaftlichen Fakten bringt sie sperrige 'Mental Health-Themen" nicht nur in der Kolumne, sondern auch auf Instagram an die Leser*innen.
Jennifer Wrona, in Süddeutschland geboren, lebt in Bremerhaven und studiert Digitale Medienproduktion. Schon früh in ihrer Jugend merkte sie, dass etwas nicht stimmte. Viele Diagnosen, Therapeut*innengespräche und Klinikaufenthalte später kann sie selbst alles besser einordnen und spricht seit 2017 über das Thema "Mental Health", um Tabus zu brechen und der Stigmatisierung Betroffener entgegenzuwirken. Durch eine Reportage mit dem Bayrischen Rundfunk (auch auf YouTube) das erste Mal auch in den Medien. Seitdem gibt sie Interviews und hält Vorträge rund um das Thema Psyche. Inzwischen ist sie zu einem Gesicht für Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen geworden. Mit viel Feingefühl, Empathie und Herz für die Sache schreibt sie eine Kolumne für die Stuttgarter Zeitung (Stadtkind) unter dem Motto #letstalkaboutmentalhealth. Mit viel Leichtigkeit, Ehrlichkeit und wissenschaftlichen Fakten bringt sie sperrige „Mental Health-Themen" nicht nur in der Kolumne, sondern auch auf Instagram an die Leser*innen.
Psychisch gesund und krank
Das etwas irgendwie nicht ganz stimmte, merkte ich das erste Mal mit 13 Jahren. Ich war tief unglücklich, konnte das aber nicht in Worte fassen. Mit 14 Jahren erlebte ich das erste Mal eine schmerzhafte räumliche Trennung von Menschen, die mir nahestanden. Und das brachte den Stein ins Rollen. Welchen Stein, wusste ich zwar noch nicht, aber irgendein Stein war es. Ich war todunglücklich. Ich konnte nur noch weinen und im Großen und Ganzen reagierte ich viel heftiger auf diesen Abschied als die anderen in meinem Alter. Bis dahin, und auch danach hatte mir niemand erklärt, was es bedeutet, eine überwältigende Traurigkeit zu empfinden. Ich war konfrontiert mit meinen eigenen Emotionen, die heftig waren, und ich fand keinen Anhaltspunkt dafür, sie einzuordnen.
Die Begrifflichkeit »psychisch krank« war für mich eine Bezeichnung, die nur anderen Menschen vorbehalten war. Von Depressionen hatte ich nur am Rande gehört und als wir in der Schule über Essstörungen sprachen, verstand ich nicht, wieso Menschen einfach aufhörten zu essen (über andere Essstörungen sprachen wir erst gar nicht), und überhaupt erklärte mir niemand, dass Betroffene nicht nur »einfach aufhören zu essen«. In meiner Schulzeit gab es keine aufklärenden Gespräche darüber, dass die Psyche, eben wie der Körper, auch schwer erkranken kann. Die Komplexität der Psyche war kein Thema des Lehrplans.
75 % der psychischen Erkrankungen brechen vor dem 25. Lebensjahr aus ▶ [5]. Das bedeutet, dass viele Betroffene schon in ihrer Schulzeit unter psychischen Belastungen leiden. Das bedeutet aber auch, dass wir gerade in dieser Zeit viel mehr darüber sprechen müssen. Prävention ist immer besser als Nachsorge. Kinder sollten dabei unterstützt werden, ihre Gefühle zu spüren und zu verbalisieren. Es ermöglicht eine frühere Intervention und kann einen schweren Verlauf einer psychischen Erkrankung verhindern.
Was bedeutet »psychisch krank?«
Die Psyche ist komplex und so ganz verstehen wir sie noch nicht. Wir sprechen von mentaler Gesundheit, aber niemand kann das präzise definieren. Wir sollen Sport treiben, uns gesund ernähren, Freunde treffen, einen erfüllenden Beruf ausüben, Familie planen, Ziele im Leben haben, ein Hobby, das uns Spaß macht. Das sind verdammt viele Ansprüche an Menschen, die von unterschiedlichsten Schicksalen getroffen werden können, keine finanzielle Sicherheit haben oder physisch erkranken. Wie schaffen wir es also, eine Gesellschaft zu gestalten, die jeden Menschen in seiner Individualität aufnehmen kann? Wie fördern wir verschiedene Persönlichkeiten und bieten Sicherheit in den Möglichkeiten des Lebens? Es steht außer Frage, dass unsere Situation in diesem Land, in dem wir leben, wahnsinnig privilegiert ist. Wir haben ein solidarisches Gesundheitssystem und demokratische Rechte. Gleichzeitig zeigen uns aber die Zahlen, dass Depressionen und andere psychische Erkrankungen ein wachsendes Problem sind. Ob wir krank werden oder nicht, hängt von vielen Faktoren ab. Es gibt Umwelteinflüsse, biologische, familiäre und soziale Faktoren, die nicht nur unsere Persönlichkeit formen, sondern eben auch beeinflussen, wie anfällig wir für psychische Erkrankungen sind. Unsere Kindheit, die Erziehung, die Bezugspersonen und äußerliche Faktoren (finanzielle Sicherheit, Traumata, schulische Laufbahn) prägen unsere Persönlichkeit und unser Leben.
Das Menschsein ist eine wilde Kombination von Gefühlen, Denkprozessen, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Diese verschiedenen Bereiche können erkranken, allerdings ist nicht jede Abweichung gleich eine Erkrankung. Denn Traurigkeit ist nicht gleich eine Depression und Stimmungsschwankungen sind menschliche und natürliche Erfahrungen. Da das persönliche Empfinden eine große Rolle spielt, gibt es keine klaren Eingrenzungen, sondern Anhaltspunkte und empirische Kriterien. Zwei Klassifikationssysteme spielen dabei die bedeutendste Rolle bei der Einordnung psychischer Störungen:
Die Internationale Klassifikation psychischer Störungen ist Teil der ICD-10 (»International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems« oder im Deutschen »Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme« genannt) der WHO (Weltgesundheitsorganisation) und ist ein weltweit anerkanntes Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen. Das DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) findet vor allem in der Forschung und in den USA Verwendung. Beide Kataloge sind keine endgültig festgelegten Einordnungen, sondern werden als vorläufig verstanden und sind kompatibel. So wurden früher psychische Erkrankungen in neurotische und psychotische Störungen unterteilt. Das ist heute nicht mehr üblich. Seit der sechsten Ausgabe im Jahr 1949 wird die ICD von der WHO herausgegeben. Das erste Mal waren dort psychische Störungen aufgelistet. Die Bundesrepublik Deutschland setzte 1986 das erste Mal die ICD-9 verpflichtend in Krankenhäusern ein. Die ICD-10 wurde 1983–1992erarbeitet und ist heute in der Version von 2020 der verbindliche Standard in Deutschland.
In der ICD-10 befinden sich psychische Störungen in Kapitel V. Die Diagnosen werden mit einem F deklariert und die Folgeziffern lassen genauere Angaben zur Erkrankung zu. Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung findet sich unter den sogenannten »Spezifischen Persönlichkeitsstörungen« (F60). Dort wird die emotional instabile Persönlichkeitsstörung in zwei Typen eingeteilt: Der impulsive Typ wird mit dem Diagnoseschlüssel F60.30 gekennzeichnet, der Borderline-Typ mit dem Diagnoseschlüssel F60.31. Das DSM unterscheidet diese Typen nicht.
Wir definieren eine psychische Störung durch krankheitswertige Veränderungen der Wahrnehmung und des Verhaltens. Das geht immer auch mit einem hohen Leidensdruck bei den Betroffenen einher. Es kann zu Problemen in vielen Lebensbereichen führen. Außerdem können das Denken, die Selbstwahrnehmung und das Fühlen beeinträchtigt sein. Zwar kann es biologische Gründe für eine auftretende Depression geben (Schilddrüse, Vitaminmangel), allerdings wird und sollte dies in einer umfassenden Behandlung einer Ärzt*in ausgeschlossen und/oder behandelt werden. In der Medizin wird davon ausgegangen, dass der Körper und die Psyche nicht wesentlich voneinander unabhängig sind, sondern sich gegenseitig beeinflussen (auch Psychosomatik genannt).
Abstrakte Erklärungen erschweren es, nachzuvollziehen, was eine Veränderung der Wahrnehmung eigentlich bedeutet. Wir nehmen uns als selbstbestimmte Menschen wahr, die eigentlich die volle Kontrolle über ihr Verhalten haben (müssen). Abweichungen von der gesellschaftlichen Norm sind beängstigend und aufgrund der fehlenden Häufigkeit nicht in unserem kollektiven Bewusstsein. Aggressivität ist einschüchternd, ein antisoziales Verhalten seltsam und plötzlicher Rückzug aus dem sozialen Umfeld überraschend. Oft verstehen wir nicht die Zusammenhänge, die zwischen dem Verhalten und der psychischen Erkrankung existieren. Außerdem neigen wir dazu, das Verhalten anderer auf uns selbst zu übertragen. Wir suchen den Auslöser für das Verhalten des Gegenübers bei uns selbst und nehmen uns dabei in der Interaktion oft wichtiger, als wir es eigentlich sind. Das bedeutet, dass wir die Verhaltensweisen unseres Gegenübers als klare Reaktion auf unser Verhalten wahrnehmen, obwohl das Verhalten mehr mit den Personen selbst zu tun hat. Genauso ist unser eigenes Verhalten hauptsächlich eine Reaktion aus uns selbst als eine Reaktion auf unser Gegenüber.
Psychische Erkrankungen werden meist im Zusammenhang mit popkulturellen Filmen, Straftaten oder Suiziden von bekannten Persönlichkeiten in unseren Fokus gesetzt. Der Pressekodex rät Journalist*innen zu einer umsichtigen Berichterstattung in Bezug auf Suizid ▶ [6]. In der Medienforschung wird vom Werther-Effekt (nach Goethes »Die Leiden des jungen Werther«) gesprochen. Dieser bezeichnet die Annahme, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen ausführlicher medialer Berichterstattung über Suizid und einem erhöhten Anstieg der Zahl der Suizide in der Bevölkerung besteht ▶ [7]. Gar nicht über Suizid zu berichten ist keine Lösung. Medien spielen eine wichtige Rolle für das öffentliche Bewusstsein. Deswegen hilft es, wenn über Suizid nicht als katastrophales Ende einer ausweglosen Krise berichtet wird, sondern als endliche Phase tiefer Verzweiflung, die mit Hilfsangeboten aufgefangen werden kann. Wie drastisch die Suizidproblematik in Deutschland ist, wird klar, wenn wir einen Blick auf die Zahlen werfen. Jährlich nehmen sich rund 10.000 Menschen das Leben ▶ [8]. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder Mensch (mindestens) 10 engere Kontakte in seinem Umfeld hat, sind das 100.000 Menschen jährlich, die direkt oder indirekt von Suizid betroffen sind. Es sterben mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle, Mord, HIV und (illegale) Drogen zusammen. Auf Autobahnen sehen wir Plakate, die vor zu hoher Geschwindigkeit warnen, aber wir sehen keine Plakate, die darüber aufklären, dass Depressionen tödlich enden können. Die häufigste Ursache für Suizid sind Depressionen.
Die Bezeichnung »mutmaßlicher Täter soll psychisch krank sein« malt ein Bild von Extremen. Die Berichterstattungen sind häufig undifferenziert, denn sie setzen eine psychische Erkrankung mit einer Straftat gleich. Es muss klar unterschieden werden, dass die allermeisten psychisch Erkrankten keine Straftäter*innen sind und werden. Nur 5 % der gewalttätigen...
| Erscheint lt. Verlag | 10.2.2021 |
|---|---|
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie ► Krankheiten / Heilverfahren |
| Schlagworte | Borderline • Borderline-Erkrankung • Borderline-Patientin • Burn-out • Burnout • Depression • Psyche • Psychisch • Psychische Erkrankung • Psychisch krank • Psychotherapeut • Psychotherapie |
| ISBN-10 | 3-432-11262-9 / 3432112629 |
| ISBN-13 | 978-3-432-11262-6 / 9783432112626 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich