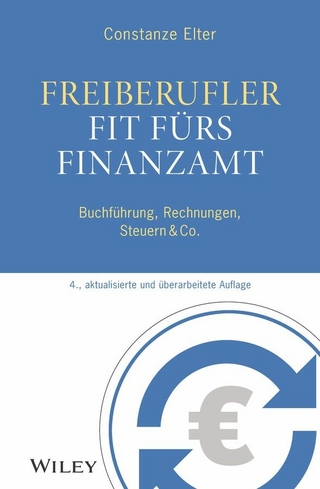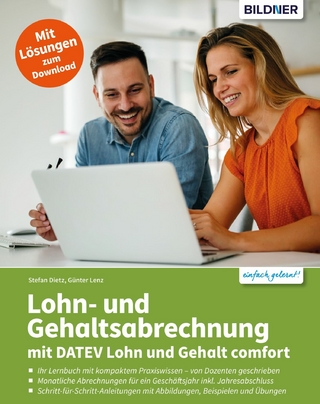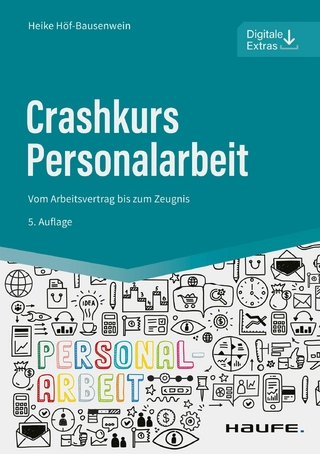Praktiker-Handbuch Due Diligence (eBook)
252 Seiten
Schäffer-Poeschel Verlag
978-3-7992-6644-4 (ISBN)
Prof. Dr. Wolfgang Koch ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt; spezialisiert auf Unternehmensanalysen und Bewertungen; Geschäftsführer der Dr. Koch Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH; lange Jahre Vorstand der KWU Gesellschaft für Unternehmensbewertung AG; Honorarprofessur an der Rechts- und Staatswirtschaftlichen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, lehrt auf dem Gebiet der Unternehmensbewertung; Autor zahlreicher Fachbücher und Fachaufsätze.
Wolfgang Koch Prof. Dr. Wolfgang Koch ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt; spezialisiert auf Unternehmensanalysen und Bewertungen; Geschäftsführer der Dr. Koch Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH; lange Jahre Vorstand der KWU Gesellschaft für Unternehmensbewertung AG; Honorarprofessur an der Rechts- und Staatswirtschaftlichen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, lehrt auf dem Gebiet der Unternehmensbewertung; Autor zahlreicher Fachbücher und Fachaufsätze.
Vorwort zur 3. Auflage 8
Inhalt Download-Bereich 10
Inhaltsübersicht 12
Inhaltsverzeichnis 14
1 Einleitung 22
1.1 Der Begriff der Due Diligence 22
1.2 Philosophie der Due Diligence 23
1.3 Vorteile einer Due Diligence 27
1.4 Fazit 28
2 Anwendungsmöglichkeiten der Due Diligence 30
2.1 Führungsorientierte Due Diligence 30
2.1.1 Philosophie 30
2.1.2 Inhalt des Weißbuches 31
2.1.2.1 Basisinformationen zur Gesellschaft 31
2.1.2.2 Marktanalyse 32
2.1.2.3 Betonung der Stärken und Chancen 32
2.1.2.4 Ausführungen zu Schwächen und Risiken 32
2.1.2.5 Ausführungen zu sensiblen Sachverhalten 33
2.1.2.6 Plausibilität der Strategie und der Planung 33
2.1.2.6.1 Darstellung der Entwicklung in der Vergangenheit 33
2.1.2.6.2 Darstellung von Strategie und Planung 34
2.1.2.7 Darstellung der Soft Facts im Unternehmen 35
2.1.2.8 Darstellung der stillen Reserven und des nicht betriebsnotwendigen Vermögens 35
2.1.3 Funktionen des Weißbuches 36
2.1.3.1 Dokumentation 36
2.1.3.2 Check-up 37
2.1.3.3 Verbesserungspotenzial 37
2.1.3.4 Strategie und Planung 37
2.1.3.5 Kommunikation mit den Stakeholdern 38
2.1.3.6 Argumentation 39
2.1.4 Vergleich mit anderen Formen der Berichterstattung 40
2.1.5 Fazit 41
2.2 Argumentationsorientierte Due Diligence 41
2.2.1 Due Diligence und Bewertung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 42
2.2.1.1 Ausscheiden eines Gesellschafters 42
2.2.1.2 Abfindungen gemäß §§ 304, 305 AktG 43
2.2.1.3 Verschmelzungen, Vermögensübertragungen oder Umwandlungen 44
2.2.1.4 Steuerliche Erhebungen 44
2.2.1.5 Zugewinnausgleich im Scheidungsverfahren 45
2.2.1.6 Enteignungen 45
2.2.1.7 Private Purchase Allocation nach IFRS 46
2.2.2 Due Diligence und Bewertung aufgrund wirtschaftlicher Ansätze 46
2.2.2.1 Kauf/Verkauf eines Unternehmens oder von Unternehmensteilen 46
2.2.2.2 Börseneinführung 47
2.2.2.3 Eigenkapitalaufnahme bei Dritten 48
2.2.2.4 Fremdkapitalaufnahme bei Banken 48
2.2.2.5 Management-Buy-out 49
2.2.2.6 Sanierungen 49
2.2.2.7 Umstrukturierungen/Spaltungen 50
2.2.2.8 Gesellschaftsrechtliche Schiedsverträge 50
2.2.2.9 Privatisierungen der öffentlichen Hand 50
2.2.2.10 Erbauseinandersetzungen 50
2.2.3 Fazit 51
3 Verfahren der Due Diligence 54
3.1 Vorbereitung der Due Diligence 54
3.1.1 Eingrenzung der Analyseschwerpunkte 55
3.1.2 Zusammenstellung der Basisunterlagen 56
3.1.3 Auswahl und Beauftragung des Gutachters 61
3.1.4 Kosten einer Due Diligence 63
3.1.5 Zusammenstellung des Due Diligence-Teams 64
3.1.6 Fazit 66
3.2 Durchführung der Due Diligence 67
3.2.1 Vertraulichkeitserklärung 67
3.2.2 Grundsätze einer Due Diligence 67
3.2.3 Ablauf der Due Diligence 73
3.2.4 Dokumentation und Berichterstattung 75
3.2.5 Fazit 78
3.3 Sonderformen der Due Diligence 79
3.3.1 Schwerpunkt-Due Diligence 80
3.3.2 Kurz-Due Diligence 80
3.3.3 Branchen-Due Diligence 82
3.3.4 Fazit 82
4 Themenbereiche der Due Diligence 84
4.1 Markt und Wettbewerb (Market Due Diligence) 85
4.1.1 Analyse der globalen Umwelt 86
4.1.2 Analyse des rechtlichen Markt- und Wettbewerbsumfeldes 87
4.1.3 Marktanalyse 88
4.1.4 Wettbewerbsanalyse 89
4.1.5 Fazit 94
4.2 Technik und Produktion (Technical Due Diligence) 95
4.2.1 Produktionskapazität 96
4.2.2 Produktionsablauf und Qualitätskontrolle 96
4.2.3 Lagerkapazitäten 97
4.2.4 Standortvor- und -nachteile 97
4.2.5 Ausbildungsstand des Personals 98
4.2.6 Forschung und Entwicklung 98
4.2.7 Einbindung externer Gutachter 98
4.2.8 Fazit 99
4.3 Umwelt (Environmental Due Diligence) 100
4.3.1 Bedeutung der Umwelt-Due Diligence 100
4.3.2 Grundlagen der Umwelt-Due Diligence 101
4.3.3 Ablauf der Umwelt-Due Diligence 102
4.3.4 Fazit 103
4.4 Organisation (Organisational Due Diligence) 104
4.4.1 Organisation und Entscheidungsverfahren 104
4.4.2 Rechnungswesen und Controlling 105
4.4.3 Verwaltung 107
4.4.4 Einkauf 108
4.4.5 Vertrieb 109
4.4.6 Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen 110
4.4.7 Das Risikomanagementsystem 111
4.4.8 Das Compliance-System 112
4.4.9 Fazit 114
4.5 Recht und Steuern (Legal and Tax Due Diligence) 115
4.5.1 Gesellschaftsrechtliche Aspekte 115
4.5.2 Vermögensrechtliche Aspekte 116
4.5.3 Externe Verträge 117
4.5.4 Arbeitsrechtliche Aspekte 119
4.5.5 Eventualrisiken 119
4.5.6 Prozessuale Risiken 120
4.5.7 Steuerrechtliche Risiken 121
4.5.7.1 Körperschaftsteuerrechtliche Risiken 121
4.5.7.1.1 Verdeckte Gewinnausschüttungen 121
4.5.7.1.2 Verrechnungspreise innerhalb eines Konzerns 122
4.5.7.1.3 Steuernachzahlungen aus der Bilanzierung oder dem Ansatz von Aufwendungen 122
4.5.7.1.4 Risiken aus der Nichtabzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen 122
4.5.7.1.5 Nutzbarkeit eines Verlustvortrages 122
4.5.7.2 Gewerbesteuerrechtliche Risiken 123
4.5.7.3 Umsatzsteuerrechtliche Risiken 123
4.5.7.4 Lohnsteuerrechtliche Risiken und andere Abzugssteuern 123
4.5.7.5 Rückzahlungsrisiken aus Subventionen 123
4.5.8 Fazit 123
4.6 Psychologie und Kultur (Psychological Due Diligence) 125
4.6.1 Zentrale Bedeutung einer psychologischen Due Diligence 125
4.6.2 Analyse der Human Resources 126
4.6.2.1 Leitende Personen 126
4.6.2.2 Mitarbeiter 128
4.6.3 Kulturelle Due Diligence 129
4.6.3.1 Führung und Motivation 129
4.6.3.2 Interne Kommunikation 131
4.6.3.3 Beziehungen zu Kunden und Lieferanten 131
4.6.3.4 Beziehungen zu Kreditgebern 132
4.6.3.5 Auftreten in der Öffentlichkeit 133
4.6.4 Analysemöglichkeiten 133
4.6.4.1 Interviews 134
4.6.4.2 Betriebsbegehung 134
4.6.4.3 Außenbild des Unternehmens 135
4.6.5 Fazit 136
4.7 Plausibilität der Planung (Financial Due Diligence) 137
4.7.1 Entwicklung der Gesellschaft in der Vergangenheit 137
4.7.1.1 Auswertung der Jahresabschlüsse 137
4.7.1.2 Bereinigung der Vergangenheitsergebnisse 138
4.7.2 Planungsanalyse 140
4.7.2.1 Planungsunterlagen 140
4.7.2.2 Darstellung des Planungsverfahrens 141
4.7.2.3 Ermittlung der Ertragserwartungen anhand der Planungsrechnung 142
4.7.2.4 Analyse der Cashflow- und Liquiditätsplanung 150
4.7.3 Segmentanalyse 150
4.7.4 Analyse des nicht betriebsnotwendigen Vermögens 152
4.7.5 Erhebungen zum Substanzwert 152
4.7.6 Ergebnisse der finanziellen Due Diligence 156
4.7.7 Fazit 157
5 Sonderfälle der Due Diligence 160
5.1 Synergien 160
5.1.1 Positive Synergien 160
5.1.2 Negative Synergien 161
5.1.3 Fazit 162
5.2 Start-ups 163
5.2.1 Unternehmenskonzept 164
5.2.2 Eigenschaften des Gründers 164
5.2.2.1 Fachwissen 164
5.2.2.2 Persönliche Eigenschaften 165
5.2.3 Liquiditätsplanung 165
5.2.4 Rechtliche Besonderheiten 165
5.2.5 Fazit 166
5.3 Betriebsteile und Konzernunternehmen 166
5.3.1 Die Ausgangslage bei Betriebsteilen und Konzernunternehmen 166
5.3.2 Vor- und Nachteile bei Betriebsteilen und Konzernunternehmen 167
5.3.3 Fazit 168
5.4 Kleine und mittelständische Unternehmen 169
5.4.1 Stärken der KMU 170
5.4.2 Schwächen der KMU 170
5.4.3 Bereitschaft der KMU zu einer Due Diligence 171
5.4.4 Besondere Bedeutung der führungsorientierten Due Diligence für KMU 172
5.4.5 Fazit 172
5.5 Börseneinführung 173
5.5.1 Equity Story als Nachweis der Börsenreife 173
5.5.2 Verwendung des Emissionserlöses 174
5.5.3 Due Diligence und Börsenprospekt 174
5.6 Management-Buy-out 175
5.6.1 Das Problem der ungleichen Information 175
5.6.2 Fokussierung auf die Ausschüttungsfähigkeit des Unternehmens 175
5.6.3 Fazit 176
5.7 Sanierungsunternehmen 177
5.7.1 Die Ausgangslage bei Sanierungen 177
5.7.2 Der Ablauf einer Due Diligence als Sanierungsprüfung 179
5.7.2.1 Die Sanierungsbedürftigkeitsprüfung 180
5.7.2.2 Die Sanierungsfähigkeitsprüfung 181
5.7.2.3 Die Sanierungswürdigkeitsprüfung 183
5.7.3 Die Ermittlung sanierungsspezifischer Unternehmenswerte 184
5.7.4 Fazit 187
6 Umsetzung der Ergebnisse der Due Diligence 188
6.1 Bei der führungsorientierten Due Diligence 188
6.1.1 Verbesserung des Unternehmens 188
6.1.2 Eingehen auf die Stakeholder 188
6.1.3 Folge-Due Diligence und Aktualisierung des Weißbuches 190
6.1.3.1 Die Philosophie und die Vorteile der Folge-Due Diligence 190
6.1.3.2 Das Verfahren der Folge-Due Diligence 191
6.1.3.2.1 Zeitraum und Stichtag 191
6.1.3.2.2 Erforderliche Unterlagen 191
6.1.3.3 Die Prüfungsschwerpunkte 192
6.1.3.3.1 Die Vergangenheit 192
6.1.3.3.2 Die Zukunft 193
6.1.3.3.3 Die Risiken 193
6.1.4 Fazit 194
6.2 Bei Kauf/Verkauf eines Unternehmens 195
6.2.1 Änderung des Erwerbskonzepts 195
6.2.2 Unternehmensbewertung 196
6.2.3 Berücksichtigung im Kaufvertrag 196
6.2.3.1 Abhängigkeit der Gewährleistungsregelungen vom Umfang der Due Diligence 197
6.2.3.2 Bilanzgarantie und Ergebnisgarantie 197
6.2.3.3 Vereinbarungen von Besserungsscheinregelungen 198
6.2.3.4 Vereinbarungen einer Mitarbeit des bisherigen Gesellschafters/Geschäftsführers 199
6.2.4 Fazit 199
7 Anmerkungen zur Unternehmensbewertung 202
7.1 Grundlagen der Unternehmensbewertung 202
7.2 Gängige Unternehmensbewertungsverfahren 204
7.2.1 Ertragswertverfahren 205
7.2.2 Discounted-Cashflow-Verfahren 208
7.2.3 Vergleichsverfahren 211
7.2.4 Sonstige Verfahren 216
7.2.4.1 Substanzwertverfahren 216
7.2.4.2 Weitere Verfahren 218
7.2.5 Fazit 218
7.3 Unlösbarkeit des Unsicherheitsproblems 219
7.3.1 Allgemeine Möglichkeiten einer Verminderung der Unsicherheit 220
7.3.2 Verwendung von ß-Faktoren als scheinbare Verminderung der Unsicherheit 220
7.3.3 Berücksichtigung der Risiken im nachhaltigen Ergebnis 222
7.3.4 Fazit 223
7.4 Das nachhaltige Ergebnis als wesentliche Bewertungsgrundlage 224
7.4.1 Mögliche Ansätze für die Ermittlung des nachhaltigen Ergebnisses 224
7.4.2 Ermittlung eines nachhaltigen Ergebnisses aus der ganzheitlichen Sicht des Unternehmens 225
7.4.3 Umsetzung der ganzheitlichen Bewertung in ein Scoring-Modell 226
7.4.4 Zwei Exkurse: Eigenschaften der Hidden Champions und die Einhaltung unternehmerischer Tugenden 227
7.4.5 Fazit 229
8 Zusammenfassung und Ausblick 232
Anhang I: Standardisierte Zusammenstellung der Unterlagen und Informationen für eine Financial Due Diligence 234
Anhang II: Standardisierte Zusammenstellung der Unterlagen und Informationen für eine Legal and Tax Due Diligence 238
Anhang III: Standardisierte Zusammenstellung der Unterlagen und Informationen für eine Psychological Due Diligence 244
Der Autor 248
Stichwortverzeichnis 250
Verschaffen Sie sich mit der Leseprobe einen Überblick über das Angebot.
| Erscheint lt. Verlag | 14.11.2011 |
|---|---|
| Verlagsort | Freiburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
| Schlagworte | Bewertungsverfahren • Diligence • Due Diligence • Ertragswertverfahren • ganzheitliche Analyse • kleine und mittelständische Unternehmen • KMU • Mittelständische Unternehmen • Tax Due Diligence • Unternehmensbewertung • Unternehmensbewertungsverfahren • Unternehmenswert • Wolfgang Koch |
| ISBN-10 | 3-7992-6644-5 / 3799266445 |
| ISBN-13 | 978-3-7992-6644-4 / 9783799266444 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich