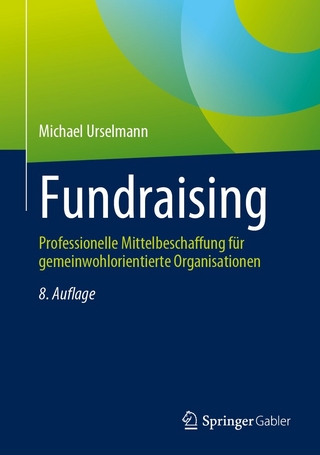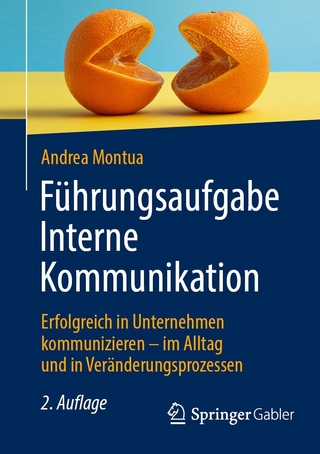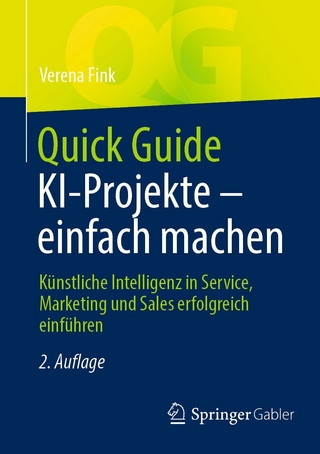Integrierte Unternehmens- und Markenkommunikation (eBook)
777 Seiten
Schäffer-Poeschel Verlag
978-3-7992-6872-1 (ISBN)
Prof. Dr. Manfred Bruhn ist Lehrstuhlinhaber für Marketing und Unternehmensführung an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel sowie Honorarprofessor an der TU München. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören u.a. Strategische Unternehmensführung, Markenpolitik, Integrierte Kommunikation, Dienstleistungsmarketing, Non-Profit- Marketing und Customer-Relationship-Marketing. Seine wissenschaftliche Leitlinie ist die bewusste Ausrichtung am management- und entscheidungsorientierten Ansatz des Marketings.
Manfred Bruhn Prof. Dr. Manfred Bruhn ist Lehrstuhlinhaber für Marketing und Unternehmensführung an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel sowie Honorarprofessor an der TU München. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören u.a. Strategische Unternehmensführung, Markenpolitik, Integrierte Kommunikation, Dienstleistungsmarketing, Non-Profit- Marketing und Customer-Relationship-Marketing. Seine wissenschaftliche Leitlinie ist die bewusste Ausrichtung am management- und entscheidungsorientierten Ansatz des Marketings.
Vorwort zur sechsten Auflage 6
Zur Konzeption des Buches 10
Konzeption und Aufbau des Buches 13
Inhalt 14
Schaubildverzeichnis 23
Insertverzeichnis 32
1. Bedeutung und Notwendigkeit der Integrierten Kommunikation 34
1.1 Integrierte Kommunikation als Heraus-forderung der Kommunikationsarbeit 34
1.1.1 Entwicklungstendenzen der Kommunikations-und Medienmärkte 34
1.1.1.1 Entwicklungsphasen der Kommunikation 35
1.1.1.2 Quantitative Veränderungen der Kommunikations-und Medienmärkte 39
1.1.1.3 Qualitative Veränderungen der Kommunikations-und Medienmärkte 45
1.1.1.4 Herausforderungen und Chancen für die Integrierte Kommunikation 53
1.1.2 Notwendigkeit einer Integrierten Kommunikation 59
1.1.2.1 Vielfalt der Kommunikationsprozesse als Ausgangspunktder Integration 59
1.1.2.2 Kommunikationsdefizite und Integrationsbedarf 62
1.2 Empirisch-konzeptionelle Grundlagen der Integrierten Kommunikation 68
1.2.1 Einführung in das Konzept der Integrierten Kommunikation 68
1.2.1.1 Begriff der Integrierten Kommunikation 68
1.2.1.2 Merkmale der Integrierten Kommunikation 71
1.2.1.3 Aufgaben und Ziele der Integrierten Kommunikation 72
1.2.1.4 Bezugsobjekte der Integrierten Kommunikation 77
1.2.1.5 Abgrenzung der Integrierten Kommunikation von Cross-Media-Kommunikation 83
1.2.2 Integrierte Kommunikation in Forschung und Praxis 88
1.2.2.1 Entwicklungsstand der Integrierten Kommunikationin der Forschung 88
1.2.2.2 Entwicklungsstand der Integrierten Kommunikation in der Praxis 90
2. Theoretische Grundlagen und Konzepte der Integrierten Kommunikation 92
2.1 Theoretische Ansätze zur Erklärung des Konzepts der Integrierten Kommunikation 92
2.1.1 Entscheidungstheoretische Erklärungsansätze 94
2.1.2 Systemtheoretische Erklärungsansätze 95
2.1.3 Verhaltenswissenschaftliche Erklärungsansätze 97
2.1.4 Beziehungsorientierte Erklärungsansätze 99
2.2 Gestaltpsychologie und Gestaltgesetze als Grundlage der Integrierten Kommunikation 102
2.2.1 Historische Entwicklung der Gestaltpsychologie 102
2.2.2 Bedeutung und Grundhypothese der Gestaltpsychologie 102
2.2.3 Gestaltgesetze zur Erklärung der Integrierten Kommunikation 103
2.3 Theoretische Ansätze zur Erklärung der Wirkung der Integrierten Kommunikation 110
2.3.1 Schematheorie 110
2.3.1.1 Historische Entwicklung der Schematheorie 110
2.3.1.2 Bedeutung und Grundaussagen der Schematheorie 110
2.3.1.3 Empfehlungen der Schematheorie für die Gestaltung der Integrierten Kommunikation 112
2.3.1.4 Einfluss von Involvement und Imagery auf die Integrierte Kommunikation 119
2.3.2 Klassische Konditionierung 121
2.3.3 Theorie der kognitiven Dissonanz 123
2.3.4 Encoding Variability Theory 124
2.3.5 Repetition Variation Hypotheses 125
2.3.6 Mere-Exposure Effekt 126
2.4 Leistungsfähigkeit früherer Koordinations-konzepte der Kommunikation 127
2.4.1 Denken im Kommunikationsmix 128
2.4.2 Corporate-Identity-Konzept 129
2.4.3 Corporate-Communications-Konzept 133
2.5 Konzepte der Integrierten Kommunikation in der Literatur 134
2.6 Einordnung der Integrierten Kommunikation in die Markenpolitik 149
3. Erscheinungsformen und Widerstände der Integrierten Kommunikation 152
3.1 Grundelemente der Kommunikation 152
3.2 Formen der Integrierten Kommunikation 156
3.2.1 Inhaltliche Integration 156
3.2.2 Formale Integration 158
3.2.3 Zeitliche Integration 163
3.2.4 Richtung der Integration 168
3.2.4.1 Horizontale Integration 168
3.2.4.2 Vertikale Integration 169
3.2.5 Ebenen der Integration 172
3.2.5.1 Interinstrumentelle Integration 172
3.2.5.2 Intrainstrumentelle Integration 176
3.3 Barrieren der Integrierten Kommunikation 178
3.3.1 Inhaltlich-konzeptionelle Barrieren 179
3.3.2 Organisatorisch-strukturelle Barrieren 181
3.3.3 Personell-kulturelle Barrieren 185
3.4 Anforderungen an die Integrierte Kommunikation 189
4. Analyse der Beziehungen zwischen Kommunikationsinstrumenten als Voraussetzung für die Planung der Integrierten Kommunikation 194
4.1 Theoretische Grundlagen 194
4.2 Funktionale Beziehungen zwischen Kommunikationsinstrumenten 196
4.2.1 Komplementäre Beziehungen 198
4.2.2 Konditionale Beziehungen 199
4.2.3 Substituierende Beziehungen 200
4.2.4 Indifferente Beziehungen 201
4.2.5 Konkurrierende Beziehungen 202
4.3 Zeitliche Beziehungen zwischen Kommunikationsinstrumenten 203
4.3.1 Paralleler Einsatz 204
4.3.2 Sukzessiver Einsatz 205
4.3.3 Intermittierender Einsatz 206
4.3.4 Ablösender Einsatz 207
4.4 Hierarchische Beziehungen zwischen Kommunikationsinstrumenten 208
4.4.1 Strategische Bedeutung von Kommunikationsinstrumenten 209
4.4.2 Taktische Bedeutung von Kommunikationsinstrumenten 213
5. Messung der Beziehungen zwischen Kommunikations-instrumenten 220
5.1 Messansätze im Überblick 220
5.2 Optimierungsverfahren 222
5.2.1 Analytische Verfahren 223
5.2.2 Heuristische Verfahren 226
5.3 Multivariate statistische Verfahren 231
5.3.1 Interdependenzanalysen 231
5.3.2 Dependenzanalysen 232
5.4 Beziehungsanalysen auf Basis von Cross-Impact-Analysen 233
5.4.1 Beziehungsanalysen 237
5.4.2 Einfluss-/Beeinflussungsanalysen 238
5.4.3 Empirische Ergebnisse von Beziehungsanalysen 241
5.4.4 Konsistenzanalysen 243
5.5 Portfolioanalysen 244
5.6 Hierarchisierungsanalysen auf Basis des »Analytic Hierarchy Process« (AHP) 249
5.6.1 Grundmodell und Ablaufschritte des AHP-Ansatzes 250
5.6.2 Anwendung des AHP-Ansatzes in der Kommunikations-planung 253
5.6.3 Kritische Würdigung des AHP-Ansatzes für eine integrierte Kommunikationsplanung 256
6. Planungskonzepte der Integrierten Kommunikation 258
6.1 Notwendigkeit einer systematischen Kommunikationsplanung 258
6.2 Kommunikationsplanung auf unterschiedlichen Ebenen 259
6.3 Träger der integrierten Planungskonzepte 263
6.4 Aufbau und Ablauf des Planungskonzeptes 265
6.4.1 Analyse der Kommunikationssituation 266
6.4.2 Festlegung der Ziele der Integrierten Kommunikation 270
6.4.3 Definition der Zielgruppen der Integrierten Kommunikation 275
6.4.4 Kategorisierung und Auswahl von Kommunikations-instrumenten 279
6.4.5 Integration der Planungselemente durch die Strategie der Integrierten Kommunikation 283
6.4.6 Festlegung und Verteilung des Kommunikationsbudgets 288
7. Inhaltliche Umsetzung der Strategie der Integrierten Kommunikation 294
7.1 Elemente eines Konzeptpapiers der Integrierten Kommunikation 294
7.2 Kommunikationsregeln als Kern des Konzeptpapiers 296
7.3 Integration der Kommunikationsziele (Zielplattform) 299
7.3.1 Strategische Positionierung als Ausgangspunkt 299
7.3.2 Hierarchisierung von Kommunikationszielen 306
7.4 Integration der Kommunikationsbotschaften (Botschaftsplattform) 309
7.4.1 Kommunikative Leitidee als Ausgangspunkt 309
7.4.2 Hierarchisierung von Botschaften 313
7.5 Integration der Kommunikationsinstrumente und -mittel (Instrumenteplattform) 319
7.5.1 Leitinstrumente als Ausgangspunkt 319
7.5.2 Kategorisierung weiterer Kommunikationsinstrumente 320
7.6 Dokumentation der Kommunikationsregeln 325
8. Organisatorische Gestaltung der Integrierten Kommunikation 328
8.1 Anforderungen an die Organisation der Integrierten Kommunikation 328
8.2 Integration durch »De-Spezialisierung« 330
8.2.1 Kommunikative Aufgabenanalyse 330
8.2.2 Stellenbildung in der Kommunikation 333
8.2.3 Bildung von Kommunikationsabteilungen 334
8.3 Integration durch Hierarchisierung 336
8.3.1 Einliniensysteme 337
8.3.2 Mehrliniensysteme 338
8.3.3 Stabliniensysteme 339
8.3.4 Matrixorganisation 342
8.4 Integration durch Prozessorientierung 348
8.4.1 Notwendigkeit und Einsatzbereiche der Prozessorganisation 349
8.4.2 Begriffliche Grundlagen zur Prozessorganisation der Integrierten Kommunikation 350
8.4.3 Prozessbetrachtung der Integrierten Kommunikation 353
8.4.4 Prozessarten in der Integrierten Kommunikation 354
8.4.5 Koordination von Prozessen in der Integrierten Kommunikation 357
8.4.6 Eignung einer prozessorientierten Organisationsgestaltung für die Integrierte Kommunikation 359
8.5 Integration durch Teamorientierung 360
8.5.1 Notwendigkeit der Teamorientierung 360
8.5.2 Gremienarbeit 362
8.5.3 Partizipationsmodell 365
8.5.4 Projektorganisation 366
8.5.5 Erfolgsfaktoren der Teamarbeit in der Kommunikation 368
8.6 Vorschlag einer idealtypischen Organisationsgestaltung der Integrierten Kommunikation 370
8.6.1 Projektorganisation mit interdisziplinären Teams und Lenkungsgremium 370
8.6.2 Organisation der Integrierten Kommunikation als Lernprozess 373
8.7 Organisationsansätze für die Integrierte Kommunikation in der Literatur 374
8.7.1 Konsolidierungsbezogene Ansätze 374
8.7.2 Koordinationsbezogene Ansätze 377
8.8 Organisation der Integrierten Kommunikation in international tätigen Unternehmen 381
8.8.1 Besonderheiten der internationalen Kommunikation 381
8.8.2 Multinationales Organisationsmodell 389
8.8.3 Internationales Organisationsmodell 390
8.8.4 Globales Organisationsmodell 392
8.8.5 Transnationales Organisationsmodell 393
8.8.6 Prozessorientierung der internationalen Kommunikation 396
8.8.7 Gestaltung Integrierter Kommunikation in internationalen Unternehmen 397
8.9 Integrierte Kommunikation in der Zusammenarbeit mit Kommunikationsagenturen 399
8.9.1 Entwicklungen innerhalb der Agenturbranche 401
8.9.2 Typologisierung von Agenturen 402
8.9.3 Agenturinternes Prozessmanagement 404
8.9.4 Merkmale der Beziehung zwischen Unternehmen und Agenturen 408
8.9.5 Anforderungen an Agenturen im Rahmen der Integrierten Kommunikation 412
8.9.6 Rolle der Agenturen zur Entwicklung eines prozessorientierten Kommunikationsmanagements in Unternehmen 418
8.9.7 Vergütungssysteme für Agenturen zur Steuerung der Integrationsarbeit 419
9. Personelle Gestaltung der Integrierten Kommunikation 422
9.1 Ziele und Aufgaben der personellen Gestaltung 422
9.2 Integrationsbewusstsein als Voraussetzung für die Integrierte Kommunikation 424
9.3 Stellenbeschreibungen für Kommunikations-mitarbeitende 429
9.4 Institutionalisierung der Stelle eines Kommunikationsmanagers 431
9.4.1 Aufgaben des Kommunikationsmanagers 432
9.4.2 Organisatorische Verankerung des Kommunikationsmanagers 438
9.4.3 Konfliktfelder des Kommunikationsmanagers 440
9.4.4 Anforderungsprofil des Kommunikationsmanagers 441
9.4.5 Weiterbildungsprogramme zur Integrierten Kommunikation 448
9.5 Abstimmung des Kommunikationsmanagers mit den Fachabteilungen 449
9.5.1 Instrumente der Zusammenarbeit 449
9.5.2 Entwicklung einer integrationsfördernden Kommunikationskultur 453
9.6 Gestaltung der Internen Kommunikation als zentrales Instrument der Integrierten Kommunikation 458
9.7 Anreizsysteme zur Erhöhung der Motivation für die Integrierte Kommunikation 466
10. Kommunikationscontrolling für die Integrierte Kommunikation 470
10.1 Funktionen, Ebenen und Anforderungen an ein Kommunikationscontrolling der Integrierten Kommunikation 470
10.2 Ansatzpunkte für ein Kommunikations-controlling der Integrierten Kommunikation 475
10.3 Strategisches Kommunikationscontrolling für die Integrierte Kommunikation 477
10.3.1 Überprüfung der strategischen Positionierung 478
10.3.2 Überprüfung von Planungsprämissen 478
10.3.3 Überprüfung der Kompatibilitäten 479
10.4 Operatives Kommunikationscontrolling für die Integrierte Kommunikation 480
10.4.1 Prozesskontrollen 480
10.4.2 Effektivitätskontrollen 500
10.4.3 Effizienzkontrollen 516
10.5 Erfolgsgrößen der Integrierten Kommunikation in der wertorientierten Unternehmensführung 529
10.6 Kritische Würdigung des Kommunikationscontrolling in der Integrierten Kommunikation 535
11. Entwicklungstendenzen und Zukunftsperspektiven der Integrierten Kommunikation 538
12. Best Practice Cases der Integrierten Kommunikation 548
12.1 Best Practice Case 1: Integrierte Unternehmens- und Marken-kommunikation eines Energieversorgungs-unternehmens – das Fallbeispiel Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 550
12.1.1 Ausgangslage 550
12.1.1.1 Integrierte Kommunikation als Projekt der EKZ 550
12.1.1.2 Kurzporträt der EKZ 550
12.1.1.3 Situationsanalyse und kommunikative Problemstellung 551
12.1.1.4 Zielsetzungen und Vorgehen des neuen Marktauftritts 551
12.1.2 Umsetzung der Integrierten Kommunikation bei den EKZ 553
12.1.2.1 Strategiepapier 553
12.1.2.2 Kommunikationsregeln 553
12.1.2.2.1 Zielplattform 553
12.1.2.2.2 Botschaftsplattform 555
12.1.2.2.3 Instrumenteplattform 555
12.1.2.3 Organisationsregeln 556
12.1.2.4 Integrationsformen 558
12.1.2.4.1 Inhaltliche Integration 558
12.1.2.4.2 Formale Integration 559
12.1.2.4.3 Zeitliche Integration 561
12.1.3 Integriertes Kommunikationscontrolling 564
12.1.4 Zusammenfassung und Ausblick 565
12.1.4.1 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse 565
12.1.4.2 Zukünftige Herausforderungen der Integrierten Kommunikation bei den EKZ 566
12.2 Best Practice Case 2: Integrierte Unternehmens- und Marken-kommunikation eines Finanzdienst-leisters – das Fallbeispiel PostFinance 568
12.2.1 Ausgangslage 568
12.2.1.1 Integrierte Kommunikation als Projekt von PostFinance 568
12.2.1.2 Kurzporträt von PostFinance 568
12.2.1.3 Situationsanalyse und kommunikative Problemstellung 569
12.2.1.4 Zielsetzungen und Vorgehen des neuen Marktauftritts 570
12.2.2 Umsetzung der Integrierten Kommunikation bei PostFinance 571
12.2.2.1 Strategiepapier 571
12.2.2.2 Kommunikationsregeln 572
12.2.2.2.1 Zielplattform 572
12.2.2.2.2 Botschaftsplattform 572
12.2.2.2.3 Instrumenteplattform 574
12.2.2.3 Organisationsregeln 575
12.2.2.4 Integrationsformen 576
12.2.2.4.1 Inhaltliche Integration 576
12.2.2.4.2 Formale Integration 578
12.2.2.4.3 Zeitliche Integration 580
12.2.2.5 Integration von Social Media in den Kommunikationsmix 581
12.2.3 Integriertes Kommunikationscontrolling 582
12.2.4 Zusammenfassung und Ausblick 582
12.2.4.1 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse 582
12.2.4.2 Zukünftige Herausforderungen der Integrierten Kommunikation bei PostFinance 584
12.3 Best Practice Case 3: Integrierte Unternehmens- und Marken-kommunikation eines Finanzdienst-leisters – das Fallbeispiel Neue Aargauer Bank (NAB) 586
12.3.1 Ausgangslage 586
12.3.1.1 Integrierte Kommunikation als Projektder Neuen Aargauer Bank (NAB) 586
12.3.1.2 Kurzporträt der NAB 586
12.3.1.3 Situationsanalyse und kommunikative Problemstellung 587
12.3.1.4 Zielsetzungen und Vorgehen des neuen Markenauftritts 591
12.3.2 Umsetzung der Integrierten Kommunikation bei der NAB 592
12.3.2.1 Strategiepapier 592
12.3.2.2 Kommunikationsregeln 595
12.3.2.2.1 Zielplattform 595
12.3.2.2.2 Botschaftsplattform 596
12.3.2.2.3 Instrumenteplattform 596
12.3.2.3 Rolle der externen Dienstleister bei der Planung und Umsetzung der Integrierten Kommunikation 599
12.3.3 Zusammenfassung und Ausblick auf den aktuellen Kommunikationsauftritt 601
12.4 Best Practice Case 4: Integrierte Kommunikationskampagne eines Finanzdienstleisters – das Fallbeispiel »Giro sucht Hero« der Sparkassen-Finanzgruppe 604
12.4.1 Ausgangslage 604
12.4.1.1 Integrierte Kommunikationskampagne als Projekt der Sparkassen-Finanzgruppe 604
12.4.1.2 Kurzporträt der Sparkassen-Finanzgruppe 604
12.4.1.3 Situationsanalyse und kommunikative Problemstellung 605
12.4.1.4 Zielsetzungen und Vorgehen der Integrierten Kommunikationskampagne 606
12.4.2 Umsetzung der Integrierten Kommunikationskampagne der Sparkassen-Finanzgruppe 608
12.4.2.1 Strategische Positionierung der Sparkassen-Finanzgruppe 608
12.4.2.2 Kampagnenkonzept 608
12.4.2.3 Integrationsformen 612
12.4.2.3.1 Inhaltliche Integration 612
12.4.2.3.2 Formale Integration 613
12.4.2.3.3 Zeitliche Integration 614
12.4.2.4 Integrationsebenen 615
12.4.2.4.1 Intrainstrumentelle Integration 615
12.4.2.4.1 Intrainstrumentelle Integration 615
12.4.2.4.2 Interinstrumentelle Integration 617
12.4.3 Kampagnenerfolg 619
12.4.4 Zusammenfassung und Ausblick 623
Werbeaufwand pro Prozentpunkt gestützte Werbeerinnerung 623
12.5 Best Practice Case 5: Integrierte Unternehmens- und Marken-kommunikation einer Fluggesellschaft – das Fallbeispiel Swiss International Air Lines Ltd. (SWISS) 626
12.5.1 Ausgangslage 626
12.5.1.1 Integrierte Kommunikation als Projekt der SWISS 626
12.5.1.2 Kurzporträt der SWISS 626
12.5.1.3 Die SWISS Markenpositionierung seit 2006 627
12.5.1.4 Neue SWISS-Markenpositionierung und Werte 628
12.5.1.5 Ausgangslage für die Integrierte Kommunikation bei SWISS 630
12.5.1.6 Zielsetzungen für die Integrierte Kommunikation bei SWISS 632
12.5.2 Umsetzung der Integrierten Kommunikation bei SWISS am Beispiel der Kommunikationskampagne Winter 2012/2013 in Großbritannien 633
12.5.2.1 Defi nition von SWISS-Schlüsselmärkten 633
12.5.2.2 Strategiepapier der Marketingkommunikation für den Markt Großbritannien 633
12.5.2.3 Kommunikationsregeln 635
12.5.2.3.1 Zielplattform 635
12.5.2.3.2 Botschaftsplattform 635
12.5.2.3.3 Instrumenteplattform 636
12.5.2.4 Organisationsregeln 639
12.5.2.5 Integrationsformen bei SWISS 640
12.5.2.5.1 Inhaltliche und zeitliche Integration 640
12.5.2.5.2 Formale Integration 641
12.5.3 Integriertes Kommunikationscontrolling 643
12.5.4 Zusammenfassung, Ausblick und zukünftige Herausforde-rungen der Integrierten Kommunikation bei SWISS 643
12.6 Best Practice Case 6: Integrierte Unternehmens- und Markenkommunikation eines Industrie-güterunter nehmens – das Fallbeispiel Siemens-Energy 648
12.6.1 Ausgangslage 648
12.6.1.1 Integrierte Kommunikation als Projekt bei Siemens-Energy 648
12.6.1.2 Kurzporträt des Siemens Energy-Sektors 648
12.6.1.3 Situationsanalyse und kommunikative Problemstellung 650
12.6.1.4 Zielsetzungen und Vorgehen der Neuaufstellung 652
12.6.2 Planung und Umsetzung der Integrierten Kommunikation bei Siemens-Energy 655
12.6.2.1 Strategiepapier 655
12.6.2.2 Kommunikationsregeln 656
12.6.2.2.1 Zielplattform 656
12.6.2.2.2 Botschaftsplattform 657
12.6.2.2.3 Instrumenteplattform 659
12.6.2.3 Organisationsregeln 662
12.6.2.4 Integrationsformen 664
12.6.2.4.1 Inhaltliche Integration 664
12.6.2.4.2 Formale Integration 665
12.6.2.4.3 Zeitliche Integration 665
12.6.2.5 Integration von Social Media in den Kommunikationsmix 668
12.6.2.5.1 Einsatzfelder der Social-Media-Kommunikation 668
12.6.2.5.2 Herausforderungen bei der Integration von Social Media in den Kommunikationsmix 670
12.6.3 Kontrolle der Integrierten Kommunikation 671
12.6.4 Zusammenfassung und Ausblick 672
12.6.4.1 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse 672
12.6.4.2 Zukünftige Herausforderungen der Integrierten Kommunikation bei Siemens-Energy 674
12.7 Best Practice Case 7: Integrierte Unternehmens- und Marken-kommunikation eines Energieversorgungs-unternehmens – das Fallbespiel enercity der Stadtwerke Hannover AG 676
12.7.1 Ausgangslage 676
12.7.1.1 Integrierte Kommunikation als Projektder Stadtwerke Hannover AG 676
12.7.1.2 Kurzporträt des Unternehmens 676
12.7.1.3 Situationsanalyse und kommunikative Problemstellung 677
12.7.1.4 Zielsetzung und Vorgehen des neuen Marktauftritts 677
12.7.2 Planung und Umsetzung der Integrierten Kommunikation bei »enercity« 678
12.7.2.1 Strategiepapier 678
12.7.2.2 Kommunikationsregeln 678
12.7.2.2.1 Zielplattform 679
12.7.2.2.2 Botschaftsplattform 679
12.7.2.2.3 Instrumenteplattform 681
12.7.2.3 Organisationsregeln 682
12.7.2.4 Integrationsformen 682
12.7.2.4.1 Inhaltliche Integration 682
12.7.2.4.2 Formale Integration 683
12.7.2.4.3 Zeitliche Integration 686
12.7.2.5 Integration von Social Media in den Kommunikationsmix 686
12.7.3 Kontrolle der Integrierten Kommunikation 687
12.7.4 Ausblick 688
12.7.4.1 Zusammenfassung der bisher erzielten Prozesse 688
12.7.4.2 Zukünftige Herausforderungen der Integrierten Kommunikation bei enercity 689
12.8 Best Practice Case 8: Integrierte Kommunikation eines Technologie- und Industriegüterkonzerns – das Fallbeispiel voestalpine 690
12.8.1 Ausgangslage 690
12.8.1.1 Integrierte Kommunikationskampagne als Projektdes voestalpine-Konzerns 690
12.8.1.2 Kurzporträt Metal Forming Division des voestalpine- Konzerns 690
12.8.1.3 Situationsanalyse und kommunikative Problemstellung 692
12.8.1.4 Zielsetzungen und Vorgehen des neuen Marktauftritts 694
12.8.2 Umsetzung der Integrierten Kommunikation bei der Metal Forming Division des voestalpine-Konzerns 695
12.8.2.1 Strategiepapier 695
12.8.2.2 Kommunikationsregeln 697
12.8.2.2.1 Zielplattform 697
12.8.2.2.2 Botschaftsplattform 698
12.8.2.2.3 Instrumenteplattform 698
12.8.2.3 Organisationsregeln 699
12.8.2.4 Integrationsformen 700
12.8.2.4.1 Inhaltliche Integration 701
12.8.2.4.2 Formale Integration 701
12.8.2.4.3 Zeitliche Integration 703
12.8.3 Integriertes Kommunikationscontrolling 703
12.8.4 Zusammenfassung und Ausblick 705
12.8.4.1 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse 705
12.8.4.2 Zukünftige Herausforderungen der Integrierten Kommunikation 706
Glossar zur Integrierten Kommunikation 708
Literaturverzeichnis 730
Stichwortverzeichnis 772
Verschaffen Sie sich mit der Leseprobe einen Überblick über das Angebot.
| Erscheint lt. Verlag | 20.10.2014 |
|---|---|
| Verlagsort | Freiburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Marketing / Vertrieb |
| Schlagworte | Erfolgsfaktor • Integrierte Kommunikation • Kommunikation • Kommunikationscontrolling • Kommunikationsinstrumente • Kommunikationskonzept • Kommunikationskonzepte • Kommunikationskultur • Kommunikationsmanagement • Kommunikationsplanung • Kommunikationsprozesse • Markenkommunikation • Markenpolitik • MManfred Bruhn • PR • Unternehmenskommunikation • Unternehmens- und Markenkommunikation |
| ISBN-10 | 3-7992-6872-3 / 3799268723 |
| ISBN-13 | 978-3-7992-6872-1 / 9783799268721 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 15,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich