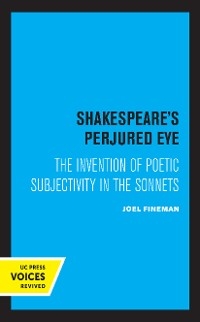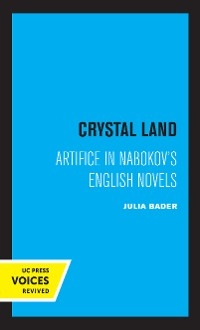Erzähltheorie in mediävistischer Perspektive (eBook)
446 Seiten
De Gruyter (Verlag)
978-3-11-041980-1 (ISBN)
This book is a systematic compendium of research on the otherness of medieval narrative. It particularly examines how forms of narrative are linked to narrative meaning. Covered themes include genre, patterns of narration, connections to contemporary world knowledge, spatial and temporal models, relationships to plot, and narrative drafts. The text has been revised once again for the student edition.
Armin Schulz (†); Manuel Braun, University of Stuttgart, Germany, Jan-Dirk Müller, LMU Munich and Alexandra Dunkel, Munich, Germany.
lt;!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
Armin Schulz (†), Universität Konstanz; Manuel Braun, Universität Stuttgart; Jan-Dirk Müller, LMU München; Alexandra Dunkel, München
Armin Schulz (†); Manuel Braun,University of Stuttgart,Germany, Jan-Dirk Müller, LMU Munich andAlexandra Dunkel, Munich, Germany.
Vorwort zur Studienausgabe 5
Vorbemerkung 7
Inhalt 9
1. Vorwort 17
2. Interpretation und Anthropologie: Konzeptionen von Figuren und ihren Interaktionen 24
2.1 Echte Menschen und literarische Figuren Charaktere und Typen
2.1.1 Textinterpretation und die Frage nach dem Warum 24
2.1.2 Zum Begriff der Figur 26
2.1.3 Ein ,technischer Blick‘ auf Figurenattribute und Figurenbeziehungen 28
2.1.4 Handlungsprinzipien und Figuren, abstrakt: Das Konzept der Aktanten 32
2.1.5 Handlungsprinzipien und Figuren, historisch: Transpersonale Identit?t, Einleiblichkeit, Merkmalsgleichheit 34
2.2 Text und Kontext 35
2.2.1 Kulturelle Kontexte 35
2.2.2 Zur Relevanz kulturellen Wissens fìr die Textinterpretation 37
2.2.3 Interpretation und die Hierarchie der Textebenen 42
2.3 Kulturelle Voraussetzungen des Verständnisses mittelalterlicher Literatur 45
2.3.1 Mikrokosmos und Makrokosmos: Der Mensch als Zwischenwesen 45
2.3.1.1 Gelehrtes Wissen 45
2.3.1.2 Mensch und Engel: Höfische Lichtkörper 47
2.3.1.3 Mensch und Tier 1: Der Krieger und die animalische Gewalt 48
2.3.1.4 Mensch und Tier 2: Das Unhöfische als Nicht-Menschliches 50
2.3.2 Humoralpathologie und Temperamentenlehre 53
2.3.2.1 Gelehrtes Wissen 53
2.3.2.2 Kuren gegen Wahnsinn in der höfischen Dichtung 54
2.3.3 Wahrnehmen und Erkennen 55
2.3.3.1 Die gelehrte Hierarchie der Sinne 55
2.3.3.2 Synästhetische Komplement?rmodelle 56
2.3.3.3 Wahrnehmung im sozialen Feld 57
2.3.4 Feudale Identität: Handlungs- und Verhaltenssemantiken 59
2.3.4.1 Höfische Interaktion: Agon, Reziprozität und ,Ausdruck‘ 59
2.3.4.2 Höfische Minne 69
2.3.4.2.1 Liebe als Kunst und ihre Paradoxien 69
2.3.4.2.2 Gattungszusammenhänge 71
2.3.4.2.3 Feudale Paarbildungslogiken 72
2.3.4.2.4 Magischer Zwang 74
2.3.4.2.5 Übergünge zwischen Magie und Kognition 75
2.3.4.2.6 Rekurrente Bildfelder und Interaktionsmuster 76
2.3.4.3 Zeichen, Repräsentation und Partizipation 79
2.3.4.3.1 Ein metonymisches Verhältnis zur Welt 79
2.3.4.3.2 Höfische Repräsentation 81
2.3.4.4 Rituale 82
2.3.4.4.1 Zur ordnungssetzenden Funktion von Ritualen 82
2.3.4.4.2 Literarische Thematisierung und Funktionalisierung von Ritualen 83
2.3.4.5 Gewalt 88
2.3.4.5.1 Felder der Gewalt 88
2.3.4.5.2 Kategorien der Gewalt: lozierend, raptiv, autotelisch 89
2.3.4.6 Kern und Hülle, Heimlichkeit und Öffentlichkeit 91
2.3.4.6.1 Das Böse, die Gewalt und die Falschheit 91
2.3.4.6.2 Prekäre Wahrnehmung im öffentlichen Raum 92
2.3.4.6.3 Kritik und Immunisierung der sozialen Wahrnehmung 94
2.3.4.7 Altersstufenlehre und Verhaltenssemantik 98
2.3.5 Determinanten adeliger Identität: Der Körper, das Selbst und die anderen 104
2.3.5.1 Identität und Individualität 104
2.3.5.1.1 Brüchige und widersprüchliche Figurationen des Selbst 104
2.3.5.1.2 Soziale Inklusion und soziale Exklusion 107
2.3.5.1.3 Körper, Kleidung und Identität 108
2.3.5.1.4 Individualitätsgeneratoren: Religion und Minne 111
2.3.5.2 Genealogie 113
2.3.5.2.1 Sippenkörper und Adelskörper 113
2.3.5.2.2 Gelehrte und feudale Vorstellungen ìber menschliche Fortpflanzung 114
2.3.5.2.3 Genealogie als Ordnung des Wissens 119
2.3.5.3 Männer und Frauen: Zur Kategorie des Geschlechts 120
2.3.5.3.1 Sex und gender 120
2.3.5.3.2 One sex theory: natura vs. nutritura 121
2.3.5.3.3 Gattung und Geschlecht 125
2.3.5.4 Freundschaft unter Merkmalsgleichen 126
2.3.5.5 Maß und Übermaß: Zur Thematisierung von Affekten 128
2.3.5.5.1 Ritual, ìberbordende Gefühle, ,Hydraulik‘: zum Verhältnis von Literaturwissenschaft und historischer Emotionsforschung 128
2.3.5.5.2 Zur Funktion literarischer Affektinszenierung 130
2.3.5.5.3 Überbordende Affekte in der Literatur des 13. Jahrhunderts 130
2.3.6 Anthropologie und Gattungen: Höfisches und Heroisches 133
3. Vom mittelalterlichen Wiedererzählen: Narrative Gattungen im Widerstreit konkurrierender Logiken 135
3.1 Gattungen im Spannungsfeld 135
3.1.1 Vor-Augen-Stellen von Widersprüchlichem 135
3.1.2 Zum Status von Gattungen 136
3.2 Literarische Elementarlogiken 138
3.2.1 Stoffe, Motive, Themen 138
3.2.2 Wiedererzählen 139
3.3 Narrativer Agon 140
3.3.1 Erzählen mit der und gegen die Tradition 140
3.3.2 Das Prinzip der Aventiure 143
3.4 Konkurrierende Logiken in den Hauptgattungen des volkssprachigen Erzählens 144
3.4.1 Konkurrierende Logiken 1: Das Motiv des Frauenerwerbs durch Aventiure – Minne und Herrschaft im höfischen Roman 144
3.4.1.1 Heldenkonzept und Wegstruktur 144
3.4.1.2 Agonalität im höfischen Roman 145
3.4.1.3 Frauenerwerb durch Aventiure 146
3.4.1.4 Der chevalier errant als Problem 148
3.4.2 Konkurrierende Logiken 2: Märendichtung – agonale Überlistung, Anspruch und Gnade 150
3.4.2.1 Die Konkurrenz von Narration und Weisheitslehre 150
3.4.2.2 Das Schwankschema als agonales Prinzip 152
3.4.3 Konkurrierende Logiken 3: Höfische Legenden – Weltflucht vs. höfische Sichtbarkeit 159
3.4.3.1 Funktionen und Merkmale einer populären Gattung 159
3.4.3.2 Das Heilige: Nicht-Verfìgbarkeit vs. Zwang zur Evidenz 162
3.4.4 Konkurrierende Logiken 4: Heldenepik – Höfisches und Heroisches 166
3.4.4.1 Von alternativer Geschichtserinnerung hin zur Faszination an grotesk-archaischer Gewalt 166
3.4.4.2 Heroische vs. höfische Anthropologie 168
3.4.4.3 Gängige Schemata, Motive und Figurenentwìrfe 169
4. Erzählen nach Mustern: Die gängigsten mittelalterlichen Erzählschemata 175
4.1 Erzählen: Das ,Narrative‘ 175
4.1.1 Zwei Grundbegriffe: histoire und discours 175
4.1.2 Diegese bzw. dargestellte Welt 177
4.1.3 Lineare vs. zyklische Zeitstrukturen: Christlich-gelehrte Vorstellungen und literarische Insel-Phantasmen 178
4.1.4 Erzählen und Handlung: Ein Plädoyer 180
4.1.5 Handlung und Ereignis: Die Modelle von Brémond, Greimas und Lotman 182
4.1.5.1 Allgemeines 182
4.1.5.2 Brémond: Regelkreis und Entscheidungsbaum 183
4.1.5.3 Greimas: Narrativer Dreischritt und Wertetransfer 187
4.1.5.4 Lotman: Grenzìberschreitungen zwischen semantischen Räumen 192
4.1.6 Zur Theorie und zum interpretatorischen Nutzen von Erzählschemata 200
4.2 Zentrale Muster mittelalterlichen Erzählens 207
4.2.1 Zum Brautwerbungsschema 207
4.2.1.1 Vielseitige Verwendbarkeit: ,Spielmannsdichtung‘, Heldenepik, hçfischer Roman 207
4.2.1.2 Das Sujet des Brautwerbungsschemas 209
4.2.1.3 Idealtypische Semantik und paradigmatische Strukturen 209
4.2.1.4 Syntagma bzw. Ablaufplan 211
4.2.1.5 Umbesetzung und Variation des Brautwerbungsschemas 1: Das ,Nibelungenlied‘ 220
4.2.1.6 Umbesetzung und Variation des Brautwerbungsschemas 2: Legendarische Einflìsse 223
4.2.1.7 Serielle Reduktion des Brautwerbungsschemas: ,Dietrichs Flucht‘ 226
4.2.2 Zur ,gestörten Mahrtenehe‘ 230
4.2.2.1 Faszinierende Fee vs. teuflische Dämonin 230
4.2.2.2 Mythische Grundlagen 232
4.2.2.3 Zum Sujet der ,gestörten Mahrtenehe‘ 234
4.2.2.4 Syntagma bzw. Ablaufplan 235
4.2.2.5 Mythisches Schema und mythologisches Spiel: Maries de France ,Lanval‘ 247
4.2.2.6 Bewältigung der Feen-Ambivalenz: Narrative Spaltungsphantasmen 251
4.2.3 Zum Artusschema: Kuhn meets Propp 257
4.2.3.1 Narrative Zweiteiligkeit, ,Doppelweg‘ und ,Symbolstruktur‘ 257
4.2.3.2 Zum Sujet des Artusromans 259
4.2.3.3 Schemakomplikation und Schemareduktion 260
4.2.3.4 Kuhns Modell der ,Doppelwegstruktur‘ des ,Erec‘ 261
4.2.3.5 Haugs Modell der Chrétienschen bzw. Hartmannschen ,Symbolstruktur‘ 266
4.2.3.6 Propps Zaubermärchenschema als Grundlage strukturalistischer Artusroman-Analysen 267
4.2.3.7 Zaubermärchen und Artusroman 1: Literaturanthropologische Forschungsansätze 269
4.2.3.8 Zaubermärchen und Artusroman 2: Die These Nolting-Hauffs 272
4.2.3.9 Märchensemantik vs. feudale Semantik 274
4.2.3.10 Zaubermärchen und Artusroman 3: Die These Simons 275
4.2.3.11 Versuch eines Ablaufschemas des ,klassischen‘ Artusromans 277
4.2.3.12 Artusroman und Mythos 287
4.2.3.13 Unterschiedliche Möglichkeiten der Schema-Realisation 290
4.2.3.14 Schemainterferenzen: her ?wein jaget in âne zuht 292
4.2.3.15 Strukturkomplexion: Wolframs ,Parzival‘ 295
4.2.4 Minne- und Aventiureromane 297
4.2.4.1 Zum Sujet des ,weltlichen‘ Minne- und Aventiureromans 300
4.2.4.2 Zum Syntagma des ,weltlichen‘ Minneund Aventiureromans 301
5. Räume und Zeiten 308
5.1 Literarische Weltentwürfe 308
5.1.1 Ausschnitthafte oder verallgemeinernde Darstellung 308
5.1.2 Basale Kategorien der Raumorganisation 309
5.1.3 Basale Kategorien der Zeitorganisation 310
5.2 Literatur- und kulturwissenschaftliche Beschreibungsmodelle 311
5.2.1 Bachtins ,Chronotopos‘-Konzept 311
5.2.2 Lugowskis ,mythisches Analogon‘ 312
5.2.3 Providenz und Kontingenz im mittelalterlichen Weltbild 313
5.2.4 Aggregaträume und Systemräume 316
5.2.5 Bewegungsräume und Schwellenräume 317
5.2.6 Diskontinuierliche Räume 1: Linearität und Insularität 317
5.2.7 Diskontinuierliche Räume 2: ,Falträume‘ im Innen und im Außen 320
5.2.8 Foucaults Heterotopien 320
5.2.9 Mythischer vs. profaner Raum bei Cassirer 322
5.2.10 Das Prinzip des Transgressiven 324
5.3 Sonderräume und Unorte im höfischen Roman 326
5.3.1 Tristrants Waldleben: Chronotopos, Heterotopie, Konkreszenz 326
5.3.2 Mythische Unorte im Artusroman: Ulrichs von Zatzikhoven ,Lanzelet‘ 332
6. Verknüpfungen: Wie wird ein Text zu einem kohärenten Text? 338
6.1 Komposition, Wiederholung, Äquivalenz 338
6.1.1 Narrativer Zusammenhalt 338
6.1.2 Korrelative Sinnstiftung 339
6.1.3 Kohärenz 341
6.1.4 Motivationsarten: Unterschiedliche Formen der Klassifikation 343
6.1.5 Barthes’ ,Handlungsfolgen‘ 348
6.1.6 Metonymisches Erzählen 349
6.1.7 Erzählen im Paradigma 359
6.2 Von der Funktionalität ,blinder‘ Motive 364
6.2.1 Widersprìchlichkeit als Erzählprinzip 364
6.2.2 ,Abgewiesene Alternativen‘ 366
6.2.3 Prozessierung 375
6.2.4 Überblendung und Hybridisierung 378
6.2.5 Überdetermination 380
7. Vermittler zwischen Stoff und Rezipient: Erzähler und Erzählperspektive 383
7.1 Erzähler und Perspektive 383
7.2 Sekundäre Mìndlichkeit: Der Erzähler im Heldenepos und im höfischen Roman 385
7.2.1 Allgemeines 385
7.2.2 Narrative Wissensvergabe und sekundäre Mündlichkeit im Heldenepos: Das ,Nibelungenlied‘ 386
7.2.3 Narrative Wissensvergabe und sekundäre Mündlichkeit im höfischen Roman 390
7.2.4 Mittelalterliches Wiedererzählen 394
7.2.5 Frau Aventiure als Personifikation des Stoffs 396
7.3 Zwei Fallbeispiele 399
7.3.1 Fokalisierung/Point of view/Perspektive in Gottfrieds ,Tristan‘ 399
7.3.2 Experimente oder Fehlgriffe? Konrads ,Partonopier‘ 402
Literatur 412
Quellen 412
Darstellungen und Hilfsmittel 418
Autoren- und Textregister 445
lt;!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
"Dass Achim Schulz’ Werk nach dessen Tod nicht im Nachlass verborgen geblieben ist, ist als Gewinn für Germanistikstudierende und die gesamte mediävistische Fachwelt anzusehen, denn das Handbuch liefert nicht nur eine verdienstvolle ‚Gebrauchsanweisung‘ zur kulturgeschichtlichen und erzähltheoretischen Einordnung und Analyse mittelhochdeutscher Epik, es stellt dank seiner kleinschrittigen Gliederung und ausführlicher Register auch ein längst überfälliges Hilfsmittel und Nachschlagewerk dar, das als Wegweiser durch die erzählten Welten des Mittelalters in keiner Bibliothek fehlen sollte."
Katharina Münstermann in: www.literaturkritik.de
"Mit großem Anspruch, doch kleinen Kapiteln, mit der Tiefe der Theorie unter der Oberfläche sprachlicher Klarheit, haben wir mit Schulz' letzter Publikation (so die Herausgeber:) "das opus magnum eines der begabtesten Mediävisten seiner Generation" vorliegen [...]. Schulz erläutert so schlicht und einleuchtend, dass mir [...] hier erst einiges klar wurde, was mir zuvor hinter den Begriffsschleiern anderer Autoren verborgen blieb."
MatthiasDäumer in: Das Mittelalter, Heft 1.2014
| Erscheint lt. Verlag | 24.2.2015 |
|---|---|
| Reihe/Serie | De Gruyter Studium |
| Verlagsort | Berlin/Boston |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Anglistik / Amerikanistik | |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Germanistik | |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Literaturwissenschaft | |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Sprachwissenschaft | |
| Schlagworte | Erzähltheorie • Mediävistik • Medieval German Literature • Medieval Studies • Middle Ages/Literature • Mittelalter/Literatur • Narrative theory • Narratology |
| ISBN-10 | 3-11-041980-7 / 3110419807 |
| ISBN-13 | 978-3-11-041980-1 / 9783110419801 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
Größe: 1,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich