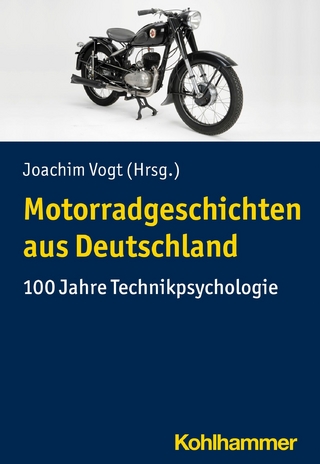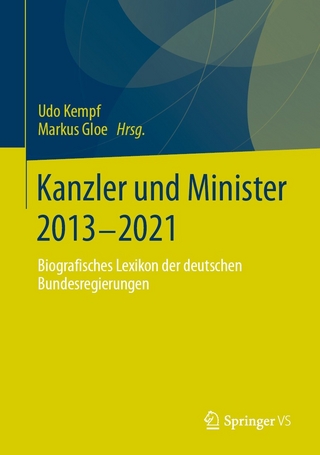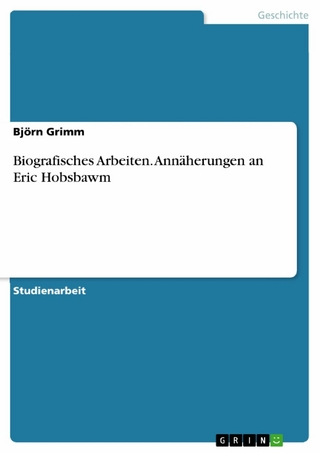Hexen und Magie (eBook)
205 Seiten
Campus Verlag
978-3-593-43885-6 (ISBN)
Johannes Dillinger ist Professor für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Oxford Brookes University und lehrt an der Universität Mainz.
Johannes Dillinger ist Professor für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Oxford Brookes University und lehrt an der Universität Mainz.
1. Einführung
Die historische Hexenforschung ist alt und jung. Sie ist alt, da die historische Untersuchung der Entstehung des Hexenglaubens bereits lange vor dem Ende der Hexenverfolgungen einsetzte. Sie ist jung, weil sie sich in den 1960er Jahren ganz neu konstituierte und seitdem floriert wie wenige andere geschichtswissenschaftliche Forschungsfelder. Im Verlauf der letzten fünfzig Jahre sind Magie und Hexen vom Rand der Geschichtswissenschaft in deren Mitte gerückt. Die rasante Entwicklung der historischen Magie- und Hexenforschung hat das Bild von Mittelalter und Früher Neuzeit insgesamt verändert. Die Hexenforschung darf heute nicht nur als zentraler Bestandteil der Historiografie der Frühen Neuzeit gelten, sondern auch als eine der Wegbereiterinnen der neuen Kulturgeschichte.
Das vorliegende Buch über Magie und Hexen soll in das volatile und breite Forschungsfeld einführen und als Orientierung dienen. Es konzentriert sich auf die Historiografie der europäischen Hexenverfolgungen. Hexerei ist jedoch nur ein Teilaspekt des riesigen Bereichs der Magie. Die historische Hexenforschung hat diesen Bereich niemals ausgeklammert, sondern ihn immer weiter aufgeschlossen. Daher sollen Hexerei und Hexenprozess auch in diesem Band in den größeren Kontext der Magie gestellt werden. Die wichtigsten Ergebnisse der neuen Forschung zum Glauben an Magie und Hexerei werden präsentiert. Unterschiedliche Fragestellungen und Interpretationen, die für die Erforschung von Magie wichtig geworden sind, werden kritisch referiert.
Geschichte der Hexenforschung
Da es hier nicht um eine Geschichte der geschichtswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Magie und Hexenverfolgungen steht, genügt ein sehr kurzer Überblick über die Forschungsentwicklung (vgl. Behringer 2004). Eine erste ausführliche Geschichte der Hexenvorstellung und der Hexenprozesse legte Christian Thomasius 1712 vor. Dem Juristen Thomasius ging es wie späteren aufgeklärten Autoren noch darum, durch die Historisierung der Hexenimagination zu beweisen, dass die Hexenverfolgungen, die sie selbst noch erlebten, Unrecht waren. Die Schuld an diesem Unrecht schrieb Thomasius der katholischen Kirche und ihrer Inquisition zu. Das populäre Verständnis von Hexenprozessen bewegt sich zum Teil auch heute noch auf diesem Niveau. Dazu konnte es kommen, weil die historische Erforschung der Hexenprozesse insbesondere im deutschen Kernland der Verfolgungen von der aufklärerischen Debatte des 18. in die konfessionell-kulturkämpferische des 19. Jahrhunderts geriet. Bezeichnend ist, dass die aus Quellen geschöpfte, konfessionell neutrale Überblicksdarstellung von Wilhelm Soldan aus dem Jahr 1843 1880 so umgearbeitet wurde, dass sie wiederum zur Polemik geriet (Soldan 1880). Zwischen Schuldzuweisung und Apologetik entwickelten sich Materialschlachten, die umfangreiche Quellen der Forschung zur Verfügung stellten. Mit Goethe als Stichwortgeber entwickelte sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts unter der Ägide Jacob Grimms die Auffassung, dass die Opfer der Hexenprozesse tatsächlich die Anhänger einer vorchristlichen Religion gewesen seien. Vermittelt über die Vergangenheitspolitik des Nationalsozialismus hat sich auch diese sehr fragwürdige Interpretation in das vorwissenschaftliche Geschichtsbild unserer Gegenwart retten können (Dillinger 2015). Der Primat von Politik und staatlichen Institutionen in der Geschichtswissenschaft der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überließ die Hexen ideologisch motivierten Autoren und Heimatforschern.
Midelfort-Schule
Der wesentliche Anstoß zur Entstehung der neuen historischen Hexenforschung kam von der Anthropologie. Hier war die Magie als Teil des sozialen Gefüges in ihrer Bedeutung für Weltsicht und Alltag dargestellt worden. Mit der dezidierten Übernahme anthropologischer Fragestellungen in die historische Beschäftigung mit Magie und Hexenverfolgungen gab der britische Historiker Thomas 1963 den Startschuss für die neue Hexenforschung. Sein US-amerikanischer Kollege Midelfort legte nicht nur 1968 einen ersten Überblick über diese Forschungsrichtung vor, sondern widmet sich, an ihr orientiert, Quellen aus Deutschland, dem Zentrum der Hexenverfolgung. Dabei wandte sich Midelfort anders als Thomas dezidiert den konkreten administrativen und rechtlichen Verhältnissen an den Schauplätzen der Verfolgungen zu. Diese Herangehensweise machte Schule: Die Regionalstudie, die Hexenverfolgungen in ihrem gesellschaftlichen und politischen Kontext darstellte, wurde zum wichtigsten Modus der historischen Hexenforschung (Thomas 1963; Midelfort 1968; Midelfort 1972).
Die regional orientierte Forschung flankiert ein neues Interesse an Magie und Hexenimaginationen in der Rechts- und Geistesgeschichte. Dass Hexen- und Magieforschung nie nur Hexenprozessforschung war, impliziert, dass sie sich nicht auf die Frühe Neuzeit einengen lässt. Magie in der Antike und im Mittelalter sind längst ausführlich thematisiert worden. Die Perspektive der Geschichtsschreibung der Magie wird seit mehreren Jahren auch in Richtung auf die Gegenwart hin verlängert. Arbeiten zum Zauber- und Geisterglauben im 19. und 20. Jahrhundert modifizieren das nie so recht glaubwürdige Klischee der entzauberten Moderne (Doering-Manteuffel 2008; Butler 2011; Josephson-Storm 2017).
Die Magie- und Hexenforschung trägt einen starken historischen Akzent. Sie ist in ihrer konkreten Gestalt jedoch interdisziplinär: Neben den unterschiedlichen Sparten der Geschichtswissenschaft beteiligen sich vor allem Theologie, Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte, Volkskunde, Anthropologie, Medizin und Rechtswissenschaft an der Debatte.
Die vorliegende Darstellung konzentriert sich auf die geschichtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Magie. Weitere Einschränkungen sind unumgänglich. Alchemie und Astrologie stellen in sich so komplexe historische Forschungsfelder dar, dass sie hier nur im Rahmen eines knappen Überblicks über die Gelehrtenmagie gestreift werden. Ausgeklammert bleibt die in ganz anderen kulturellen Bezugsrahmen stehende Magie der Antike (vgl. dazu Luck 1985; Graf 1996; Gordon 1999; Ogden 2008).
Quellen
Welche Quellen geben Antworten auf die historische Frage nach Magie? Hier fällt zunächst das unmittelbar magische Schrifttum in den Blick. Zauberbücher geben Auskunft über das magische Denken. Sie zeigen, wie magische Zusammenhänge und Wirkungsmöglichkeiten imaginiert wurden. Ihre Sprache lässt erkennen, für Leser welchen Bildungsstandes die Schrift gedacht war. Dabei ist zu bedenken, dass die für den Markt produzierten Zauberbücher des 18. Jahrhunderts häufig aus geringfügig älteren Versatzstücken zusammengesetzte Kompilationen sind.
Ihrem Charakter als Gerichtsverfahren entsprechend haben sich die Hexenprozesse in vielerlei Akten niedergeschlagen. Die Prozessunterlagen selbst umfassen meist nicht nur das Urteil und die Aussagen der Beklagten (Verhör, bei Schuldspruch die Urgicht) sondern auch umfangreiche Zeugenverhöre. Gerichtsüberlieferung bildet nie einfach Realität ab, sondern konstruiert Plausibilität in alltagsfernen und stark von Machtgefälle geprägten Kommunikationssituationen. Dies gilt für Hexenprozesse, die unter dem Anspruch der Dämonologie ein imaginäres Delikt verhandelten, in besonderer Weise. Gleichwohl wird in Prozessakten bei kritischer Lektüre nicht nur der Blick auf die konkrete Konstruktion des Hexereideliktes in der Kommunikation von Zeugen, Beklagter und Verhörrichtern frei, sondern auch auf den frühmodernen Alltag. Diese Quellen sind über die Magieforschung hinaus von größtem Interesse. Selbst wenn die Prozessakten selbst nicht erhalten sind, können Kostenrechnungen und Vermerke über Hinrichtungen in Stadtratsprotokollen Auskunft über Prozesse geben. Falls Gutachten bei Juristenfakultäten eingeholt wurden, vermitteln diese gute Überblicke über den jeweiligen Prozess und zeigen konkret die Bedeutung von Recht, Dämonologie und Verfahrenskritik im juristischen Entscheidungsprozess. Hexenprozesse waren nie unumstritten: Behördenkorrespondenzen zwischen dem jeweiligen Kriminalgericht und seinen übergeordneten Instanzen bieten einen Einblick in die Strukturen und inneren Spannungen des Justizapparates. Editionen bzw. Transkriptionen haben kleine Auswahlen von Prozessakten leicht zugänglich gemacht (Hille 2008: Rügge 2015; Behringer 72010; vgl. auch die Predigtensammlung Schmanck 2015).
Oberhalb der Ebene der konkreten Prozesse wird von der Geschichtswissenschaft theologisches bzw. dämonologisches und juristisches Schrifttum ausgewertet. Die Bedeutung normativer Quellen für die konkrete Verfolgung darf aber...
| Erscheint lt. Verlag | 15.2.2018 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Historische Einführungen |
| Zusatzinfo | 5 sw Abb. |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Allgemeines / Lexika |
| Schlagworte | Aberglauben • Frühe Neuzeit • Hexen • Hexenforschung • Hexenprozess • Hexenverfolgung • Magie • Mittelalter • Teufelsglaube • Volksglauben |
| ISBN-10 | 3-593-43885-2 / 3593438852 |
| ISBN-13 | 978-3-593-43885-6 / 9783593438856 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich