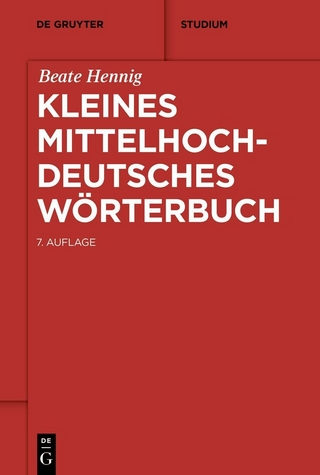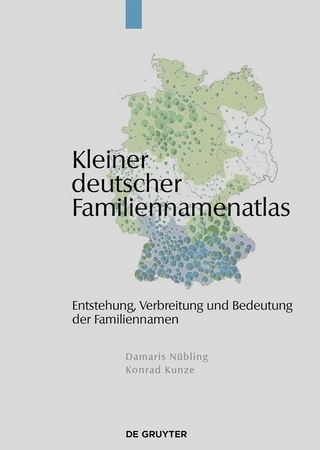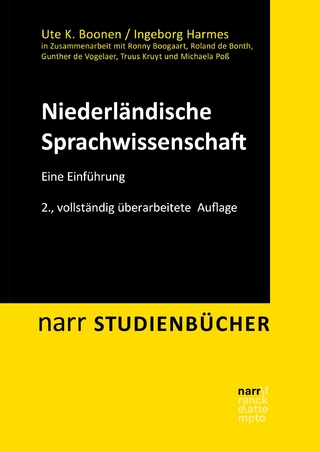Der deutsche Wortschatz (eBook)
234 Seiten
Narr Francke Attempto (Verlag)
978-3-8233-0142-4 (ISBN)
Dr. phil. habil. Christine Römer lehrte als Hochschuldozentin für Germanistische Sprachwissenschaft an der Universität Jena.
Dr. phil. habil. Christine Römer lehrte als Hochschuldozentin für Germanistische Sprachwissenschaft an der Universität Jena.
Vorbemerkungen
1. Lexikologie - Wissenschaft vom Wortschatz
2. Wörter
3. Komplexe Wörter
4. Feste Fügungen
5. Wörter als sprachliche Zeichen: semiotische Wortcharakteristika
6. Lexikalische Subsysteme
7. Beziehungen zwischen den Wörtern
8. Wortbedeutungen: Merkmale und Beschreibungen
9. Aktuelle Entwicklungen im deutschen Wortschatz
Literatur
Abbildungen
Sachregister
Index der Namen
Index der Beispielwörter
3.3 Wortbildung
3.3.1 Funktion der Wortbildung
Der Wortschatz ist ein dynamisches System, das sich in ständiger Veränderung befindet. Ein Aspekt dabei ist die potentiell unbegrenzte Wortschatzerweiterung durch die Bildung neuer Wörter. Dabei werden unter Zuhilfenahme des vorhandenen Sprachmaterials neue Wörter (= Wortbildungen) geschaffen. Die Bildung neuer Wörter erfolgt auch in Analogie zu den vorhandenen, beispielsweise Hausfrau > Hausmann, rauchen > dampfen. Die Wortbildungslehre, ein Teilgebiet der Morphologie, hat aus der Analyse der vorhandenen Wörter „Normen“ für das Bilden von Wörtern abgeleitet.
Die Bildung von komplexen Wörtern schließt Bezeichnungslücken und eröffnet die Möglichkeit Texte zu verdichten, indem aus syntaktischen Fügungen kürzere Wörter werden, beispielsweise Der Pullover kann gewaschen werden, er ist waschbar. Die Komprimierung wird oft bei der Komposition übertrieben. Es entstehen dann sogenannte besonders lange Bandwurmwörter wie Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung.
(Zu dem Sprachwissen, das wir uns aneignen, gehört auch) ein Wissen um die Funktionalität der Wortbildung. Da es keine einfache Funktionszuordnung gibt, haben Wortbildungen, je nach den Textteilen, in denen sie vorkommen, und je nach der stilistischen Intention des Textes, einen unterschiedlichen Platz, und bedingt auch die Präferenz für unterschiedliche bzw. auch unterschiedlich auffällige Bildungen.
(Eichinger, 2012, S. 30)
Das oben angeführte Bandwurmwort ist stilistisch eindeutig als Wort aus der Rechtssprache erkennbar und für die Alltagssprache nicht geeignet. Die morphologisch inkorrekte Wendung Hier werden sie geholfen wurde in der Werbesprache sehr bekannt, da dort Auffälligkeit ein Merkmal ist. In anderen Textsorten wird sie als Bildungsdefizit angesehen. Wie in Römer (2012) dargestellt, gibt es für Werbetexte spezielle Wortschatzgruppen. Beispielsweise treten Hochwertwörter wie biologisch oder fair oftmals auf (Beispiel in 3.0), diese gehen dann in dieser Textsorte auch häufig in Wortbildungen ein.
| (3.0.) | Biomineralwasser; biologisch-dynamische Präparate; Bio-Spiral. Der rein biologische Abflussreiniger Fairness im Handel; Fair Fashion; Unter dem Motto „Fairer Wein – Qualität und Genuss“ hatten die Fairtrade-Stadt Homburg und der Fairtrade-Kreis Saarpfalz … |
3.3.2 Typen, Muster und Regeln
Bezüglich der Regelhaftigkeit der Wortbildung kann man zwischen Typen, Mustern und Regeln unterscheiden (ausführlicher in Römer, 2015):
Die Wortbildungstypen sind die grundlegenden Verfahren, die nach der Art der verwendeten Bestandteile differenziert werden. In der Regel unterscheidet man für die deutsche Sprache die Komposition (Wortzusammensetzungen) und Derivation (Wortableitungen). Manche, wie Donalies (2007), nehmen noch die Kurzwortbildung als dritten Typ an. Andere sehen sie als Sondertyp an.
Wortbildungsmuster knüpfen an die Typen an und subklassifizieren und charakterisieren diese weiter entsprechend dem morpho-syntaktischen, morpho-phonologischen und/oder morpho-semantischen Status der Bestandteile. Aufgrund dieser Status-Beschreibungen werden mögliche Wortbildungen vorhergesagt.
Als eine Form der produktiven Muster werden auch kognitiv verankerte morpho-syntaktische Schablonen (Konstruktionen) im Rahmen der Konstruktionsgrammatik angesehen. „ Im Rahmen dieser Grammatikkonzeption bestehen Konstruktionen für komplexe Wörter entweder aus freien oder aber zum Teil bereits gefüllten Slots.“ (Michel, 2014, S. 2) Nach dieser Theorie treten Affixe im Gegensatz zu Wörtern nur innerhalb von Konstruktionen auf und sind an komplexere Einheiten gebunden (siehe weiter Michel, 2014, Kap. 4.2).
Beispielsweise kann man für das sehr produktive Suffix -er, das mehrdeutig ist, für die explizite Substantivableitung (Nomen Agentis) von verbalen Wortgruppen (Fliesen legen → Fliesenleger, Ofensetzer, Dachdecker …) ein spezielles Konstruktionsmuster annehmen und wie nachfolgend veranschaulichen (Abbildung 3.1). Für Nomina agentis gibt es viele konkurrierende Ableitungssuffixe, beispielsweise -ler (Tischler) -ner (Schaffner) oder -e (Putze). Diese müssten dann nach der Annahme eigene Schemata erhalten.
In dem ersten, allgemeinen Schema haben wir einen leeren Slot für Verbphrasen (VP); in dem zweiten, speziellen ist dieser ausgefüllt.
Abbildung 3.1: -er-Derivationsschema
Wortbildungsregeln sind dynamisch, rekursiv (mehrfach an einem Objekt anwendbar) und werden als kreative, implizite Elemente des menschlichen Sprachvermögens angesehen. Sie sind aus den Mustern ableitbar, jedoch auf den Erzeugungsprozess orientiert. Die Derivationsregeln sind danach „Regeln, die ein neues Wort aus alten Wörtern bilden.“ (Pinker, 2000, S. 38) Die Kompositionsregeln bilden die „Zusammenfügung von Wörtern bzw. Wortstämmen zu einem neuen Wort“ ab. (Sternefeld, 2006, S. 4) Die Anwendung der Wortbildungsregeln unterliegt Restriktionen, die ihre Anwendungen verhindern können.
Neben Regeln werden auch abstrakte, allgemeine Prinzipien angenommen, die erklärende Funktionen haben. So nimmt man für Bedeutungsbeschreibungen ein semantisches Kompositionalitätsprinzip (auch „Frege-Prinzip“) an. Dies besagt, dass sich die Bedeutungen komplexer Ausdrücke aus den Bedeutungen der Bestandteile und der Art, wie sie zusammengefügt sind, ergeben. Beispielsweise ergeben sich die Gesamtbedeutungen der Adjektivkomposita (wie dunkelblond und schwarz-rot gestreift) aus den Bedeutungen der Teile und aus den Strukturtypen der Zusammenfügung: dunkelblond ist eine determinative Komposition, der zweite Teil bestimmt den ersten; schwarz-rot ist dagegen eine kopulative Fügung, was durch den Bindestrich signalisiert wird.
Ein anderes relevantes Prinzip ist das strukturelle Kopfprinzip. Es erklärt u.a. die Tatsache, dass nicht alle an den Bildungen komplexer Wörter beteiligten Teile „gleichberechtigt“ sind. Ein Bestandteil, der Kopf (engl. head), legt die grammatischen und semantischen Grundeigenschaften des Gesamtwortes fest. Wenn man giftgrün mit Rattengift vergleicht, so sieht man, dass giftgrün ein Adjektiv ist, da das Gesamtwort vom zweiten Teil, der Kopfkonstituente, diese Eigenschaft übernommen hat. Rattengift ist dagegen ein Substantiv, weil Gift hier die Kopfkonstituente ist. In der deutschen Sprache sind die komplexen Wörter in der Regel rechtsköpfig. (Zwicky, 1985)
Zentrale Aufgabe der Wortbildungs(lehre) ist es, zu beschreiben, was ein mögliches Wort einer Sprache (z.B. der deutschen) ist, d.h. welche Wörter bzw. Wortbestandteile (z.B. Affixe) wie miteinander kombiniert werden können, und welche regelmäßigen Beziehungen es zwischen der Bedeutung des komplexen Wortes gibt. Man kann sich für den jetzigen Bestand von Wortbildungsprozessen interessieren (synchrone Wortbildung), man kann auch untersuchen, wann bestimmte komplexe Wörter wie entstanden sind, welcher Herkunft die Wortbildungs-Affixe sind, wie produktiv bestimmte Wortbildungsprozesse waren usw. (diachrone Wortbildung). (Clément, 1996, S. 38)
Einen kompakten Überblick findet man im Teil Wortbildung der Dudengrammatik. (Wöllstein und Dudenredaktion, 2016)
3.3.3 Kompositionen
Die meisten komplexen Wörter sind im Deutschen Komposita (Wortzusammenfügungen). Mindestens zwei Wörter bzw. frei vorkommende Morpheme werden zu einem neuen Wort fest zusammengefügt, das zusammengeschrieben wird. Bei der Vereinigung von mehr als drei Wörtern kann trotzdem eine binäre Gliederung (mit Ausnahme der Kopulakomposita) festgestellt werden, wobei die Teile in dem Verhältnis der Über- und Unterordnung stehen, was das Verständnis erleichtert. In der Abbildung 3.2 wird dies mittels eines Konstituentenbaumes veranschaulicht.
Abbildung 3.2: Konstituentenstrukturbaum
Bahnhof wurde mit Güter zu Güterbahnhof verbunden; Bahnhof entstand aus der Verbindung der Wörter Bahn und Hof. In der Regel ist die zweite unmittelbare Konstituente das Hauptwort, dies wird auch durch eine Transformation in eine Wortgruppe deutlich: Güterbahnhof → Bahnhof für Güter; Bahnhof → Hof für die Bahn. Dieses Hauptwort bestimmt auch die grammatischen Eigenschaften des entstandenen Kompositums (Wortart, Genus, Flexion): das...
| Erscheint lt. Verlag | 9.9.2019 |
|---|---|
| Reihe/Serie | narr studienbücher |
| Verlagsort | Tübingen |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Germanistik |
| Schlagworte | Lexikologie • Lexikon • Wörter • Wortschatz • Wortschatzkunde |
| ISBN-10 | 3-8233-0142-X / 382330142X |
| ISBN-13 | 978-3-8233-0142-4 / 9783823301424 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich