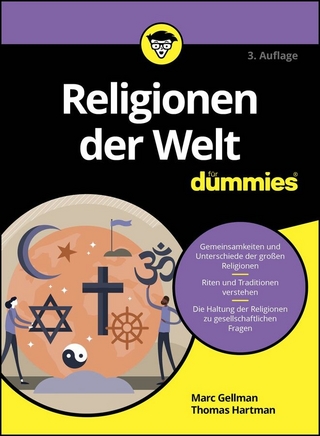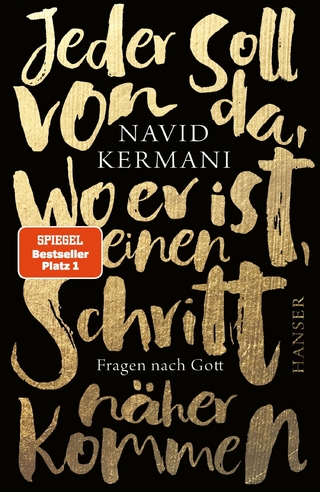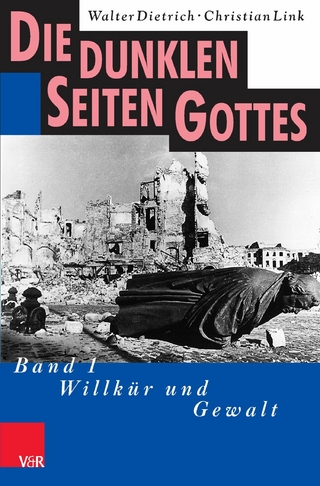Überlegungen zur Frage des Antisemitismus (eBook)
144 Seiten
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
978-3-446-26736-7 (ISBN)
Wo liegen die Ursprünge antisemitischen Denkens? Was heißt es, jüdisch zu sein, ohne den definierenden Blick des Antisemiten? Und wie hängen Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit zusammen? Delphine Horvilleur ist eine von drei Rabbinerinnen Frankreichs und eine der einflussreichsten Stimmen des liberalen Judentums in Europa. In ihrem Essay beleuchtet sie die fatalen Parallelen von Antisemitismus, Faschismus und Misogynie. Dabei spannt sie den Bogen von religiösen Texten bis hin zur politischen Gegenwart. Ihr Buch eröffnet uns eine neue Perspektive auf eine alte Frage, die sich in unserer Gegenwart erneut mit großer Dringlichkeit stellt.
Delphine Horvilleur, geboren 1974 in Nancy, ist Rabbinerin, dreifache Mutter und die Leitfigur der Liberalen Jüdischen Bewegung Frankreichs (MJLF). Sie ist Herausgeberin der Zeitschrift Tenou’a - Atelier de pensée(s) juive(s) und Autorin mehrerer Bücher zum Thema Weiblichkeit und Judentum. Zuletzt erschien von ihr Überlegungen zur Frage des Antisemitismus (2020).
KAPITEL 1
Antisemitismus als Familienrivalität
Von Epoche zu Epoche reproduzieren sich in erstaunlich unterschiedlichen Zusammenhängen einige Leitmotive des antijüdischen Furors, wie das sogenannte Ur-Übel oder das widerwärtige Stottern der Geschichte.
Unzählige Historiker, Soziologen, Theologen und Psychologen haben die Ursprünge der antisemitischen Geißel analysiert und versucht, die politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen oder religiösen Hintergründe ihres Erscheinens oder Wiederauflebens zu verstehen. Nicht ganz so zahlreich sind diejenigen, die sich mit der jüdischen Literatur zur Erforschung dieses Phänomens beschäftigt haben.
Eigentlich sollte es nicht die Aufgabe eines Opfers von Gewalt oder Diskriminierung sein, die Auslöser für den erfahrenen Hass erklären und die Beweggründe des Henkers sondieren zu müssen. Muss man an eine solche Selbstverständlichkeit überhaupt erinnern? Antisemitismus ist nicht »das Problem der Juden«, sondern in erster Linie das der Antisemiten und derer, die ihnen das Wort reden. Warum also sollten die Exegeten der jüdischen Quellen über einen besonderen Schlüssel zum Verständnis dieses Hasses verfügen?
Tatsächlich bietet die Auslegung des Antisemitismus durch das Judentum eine bisher unbekannte Perspektive: den subjektiven Standpunkt derjenigen, die antisemitische Erfahrungen im Hinblick auf ihr mögliches Wiederaufleben und die entsprechenden Umgangsstrategien vorsorglich an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Die Auslegung der Rabbiner ist nicht nur ein Raster für das, was den Juden zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Geschichte widerfahren ist, keine bloße Schilderung vergangenen Leids, sondern eine Reflexion über den Ursprung des Phänomens und die Überwindung seiner Folgen für die betroffene Gruppe. Die Rabbinische Literatur möchte die Juden angesichts der möglichen Zukunft zu Akteuren ihrer eigenen Geschichte machen. Außerdem bietet sie eine originelle Lesart von der Psyche des Unterdrückers aus der Perspektive des schutzbedürftigen Verletzlichen. Die Rabbinische Literatur legt weder das Opfer auf sein Leid noch — und das ist sehr viel überraschender — den Henker auf seinen Hass fest, und genau diese Verweigerung der Schicksalhaftigkeit sollten wir uns auch für die heutige Zeit zunutze machen.
Wie deuten die Gelehrten und die traditionellen Texte den gegen sie gerichteten Zorn, der bei ihrem Gegenüber chronische Ausmaße annimmt? Gibt es so etwas wie eine genuin jüdische Reflexion über den Antisemitismus?
Diesen Fragen werden wir in dem vorliegenden Buch nachgehen und uns dafür mit literarischen Quellen beschäftigen. Auch wenn es sich um einen Anachronismus handelt, weil die Rabbinische Literatur fast zwei Jahrtausende älter ist als der im 19. Jahrhundert in Deutschland geprägte Begriff, werde ich den Judenhass im Folgenden als Antisemitismus bezeichnen.
Die jüdische Nicht-Identität
Wo finden sich Anhaltspunkte für einen aufkeimenden antisemitischen Hass in den Texten der jüdischen Tradition? In der Thora, von den Christen Altes Testament genannt, werden keine Ressentiments gegen die Juden erwähnt, und zwar aus dem einfachen Grund, weil gar keine Juden erwähnt werden. Das Volk, von dem die Thora erzählt, nennt sich zu diesem Zeitpunkt hebräisches Volk oder Kinder Israels. Später in der Geschichte sollten sich die Juden auf genau diese beiden Identitäten berufen.
Analysieren wir vorab kurz die Begrifflichkeiten dieser jüdischen Proto-Identität.
Der allererste Hebräer namens Abraham wird in der Stadt Ur geboren, im Land der Chaldäer. Er kommt demnach nicht als Hebräer in seinem Ursprungsland zur Welt, sondern erwirbt sich diese Identität erst, als er der Aufforderung Gottes folgt, das Land seines Vaters und seinen Geburtsort zu verlassen: »Der Herr sprach zu Abram: Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde.« (Genesis 12:1) Er durchquert einen Fluss, der ihm die Richtung in ein gelobtes Land weist, dessen Namen Kanaa er noch nicht kennt.
In der Sprache der Bibel ist der Hebräer (Ivri) wörtlich derjenige, der überquert, der Überquerende. Weil er die Welt seiner Kindheit und seiner Herkunft verlassen hat, nimmt Abraham einen Namen an, der sich auf sein Handeln bezieht, den Namen der Überquerung.
Die hebräische Identität, die sich mit ihm ausbildet, ist folglich mit dem Losreißen aus dem Land der Geburt verknüpft. Sie hat keine eigene Herkunft, keinen Anfang. Ein Ägypter kommt aus Ägypten und ein Grieche aus Griechenland, ein Hebräer aber hat kein namensgebendes Ursprungsland. Sein Name verweist nicht auf die Herkunft, sondern auf den Bruch mit der Herkunft.
So entsteht eine subtile Zweideutigkeit in der Definition der hebräischen und später jüdischen Identität: Der Hebräer ist nicht derjenige, der einem Ort entstammt, sondern derjenige, der seinen Geburtsort hinter sich lässt. Sein Name bezeichnet eine geografische oder geistige Abkoppelung. Odysseus stammt aus Ithaka und sehnt sich nach Heimkehr. Abraham hingegen stammt aus Ur und unternimmt alles in seiner Macht Stehende, um nie wieder zurückzukehren.
Die hebräische Identität interpretiert also ihren Ursprung im Aufgeben dieser Identität, sprich: Sie entwickelt ihre Identität aus der Nicht-Identität mit ihrem Herkunftsort. Das Gelobte Land ist das »Begehren eines Landes, in dem wir nicht geboren worden sind«1, ein Bestimmungsort, der niemals Rückkehr zum Ursprung oder zum Gleichen ist.
Am Anfang steht der Bruch. Diese Idee ist in der unmöglichen Definition des Judentums zentral. Besonders treffend spiegelt sie sich in der Formulierung, mit der Jacques Derrida sein Selbstverständnis des Judentums umschreibt: »Jude wäre ein anderer Name für die Unmöglichkeit, ein Selbst zu sein.«2
Lange nach Abrahams Auswanderung aus Mesopotamien wird das hebräische Volk das abrahamitische Losreißen mit dem kollektiven Auszug aus Ägypten nachspielen, einem Schlüsselmoment seiner Geschichte.
Während Chaldäa Abrahams Vaterland ist, steht die Nilmündung in der Thora für die Gebärmutter des Volkes. Hier vermehrt sich der Legende zufolge Jakobs Samen, bis sich die ägyptische Gebärmutter öffnet.
Die zehn Plagen, die von den Exegeten mit Gebärschmerzen verglichen wurden, lösen die Befreiung aus. Nun teilt sich das Meer, das Volk verlässt sein Land — »Mutter der Welt« — Om El Donya, wie es heute auf Arabisch heißt, und empfängt die Weisung, niemals zurückzukehren. Es macht sich auf den Weg ins Gelobte Land.
Das hebräische Volk wird also in Ägypten geboren, und abermals ist das Gründungselement seiner kollektiven Identität ein Aufbruch, ein Losreißen, das es in einer Nicht-Identität mit dem Ort seiner Geburt existieren lässt.
Ein hinkender Name
Die andere biblische Bezeichnung für das hebräische Volk, das Volk Israels, verweist auf eine erstaunlich ähnliche Geschichte. Der Name Israel taucht in der Schrift im Zusammenhang mit einem weiteren Identitätsbruch auf: Das Buch Genesis erzählt die Geschichte von Abrahams Enkel Jakob, der unterwegs die Nacht am Ufer eines Flusses verbringt, den er überqueren muss. Im Dunkeln ringt er mit einem geheimnisvollen Abgesandten, Mensch oder Engel, der ihm eine Verletzung an der Hüfte zufügt und ihm im Morgengrauen einen merkwürdigen Segen erteilt: »Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel.« (Genesis 32:29)
Dieser in einem Ringkampf erworbene und an Jakobs Nachfahren weitergegebene Name ist folglich kein Herkunftsname, sondern eine kämpfend errungene Identität, die den Preis einer Verletzung am Hüftgelenk fordert und damit ein ewiges Hinken in Kauf nimmt.
Jakob/Israel, seiner Geburtsidentität entrissen, weiß, dass er nie wieder stabil auf beiden Beinen oder »mit beiden Beinen im Leben« stehen wird. Nur im Hin-und-her-Schwingen, in der permanenten Bewegung kann er sich annähernd aufrecht halten. Künftig wird er mal hier, mal dort sein, zwischen zwei Zuständen schwankend, wobei allein das Hin-und-herSchwingen sein Gleichgewicht garantiert. Stets in Bewegung, ist er dazu verdammt, zu werden, um zu sein, und nur im Werden sein zu können.
Die Thora erzählt also die Geschichte der Hebräer und der Söhne Israels als deren Hinauswandern aus der Geografie ihrer Geburt in ein Gelobtes Land, das sie im Laufe des Berichts nie erreichen, aber bis zur letzten Zeile zum Ziel haben.
Von Juden hingegen ist...
| Erscheint lt. Verlag | 17.2.2020 |
|---|---|
| Übersetzer | Nicola Denis |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Réflexions sur la question antisémite |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie |
| Schlagworte | Bewegung • Czollek • deborah • Derrida • Diskriminierung • Faschismus • Feldman • Feminismus • Geschichte • Herkunft • Identitäre • Identitätspolitik • illouz • Judenfeindlichkeit • Judenhass • Judentum • jüdische • Lacan • Legenden • liberales • Literatur • Misogynie • Nationalismus • #ohnefolie • ohnefolie • Rabbinerin • rabbinische • Rassismus • Sartre • Sexismus • Stereotypen • Synagoge • Tenou’a • Vorurteile • weibliche |
| ISBN-10 | 3-446-26736-0 / 3446267360 |
| ISBN-13 | 978-3-446-26736-7 / 9783446267367 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich