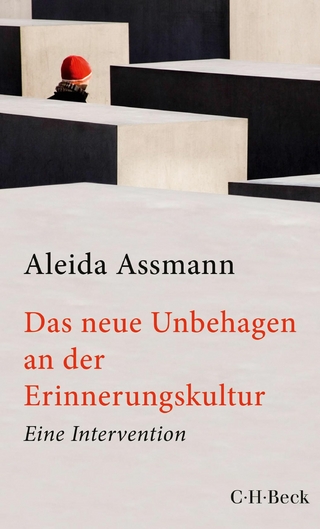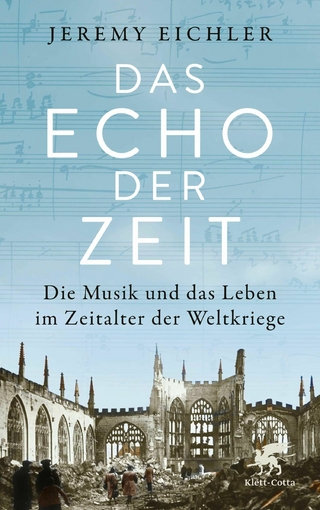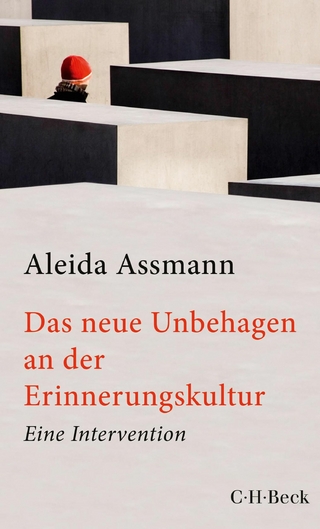Die unbewältigte Niederlage (eBook)
336 Seiten
Verlag Herder GmbH
978-3-451-82323-7 (ISBN)
Prof. Dr. Gerhard Krumeich, geboren 1945, war von 1997 bis 2010 Inhaber des Lehrstuhls für Neuere Geschichte an der Heinrich- Heine-Universität Düsseldorf. Zahlreiche Veröffentlichungen zur deutschen und französischen Zeitgeschichte, insbesondere zum Ersten Weltkrieg und seinen Nachwirkungen; Gründungsmitglied des Historial de la Grande Guerre, Péronne, Mitherausgeber der Documents diplomatiques français zum Versailler Vertrag.
Prof. Dr. Gerhard Krumeich, geboren 1945, war von 1997 bis 2010 Inhaber des Lehrstuhls für Neuere Geschichte an der Heinrich- Heine-Universität Düsseldorf. Zahlreiche Veröffentlichungen zur deutschen und französischen Zeitgeschichte, insbesondere zum Ersten Weltkrieg und seinen Nachwirkungen; Gründungsmitglied des Historial de la Grande Guerre, Péronne, Mitherausgeber der Documents diplomatiques français zum Versailler Vertrag.
Vorwort
Dieses Buch ist keine Geschichte der Weimarer Republik, sondern ein Versuch, der einen neuen Blick auf die deutschen 1920er-Jahre ermöglichen soll. Für mich ist die entscheidende Prägung der Weimarer Republik, dass sie aus dem Krieg geboren wurde und während ihrer gesamten Existenz ein Kind des Großen Krieges blieb.
Die etablierte Weimar-Historiographie hat sich lange, allzu lange, überhaupt nicht für das »Erbe des Weltkriegs« interessiert. Oder, wenn ja, indem sie die Zeitgenossen rügte, weil diese beispielsweise den Frieden von Versailles als »Schandfrieden« angesehen hatten. Nein, so die Auskunft der Historiker, das war in Wirklichkeit doch ein recht vernünftiger Friede. Nur seien leider die Deutschen zu verrückt gewesen, um das einzusehen. Wenige Historiker waren lange Zeit bereit beziehungsweise fähig, anzuerkennen, dass die Belastungen durch den Weltkrieg so schwer waren, dass sie Weimar nahezu erdrückten. Für die großen Geschichten Weimars gilt fast systematisch, dass deren Autoren sich niemals näher mit dem Ersten Weltkrieg befasst hatten, zumindest nicht in wissenschaftlichen Publikationen. Einige wenige Ausnahmen – etwa die Darstellungen von Peter Longerich und Volker Ullrich – bestätigen die Regel. Der Blick war nahezu vollständig auf die Katastrophe von 1933 und die Suche nach deren Gründen fixiert. Die Geschichte Weimars wurde also von ihrem Ausgang und nicht, wie es historisch doch als zwingend erscheint, von ihren Ursprüngen her geschrieben.
In den letzten zwanzig Jahren hat sich diese Situation erheblich verbessert. Heute gibt es eine Reihe von auch international vergleichenden Monografien und Aufsätzen zu den Nachwirkungen der Kriegsgewalt insbesondere bei den Verlierernationen. Gleichwohl, so scheint mir, ist es bislang noch nicht gelungen, sich in die Menschen von damals einzufühlen. Zwar sind die demokratischen Kräfte sehr intensiv gewürdigt worden, nicht aber ihre Gegner.
Meine Ambition ist es, genau diese Lücke ansatzweise zu schließen und einen neuen Blick auf die ungeheure Frustration zu erlauben, die der verlorene Weltkrieg für viele Millionen Deutsche bedeutet hat. Zorn und Hass waren so groß, dass schon öfter von einem »Trauma« gesprochen worden ist. Ich möchte einfach einen Schritt weiter in diese Richtung gehen und versuchen zu zeigen, dass es tatsächlich eine Art kollektives Trauma gegeben hat, das die Republik beherrschte. Nur wenn wir dieses ausloten, werden wir weiterkommen und Weimars Katastrophe historisch einordnen können.
Der Leser wird selbstverständlich darauf verwiesen, auf welche Literatur ich mich stütze, von wem ich am meisten gelernt habe. Hier seien drei Vorläufer genannt. Zunächst Wolfgang Schivelbusch mit seiner vergleichenden Geschichte von Kriegsniederlagen und der »Kultur«, damit umzugehen. Das Buch ist 2001 erschienen und freundlich beurteilt worden, aber ich glaube, dass es seinen Weg in die Handbücher nicht gefunden hat. Vielleicht kam es etwas zu früh, weil eben die heute so breit gestreuten Forschungen zur Nachkriegs-Gewaltsamkeit damals noch nicht vorlagen. Jedenfalls habe ich bei Schivelbusch vieles von dem vorgeformt gesehen und begierig aufgegriffen, was ich nun – hoffentlich – weitergeführt habe.
Dasselbe gilt für das große Werk von Boris Barth über »Dolchstoßlegenden und politische Desintegration«. Boris Barth, wie ich Schüler von Wolfgang Mommsen, hat hier eine (Fast)-Gesamtgeschichte Weimars geschrieben, beginnend mit dem verlorenen Krieg. Aber mir scheint, dass er noch ein wenig vor den Konsequenzen seiner Forschungen zurückgescheut ist, insbesondere was die Brisanz und den realen Kern der »Dolchstoßlegenden« angeht. Ebenso verhält es sich mit dem Buch von Nicolas Beaupré, meinem Kollegen und Freund vom Centre International de Recherche de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne, wo wir diese Fragen oft im internationalen Vergleich diskutiert haben. Seine so verdienstvolle deutsch-französische Geschichte der Nachkriegszeit mit dem Titel Das Trauma des Großen Krieges (2009) hat mir sehr viele Anregungen zur Fortsetzung und Vertiefung gegeben.
Die Fragen, an die ich mich im Folgenden also trotzdem heranwage, sind in der Tat noch vermintes Terrain. Vermint vor allem deshalb, weil ja die Probleme des »Schandfriedens« von Versailles und des »Dolchstoßes« mehreren Generationen akademischer Lehrer seit den 1950er-Jahren dazu gedient hatten, die »Machtergreifung« des Nationalsozialismus zu erklären. Hitler sei erst durch »Versailles« möglich geworden, so hieß es jahrzehntelang, bis die Generation von Wehler und der Mommsens es leid war und nach den tieferen Ursachen der so unheilvollen Entwicklung der deutschen Geschichte fragte. Sie hatten recht und ihre Revision war notwendig. Aber einhundert Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges sollten wir eigentlich politisch unbefangen und frei genug sein, hinter den traditionellen Schutzschilden hervorzutreten und »Versailles« und den »Dolchstoß« verstehend darzustellen. Verstehend? Ja, ohne die alte Furcht, dass Berlin doch Weimar werden könnte.
Ich möchte schlicht die Tatsache ernst nehmen, dass sich für die allermeisten Zeitgenossen, darunter auch die Allerklügsten wie Max Weber oder Ernst Troeltsch und Walther Rathenau, das Kriegsende anders und komplexer darstellte als für uns heutige Historiker. Um aber alle drohenden Kritiker-Kurzschlüsse zu vermeiden: Nein, ich bin nicht der Auffassung, dass Deutschland wirklich »im Felde unbesiegt« war, im Gegenteil. Ich folge exakt den Arbeiten von Wilhelm Deist über den »verdeckten Militärstreik« von 1918 und die Selbstauflösung der deutschen Armee, die Massenflucht der Soldaten aus dem offensichtlich verlorenen Krieg. Wilhelm Deist musste noch in den 1990er-Jahren mit seinen aufklärenden Arbeiten den Schutt der alten Behauptungen über die »im Felde unbesiegte« Armee forträumen – und das ist ihm gelungen! Er wollte endlich die Militärs in die Pflicht nehmen und nachweisen, dass nicht die »Heimat«, sondern die ebenso selbstherrliche wie realitätsferne Oberste Heeresleitung Deutschland die »Suppe eingebrockt« hatte, die die Zivilisten dann auslöffeln sollten – um die inzwischen gut bekannte zynische Äußerung Ludendorffs im Spätherbst 1918 einmal umzudrehen. Doch Wilhelm Deist blieb die Frage ganz fremd, wieso eigentlich so viele Menschen nach 1918/19 überzeugt waren und auf Dauer blieben, dass nicht die Militärs, sondern die Zivilgesellschaft an der Niederlage schuld sei.
Deshalb habe ich mich bemüht, auch die Emotionen und Denkweisen der verschiedenen Lager in der so stark zerklüfteten politischen Kultur der ersten deutschen Republik zu verstehen.
Mein Blick auf Weimar und die Verwerfungen der Weimarer Gesellschaft hat sich aus einer langjährigen Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg ergeben. Aus diesem Grund beginne ich mit dem manchem Leser wohl befremdlich erscheinenden Kapitel über den »fernen Krieg«. Es gilt nämlich zu begreifen, dass die Menschen in Deutschland schwer unter einem Krieg zu leiden hatten, der allerdings ganz woanders ausgefochten wurde, und wie stark deshalb die nie überwundene Kluft zwischen der Kriegserfahrung der Soldaten und der Zivilisten war und blieb. Diese Fremdheit bleibt für mich der Urgrund aller Dolchstoßlegenden.
Aller Dolchstoßlegenden? Ja, man sollte endlich verstehen, dass es keineswegs nur eine Dolchstoßlegende beziehungsweise Dolchstoßlüge gegeben hat. Wenn diese heute dargestellt beziehungsweise auch »illustriert« wird, geschieht dies in den allermeisten Fällen mit Bildern und Begriffen, wie sie die völkischen Gruppen und dann ganz besonders der Nationalsozialismus verwendet haben. Der Dolchstoßtopos besagt gemeinhin, dass die erfolgreich voranstürmenden Soldaten von auf Umsturz dringenden Zivilisten am greifbaren Sieg gehindert worden sind. Und der Zivilist ist natürlich ein jüdischer Kommunist oder kommunistischer Jude, das passt genau in die Verschwörungstheorien, wie sie stets von denen gebraucht werden, die von der Realität überfordert sind.
Doch 1918 und 1919 hat es in der Öffentlichkeit ein sehr viel differenzierteres Bild der Niederlage gegeben. Sogar Hindenburg, dessen Aussage vor dem Untersuchungsausschuss der Nationalversammlung so häufig als Beleg für die krude Version der Dolchstoßlegende zitiert wird, war in Wirklichkeit sehr viel abwägender. Das Heer, so Hindenburg, war bereits »ermattet«, als ihm die Zivilisten die notwendige Unterstützung versagten. Man hätte aber wohl noch eine Weile durchhalten und einen besseren Frieden verhandeln können, wäre die Revolution nicht gekommen. Auch von dieser Auffassung gibt es verschiedene Varianten, aber das Entscheidende ist die damals so heiß diskutierte Frage, ob ohne die Revolution (über deren Notwendigkeit und Berechtigung hier gar nicht diskutiert werden soll!) Deutschland einen besseren Waffenstillstand und dann auch einen besseren Frieden hätte erhalten können.
War denn nun Versailles ein schmählicher oder ein zukunftsweisender Frieden? Ich gestehe, dass ich nach zwanzig Jahren Quellenstudium und manchmal auch heftigen Diskussionen immer noch nicht verstehe, wieso man der Auffassung sein kann, dass dies ein gerechter Friede war, der sogar sehr viele Vorteile für Deutschland gebracht habe. Der Friede war in Wirklichkeit ein Diktat, dessen Unterschrift wie mit vorgehaltener Pistole erzwungen wurde. Die Sieger verhandelten nicht mit dem besiegten Deutschland, und selbstverständlich war der »Kriegsschuld«-Artikel genau wie der gesamte Vertrag eine moralische Herabwürdigung des geschlagenen Deutschlands. Der »Schuld-am-Krieg«-Artikel 231 fügte sich...
| Erscheint lt. Verlag | 7.4.2021 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► 20. Jahrhundert bis 1945 |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Schlagworte | 1920er • 1930er • 1. Weltkrieg • Demokratie • Deutsche Geschichte • Deutschland • Dolchstoßlegende • Erster Weltkrieg • Kriegsende • Novemberrevolution • Revolution • Versailler Vertrag • Weimarer Republik • Zeitgeschichte |
| ISBN-10 | 3-451-82323-3 / 3451823233 |
| ISBN-13 | 978-3-451-82323-7 / 9783451823237 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 8,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich