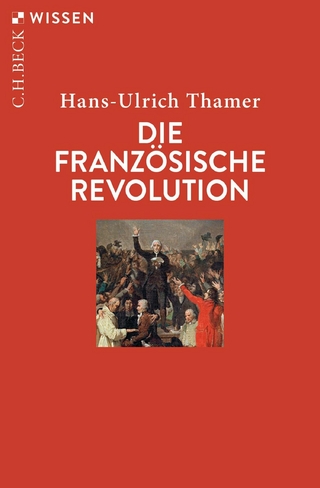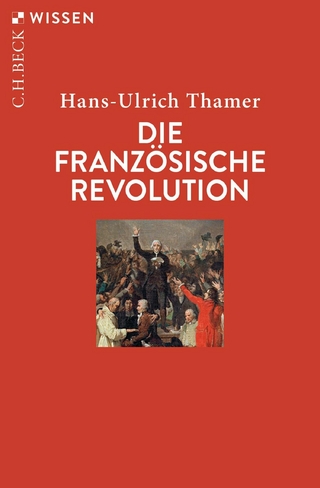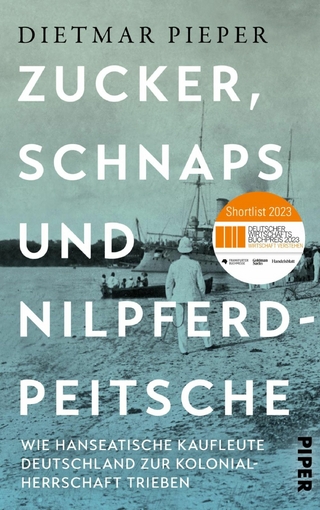Bismarcks ewiger Bund (eBook)
944 Seiten
Theiss in der Verlag Herder GmbH
978-3-8062-4181-5 (ISBN)
Oliver F. R. Haardt studierte am Trinity College der Universität Cambridge Geschichte und promovierte bei Sir Christopher Clark. Danach lehrte er am Magdalene College der Universität Cambridge. Heute wirkt er als freier Autor und Historiker. Seine Arbeit konzentriert sich auf den großen Kulturwandel, der die Welt im 19. und 20. Jahrhundert in die Moderne führte, und hat mehrere bedeutende Preise in Deutschland und Großbritannien gewonnen. Zuletzt erschien von ihm die hochgelobte neue Geschichte des deutschen Kaiserreichs »Bismarcks ewiger Bund«.
Oliver F.R. Haardt arbeitet seit 2017 als Lumley Research Fellow in Geschichte am Magdalene College der Universität Cambridge. Zuvor studierte er ebenfalls in Cambridge am Trinity College Geschichte und promovierte 2017 unter Christopher Clark. Seine Arbeit hat mehrere bedeutende Preise in Deutschland und Großbritannien gewonnen. Seine Forschung konzentriert sich auf die Politik- und Verfassungsgeschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert. Er publizierte in German History und der Historischen Zeitschrift, den beiden führenden Fachjournalen zur deutschen Geschichte. Darüber erschienen Beiträge für mehrere renommierte Sammelbände zum Kaiserreich und der Weimarer Republik, diverse Essays für ein breiteres Publikum, unter anderem zum hundertjährigen Jubiläum der Weimarer Reichsverfassung und in der FAZ.
Einleitung: Bund und Verfassung7
Teil I: Reichsgründung 25
1. Szenen einer Geburt 27
2. Die Legende vom Fürstenbund 101
3. Verfassungsgebung als Realpolitik 181
Teil II: Vom Fürstenbund zur Reichsmonarchie 279
4. Die Erhebung des Kaisers 281
5. Das Schattendasein des Bundesrates 343
6. Der Aufstieg des Reichstages 391
Teil III: Ruhelosigkeit 603
7. Macht vor Recht 605
8. Der Widerstreit der Ideen 687
9. Peripherie und Zentrum 747
Schluss: Der ewige Bund im Strom der Zeit 803
Dank
Anhang 861
Graphen 862
Anmerkungen 870
Literaturverzeichnis 918
Personenregister 942
Kapitel 1: Szenen einer Geburt
Versailles, 21. Januar 1871
Mein Liebling,
ich habe Dir schrecklich lange nicht geschrieben, verzeihe, aber diese Kaisergeburt war eine schwere, und Könige haben in solchen Zeiten ihre wunderlichsten Gelüste, wie Frauen, bevor sie der Welt geben, was sie doch nicht behalten können. Ich hatte als Accoucheur mehrmals das dringende Bedürfnis, eine Bombe zu sein und zu platzen, daß der ganze Bau in Trümmern gegangen wäre.1
Als Johanna von Bismarck diese Zeilen ihres geliebten Gatten las, hielt sie vermutlich für eine Weile verwundert inne. Warum in aller Welt war ihr Ehemann so verstimmt? Eigentlich sollte er diesen Moment doch genießen. Das ganze Reich feierte die Proklamation des Kaisers in Versailles als seinen politischen Sieg. Dieser triumphale Abschluss der vielen, oft umstrittenen Anstrengungen, die er in den letzten Jahren unternommen hatte, machte ihn zum umjubelten „Reichsgründer“. Sein Brief aber war getränkt von Verzweiflung und Wut. Er offenbarte Johanna eine Innenwelt, die mit Glanz und Gloria nichts zu tun hatte. Während der langwierigen Verhandlungen mit den süddeutschen Staaten in Versailles, ja sogar am Tag der Proklamation selbst litt Bismarck unter Gallenschmerzen und verfiel in tiefe Depressionen. Euphorisch war er überhaupt nicht. Er ließ das schlecht zusammengeschusterte Zeremoniell einfach über sich ergehen und war froh, als es endlich vorbei war.2
Warum quälte Bismarck die Reichsgründung so sehr, dass er alle Beteiligten und mit ihnen sein Werk am liebsten in die Luft jagen wollte? Ein Accoucheur, ein Geburtshelfer also, der wie eine Bombe explodiert, würde ja unweigerlich auch das Kind töten, dem er unter großen Mühen auf die Welt geholfen hat. Woher kamen derart zerstörerische Gedanken? Waren sie nur Ausdruck eines cholerischen Temperaments oder hatten sie ihren Ursprung in echten Problemen, die Deutschlands Vereinigung zu einer wahren Qual machten?
Die Reichsgründung war ein dichtes Labyrinth aus unterschiedlichen Optionen, ausgeklügelten Plänen, riskanten Entscheidungen, unglaublichen Zufällen, und improvisierten Lösungen. Wie haben sich diese verschlungenen Pfade auf die föderale Ordnung ausgewirkt, die 1871 geschaffen wurde, um dem neuen Nationalstaat einen strukturellen Rahmen zu geben? Man kann die geschichtliche Bedeutung dieser Frage gar nicht hoch genug einschätzen. Die Gründung des Deutschen Reiches pflügte die politische Landschaft Europas gründlich um. Überall erkannten Beobachter die Tragweite des Moments. „Die deutsche Revolution“, erklärte der britische Oppositionsführer Benjamin Disraeli im Februar 1871 vor dem Unterhaus, sei „ein größeres politisches Ereignis als die französische Revolution des letzten Jahrhunderts“. Der amerikanische Präsident und ehemalige Bürgerkriegsgeneral Ulysses Grant betonte 1871, dass es die USA nun, da es auch in Deutschland einen föderalen Bundesstaat gab, mit einer neuen, günstigeren Lage jenseits des Atlantiks zu tun habe: „Die Errichtung eines amerikanischen Bundessystems in Europa […] kann gar nicht anders als demokratische Institutionen zu fördern und den friedlichen Einfluss amerikanischer Ideale zu verbreiten.“3
Innerhalb Deutschlands wurde die Reichsgründung ebenfalls als epochale Zäsur wahrgenommen. Dabei verknüpften viele Beobachter ihr persönliches Schicksal mit dem der Nation. So schrieb der preußische Geschichtswissenschaftler Heinrich von Sybel, der für die Nationalliberalen im Reichstag saß, an seinen Historikerfreund und politischen Weggefährten Hermann Baumgarten nur wenige Tage nach der Kaiserproklamation: „Wodurch hat man die Gnade Gottes verdient, so große und mächtige Dinge erleben zu dürfen? Und wie wird man nachher leben? Was zwanzig Jahre der Inhalt alles Wünschens und Strebens gewesen, das ist nun in so unendlich herrlicher Weise erfüllt! Woher soll man in meinen Lebensjahren noch einen neuen Inhalt für das weitere Leben nehmen?“ Sybels Euphorie war typisch für liberale Kreise. Die Liberalen litten immer noch unter dem Trauma von 1848, als die bürgerliche Revolution und mit ihr der Versuch, einen deutschen Nationalstaat zu schaffen, grandios gescheitert waren. Nun feierten sie die Gründung des Reiches geradezu als Erlösung. Zwischen dem Fiasko des Frankfurter Paulskirchenparlamentes und dem Erfolg von Bismarcks Einigungspolitik schienen Welten zu liegen.4
Überall spürten die Menschen also, dass sie Zeugen einer Veränderung von historischen Ausmaßen waren. Dieses Bewusstsein bildete den Nährboden für ein außergewöhnliches Phänomen: Historiker begannen, die Geschichte der Reichsgründung zu erzählen, während der Vereinigungsprozess noch im Gang war. In der öffentlichen Debatte über die Einigungskriege und die zukünftige Organisation Deutschlands gehörten Historiker zu den wichtigsten Kommentatoren. Unter ihnen waren viele Nationalliberale, die seit Jahrzehnten für einen deutschen Nationalstaat gekämpft hatten. Besonders aktiv war Heinrich von Treitschke. Seine Schriften richteten sich an ein breites Publikum und behandelten alle möglichen Probleme, die im Rahmen der Neugestaltung Deutschlands auftauchten: von der Reform des Deutschen Bundes über die Rolle der Mittelstaaten bis hin zur Annexion von Elsass-Lothringen. Diese Veröffentlichungen machten ihn zum einflussreichsten deutschsprachigen Historiker der Reichsgründungszeit. Gemeinsam mit Heinrich von Sybel, Johann Gustav Droysen und anderen Vertretern der borussischen Geschichtsschreibung propagierte er ein ganz bestimmtes Bild der Reichsgründung. Die Auflösung der „Märchenwelt des Partikularismus“ und die Schaffung eines kleindeutschen Nationalstaates, so die Borussen, sei die Erfüllung von Preußens historischer Mission, ja der göttlich vorherbestimmte, vorläufige Höhepunkt der deutschen Geschichte.5
Als die Monarchie 1918 zusammenbrach, ging diese teleologische Sichtweise gemeinsam mit den Hohenzollern unter. An die Stelle des preußischen Fixsterns trat ein vielschichtiges Trauma, sich speisend aus den Erfahrungen des kräftezehrenden Krieges, der Scham über die militärische Niederlage, dem Wegfall aller gewachsenen Strukturen und der Empörung über den „Schandfrieden“ von Versailles. Die Geschichtsschreiber der Nation mussten den Gründungsmythos von 1871 neu verorten. Angesichts der Revolution konnte die Bismarcksche Reichsgründung nicht länger der natürliche Ausgang der deutschen Geschichte sein. Andernfalls wäre das Reich nicht zusammengebrochen. Über allem stand nach dem Untergang der „geprägten Form“, wie der Theologe und Kulturphilosoph Ernst Troeltsch in seinen Beobachtungen aus dem revolutionären Berlin resümierte, eine Frage: „Was aber dann?“6
Von dieser Unsicherheit getrieben flüchteten viele Historiker in kontrafaktische Überlegungen. War die Gründung eines kleindeutschen Reiches die einzige Möglichkeit zur Vereinigung Deutschlands gewesen? Hatte Österreich wirklich aus dem Nationalstaat ausgeschlossen werden müssen? Mit solchen Fragen machten vor allem österreichische Historiker wie Raimund Kaindl die Idee einer großdeutschen Alternative wieder salonfähig. Im Laufe der 1920er- und frühen 1930er-Jahre entfaltete diese Vorstellung immer mehr Wirkungskraft. Nationalistisch gesinnte Historiker, allen voran Heinrich von Srbik, instrumentalisierten sie ganz offen, um einen Anschluss Österreichs an das Reich zu propagieren. In der Nazizeit gingen regimetreue Historiker noch einen Schritt weiter. Typisch war die Argumentation einer Rezension, die 1936 in der Historischen Zeitschrift, dem wichtigsten Fachjournal der deutschen Geschichtswissenschaft, erschien. Der Erste Weltkrieg habe als der „dritte und größte der deutschen Einigungskriege […] die völkischen Kräfte geweckt und frei gemacht […] für einen wirklichen deutschen Staatsbau, die unvergänglichen preußischen Werte nach dem Zusammenbruch der preußischen Hegemonialstellung zu deutschen Werten erweitert und die Hindernisse beseitigt für die Wiederherstellung des großdeutschen Reiches“.7
Nach dem Zweiten Weltkrieg musste sich die Debatte über die Reichsgründung wiederum neu erfinden. Die Besatzung und Teilung Deutschlands rückten Fragen nach dem territorialen Umfang des ehemaligen Reiches in den Hintergrund. Ost und West entwickelten ihre eigenen Sichtweisen auf die Reichsgründung. In der DDR waren marxistische Historiker vor allem damit beschäftigt, die Reichsgründung als Moment des Fortschritts oder der Reaktion zu verorten. Eine klare Antwort fanden sie nicht. Das galt selbst für Ernst Engelberg in seiner berühmten Bismarck-Biografie.8
Westdeutsche Historiker versuchten indes, die verschiedenen Handlungsspielräume in der Reichsgründung zu bestimmen. Dadurch erweiterten sie das historiografische Blickfeld. Neben Bismarck und Preußen wurden langsam auch die nationale Volksbewegung, die Mittel- und...
| Erscheint lt. Verlag | 4.12.2020 |
|---|---|
| Verlagsort | Darmstadt |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Neuzeit bis 1918 |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Schlagworte | 18. Jahrhundert • 19. Jahrhundert • Bismarck • Bundesrat • Deutsches Kaiserreich • Deutsches Reich • Deutsch-französischer Krieg • Deutschland • Gründung • Kaiserreich • Napoleon III. • Norddeutsche Bund • Reichsgründung • Reichskanzler • Reichsverfassung • Staatenbund • Verfassung • verfassung des deutschen bundes • Wilhelm II. |
| ISBN-10 | 3-8062-4181-3 / 3806241813 |
| ISBN-13 | 978-3-8062-4181-5 / 9783806241815 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 19,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich