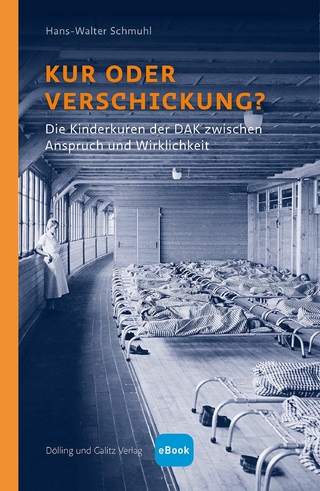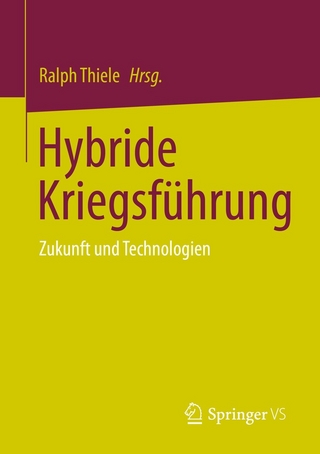Umkämpft, verhandelt, ausgegrenzt (eBook)
186 Seiten
Campus Verlag
978-3-593-45342-2 (ISBN)
Andreas Pilger, Dr. phil., leitet das Stadtarchiv Duisburg und ist Co-Projektleiter des Zentrums für Erinnerungskultur der Stadt Duisburg. Robin Richterich M.A. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Erinnerungskultur der Stadt Duisburg.
Andreas Pilger, Dr. phil., leitet das Stadtarchiv Duisburg und ist Co-Projektleiter des Zentrums für Erinnerungskultur der Stadt Duisburg. Robin Richterich M.A. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Erinnerungskultur der Stadt Duisburg.
Krieg im Gedächtnis der Städte – Warum Dissonanzen zum guten Ton der Erinnerungskultur gehören
Malte Thießen
Dissonanzen sind leicht zu hören. Sie stören die Harmonie und sorgen für Unstimmigkeiten, auch im eigentlichen Wortsinne: als Widerspruch, als Spannung oder als Konflikt zwischen Menschen und Gruppen. Insofern gehören Dissonanzen seit jeher zum guten Ton der Erinnerungskultur. Erinnerungen sind in einem hohen Maße identitätsrelevant. Deshalb wurden und werden sie verhandelt, schärfen sie politische Argumente und öffentliche Auseinandersetzungen.
Mitunter dienen Erinnerungen sogar als Waffe, um Kriege zu begründen. Wladimir Putins Mixtur aus Geschichts- und Geopolitik im Ukrainekrieg 2022/23 bietet ein besonders aktuelles Beispiel für die unheilvolle Tradition eines erinnerungskulturellen Bellizismus. Der russische Präsident sprach der Ukraine mit historischen Bezügen nicht nur ihre Eigenständigkeit ab. Darüber hinaus schrieb er die »Spezialoperationen« in die Tradition des »Großen Vaterländischen Krieges« ein, kämpfe Russland auch im 21. Jahrhundert für die »Befreiung« und »Entnazifizierung« der Ukraine. In diesem Fall nahmen die Dissonanzen der Erinnerungskultur geradezu globale Ausmaße an. Insbesondere in der Ukraine, in Europa und in den USA brachte man die lange Nationalgeschichte der Ukraine als Gegenerinnerung in Stellung. Zudem suchten westeuropäische Politiker*innen und Publizist*innen fieberhaft nach Zeitzeug*innen, die mit ihren Erinnerungen Putins Kritik an der Osterweiterung der NATO abwehren sollten.
Dissonanzen der Erinnerungskultur werden indes nicht erst im Krieg hörbar. Insbesondere in Deutschland war die Konfliktträchtigkeit von Erinnerung auch in Friedenszeiten stets mit Händen zu greifen. Lange Zeit stach der Nationalsozialismus als dissonanter Erinnerungsort besonders hervor. In der Bundesrepublik ebenso wie in der DDR stritt man von Anfang an um die richtige Erinnerung an das »Dritte Reich« und an den Zweiten Weltkrieg. Dieser Streit prägte zunächst deutsch-deutsche Gründungsmythen, später die politische und letztlich sogar die Popkultur. Diese Dauer der Dissonanz mag erstaunen. Ist die Geschichte des Nationalsozialismus nicht irgendwann auserzählt und genug gedeutet? Woher rühren die Dissonanzen selbst bei Themen, die schon unzählige Male diskutiert und gedeutet wurden? Warum geriet beispielsweise der Jahrestag des Kriegsendes, der 8. Mai 1945, in Europa immer wieder zu einem Zankapfel, an dem sich ganze Nationen entzweiten?6 Die Antwort auf diese Fragen ist trivial und schon oft formuliert worden: Erinnerungen drehen sich nicht um Vergangenheit, sondern um die Gegenwart. Die Dissonanzen der Erinnerung erklären sich weniger aus der Konfliktträchtigkeit von Vergangenheit, sondern aus Konfliktlagen und Bedürfnissen der Gegenwart. Erinnerung ist umstritten, weil es in dem Streit um uns selbst und um unsere Sicht auf die Welt geht. Dissonanzen sind damit der beste Beweis, dass Erinnerungen uns alle angehen.
1.Hegemoniale Harmonie: Erinnerungskultur als Problem
Dieser Beweis bereitet heute Sorgen. Denn die Erinnerungskultur zum Nationalsozialismus ist zumindest an der Oberfläche harmonisch geworden. Seit vielen Jahren mahnen insbesondere Gedenkstätten und Vertreter*innen der Geschichtsdidaktik, dass sich die Erinnerung an den Nationalsozialismus in wohlfeile Konsensformeln auflöse. Zwar ist Erinnerungskultur seit jeher ein normatives Koordinatensystem gewesen. Dank ihrer jahrzehntelangen Tradierung ist die Erinnerung an die NS-Zeit heute allerdings besonders vorhersehbar, in moralischen Narrativen tradiert oder schlicht und einfach: oft langweilig. Jens-Christian Wagner, der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, brachte diese Beobachtung vor einigen Jahren treffend auf den Punkt. Seiner Meinung nach verwandle sich Erinnerungskultur in eine »Wohlfühloase«, weil wir uns beim Nationalsozialismus sehr schnell sehr einig seien: »Wir erleben in Deutschland in den letzten 20 Jahren eine Art Wohlfühl-Erinnerungskultur: Wir trauern und identifizieren uns mit den Opfern, bekennen, dass das 20. Jahrhundert ein ganz schreckliches Jahrhundert der Massenmorde gewesen ist – und fühlen uns dann wohl, dass es heute nicht mehr so ist.«7 Der Publizist Stefan Reinecke ging Ende 2020 in einem Beitrag für die »taz« noch einen Schritt weiter. Er konstatierte, dass sich heute »mit NS-Geschichte keine diskursiven Distinktionsgewinne mehr erwirtschaften lassen. Die NS-Zeit […] gilt 2020 als zu Ende erzählt.«8 Die »Alternative für Deutschland« (AfD) und ihre Versuche, den Nationalsozialismus zum »Vogelschiss« umzudeuten, haben den Trend zur Harmonie wohl noch bestärkt. Denn gegen die AfD hat sich eine breite Allianz an Parteien und Gruppierungen zusammengeschlossen, die vor dem Aufstieg der Rechtspopulisten kaum denkbar gewesen wäre. So sehr diese Allianz als Abgrenzung gegen rechts zu begrüßen ist, so sehr befördert auch sie eine allzu harmonische Erinnerung, die wenig Anlass für intensive Debatten oder Impulse für neue Perspektiven auf den Nationalsozialismus bietet.
Die Erinnerungskultur zum Nationalsozialismus ist offenbar Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden. Sie ist mittlerweile sowohl im Geschichtsunterricht als auch in der politischen Kultur fest verankert. Die Gedenkstättenlandschaft kann sich ebenso sehen lassen wie zahllose Angebote und Einrichtungen zur historisch-politischen Bildung. Von der Hitze vergangener Auseinandersetzungen ist heute jedoch nur noch wenig zu spüren. Der Nationalsozialismus ist normal geworden nicht in dem Sinne, dass die einmaligen Verbrechen jemals »normal« erscheinen könnten. Aber die Auseinandersetzung mit dem Thema hat an Schärfe und Intensität verloren. Sie ist bequem, konsensfähig und konfliktfrei. Obgleich das Interesse gerade bei den Jüngeren ungebrochen ist, verliert die Erinnerung an den Nationalsozialismus allmählich an Aufmerksamkeit. Während bis in die 2000er Jahre »Erinnerung als Erregung« und damit als zuverlässige Stichwortgeberin für gesellschaftliche Grundsatzdebatten galt,9 gehören die großen Auseinandersetzungen um den Nationalsozialismus mittlerweile der Vergangenheit an. Selbst die 2020 von Achille Mbembe provozierte Debatte um das Verhältnis zwischen Kolonialismus und Holocaust bestätigt diesen Befund noch.10 Zum großen Aufreger brachte es nicht mehr der Nationalsozialismus, dessen zentrale Stellung in der Erinnerungskultur keine*r der Diskutant*innen infrage stellte. Für Aufregung sorgte allenfalls der Versuch, andere Verbrechen wie jene der Kolonialzeit auf den Holocaust zu beziehen und die etablierte Erinnerungskultur damit um einige Narrative und Akteure zu erweitern.
Auch das mit großen Erwartungen begonnene Gedenkjahr 2020 machte den schleichenden Bedeutungsverlust des Nationalsozialismus sichtbar. Im Nachhinein konnte man den Eindruck gewinnen, dass die großen Events zum 75. Jahrestag des Kriegsendes der Coronapandemie zum Opfer gefallen seien. Doch bereits beim großen europäischen Referenzdatum von 2020, beim »Holocaust-Gedenktag« zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, fiel die Aufmerksamkeit gegenüber früheren Gedenktagen auch ohne Corona zurück. Ein entsprechendes Stimmungsbild zeichnete in diesem Zusammenhang das Unternehmen Policy Matters für »Die Zeit«. Mitte Januar 2020, also immerhin unmittelbar vor dem Holocaust-Gedenktag, hatte das Unternehmen 1.044 Menschen die erinnerungskulturelle Gretchenfrage gestellt und Aussagen zu folgender These erbeten: »75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sollten wir Deutschen einen Schlussstrich unter die Vergangenheit des Nationalsozialismus ziehen.« Eine knappe Mehrheit aller Befragten (53 %) stimmten dieser Frage »voll und ganz« oder »eher zu«, nur ein Fünftel (18 %) aller Befragten stimmten »gar nicht zu«.11 Dass unter den AfD-Anhängern ganze 80 Prozent einen Schlussstrich ziehen mochten, verwundert kaum. Alexander Gaulands berüchtigte »Vogelschiss«-Rede war eben kein rhetorischer Ausrutscher, sondern eine bewusste Bagatellisierung der NS-Vergangenheit mit Blick auf die eigene Klientel. Erstaunlicher ist dagegen, dass der Schlussstrich auch unter Anhänger*innen...
| Erscheint lt. Verlag | 12.4.2023 |
|---|---|
| Co-Autor | Arnd Bauerkämper, Cornelia Chmiel, Jennifer Farber, Lea Fink, Jens Hecker, Robin Richterich, Lenard Suermann, Malte Thießen |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► Zeitgeschichte |
| Schlagworte | AfD • Aufarbeitung • Auseinandersetzung • Claude Lanzmann • Demokratiepädagogik • Denkmal • Denkmäler • Deutschland • Drittes Reich • Erinnern • Erinnerungskultur • Gedenken • Gedenkstätte • Gedenkstätten • Geschichtspolitik • Holocaust • Kommune • Kommunen • Lokalgeschichte • Museen • Museum • Nationalsozialismus • Neonazis • NS • NS-Verbrechen • NS-Vergangenheit • Paul Celan • Regionalgeschichte • Ruhrgebiet • Shoa • Stadtarchiv • Städte • Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus • Walter Benjamin • Zweiter Weltkrieg |
| ISBN-10 | 3-593-45342-8 / 3593453428 |
| ISBN-13 | 978-3-593-45342-2 / 9783593453422 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 5,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich