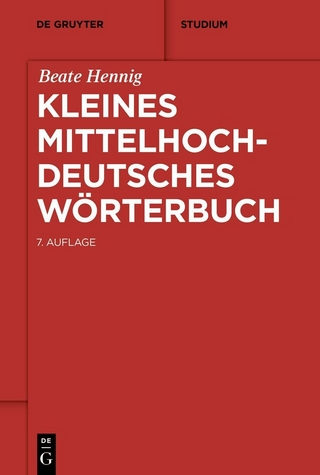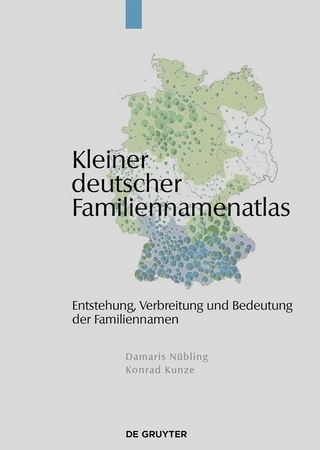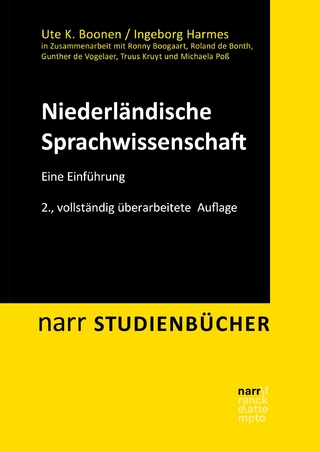Wettkämpfe in Literaturen und Kulturen des Mittelalters (eBook)
273 Seiten
De Gruyter (Verlag)
978-3-11-077501-3 (ISBN)
The series in German medieval studies includes central topics of current research debates in medieval studies and provides a place for groundbreaking research in the field. The series is intended to give international researchers/research teams the opportunity to effectively present innovative surveys and discussions to the scientific community. The series sees itself as a 'young' research forum with a high standard of quality and is therefore also open to excellent degree theses, should they enhance the series.
Bent Gebert, Universität Konstanz.
I Differenzen
Topologie des Spielens Zur Eskalation eines Brettspiels im Welschen Gast
Im Brettspiel wird zweifellos anschaulich, was Erving Goffman eine „zentrierte Versammlung“ genannt hat.1 Die Spieler befinden sich in physischer Gegenwart der anderen. In den Spielmaterialien haben sie einen gemeinsamen „visuellen und kognitiven Brennpunkt der Aufmerksamkeit“,2 ihre Handlungen und wechselseitigen Beobachtungen sind verwoben. Mit ‚Zentrierung‘ ist also keine nur geistige Fokussierung, sondern eine körperliche Ausrichtung auf die Spielmaterialien und ein durch das Spiel geregelter Kontakt gemeint. Für die Dauer der Partie wird eine Richtung nach innen von einer Richtung nach außen unterschieden. Ich möchte diese ‚Topologie des Spielens‘, die sich mit dem grundlegenden Dispositiv eines Brettspiels verbinden lässt, zunächst allgemein skizzieren, bevor ich ihre Ausgestaltung und Überschreitung am historischen Fallbeispiel betrachte.
I Spielfeld, Spielerunde und Off des Spiels
Die Spieler sitzen in einem Zwischenraum: Innen, im Zentrum, befinden sich Materialien, deren kontingente Konstellationen in einem mehr oder weniger artikulierten Feld im Fokus der Aufmerksamkeit stehen und eine Quelle des Streits bilden. Außen, im Übergang zum Off des Spiels, kann die Anteilnahme möglicher Zuschauer abnehmen und die Indifferenz gegenüber dem Spielgeschehen wachsen. In gewisser Weise bleiben aber auch die Regeln des Spiels indifferent gegenüber den konkreten Entscheidungen, die in der Partie getroffen werden. Regeln geben Wahlmöglichkeiten vor, ohne die Entscheidung über Sieg oder Niederlage direkt zu treffen. Mit der Topologie des Spielens sind somit drei verschachtelte Zonen zu unterscheiden, die jeweils widersprüchlich charakterisiert sind:
-
das innere Spielfeld, das kontingente Konstellationen festhalten kann;
-
die durch Konsens und Konflikt charakterisierte Spielerunde als Zwischenzone;
-
das durch Exklusionsregeln geprägte Off des Spiels mit Akteuren, die mehr oder weniger unbeteiligt sind, mit Dingen, die nicht ins Spiel kommen sollen, und Regeln, die gültig bleiben. In einer weniger terminologisch anmutenden Sprache kann man das Off auch einfach den Spielraum nennen, der Spielerunde und Spielfeld verklammert, wobei das Spielfeld in der Spielerunde und die Spielerunde im Spielraum enthalten ist.
Die Spielerunde ist eine zeitweilige Sphäre der Aktivität, die aus dem „gewöhnlichen“ Leben heraustritt.3 Sie kann als räumliche Zwischenzone in Segmente aufgeteilt sein, die für unterschiedliche Richtungen des Zugriffs auf das Feld stehen, sodass Zugregeln spezifiziert werden können und die Partie durch ein Hin und Her charakterisiert ist.4 Aus räumlichem Konsens, der gemeinsamen Ausrichtung auf das Feld, wird damit ein räumlicher Konflikt, der Zug in verschiedene Richtungen. Die Segmente der Spielerunde können aber auch für unterschiedliche Phasen im Ablauf der Zeit stehen. Ich greife die Doppeldeutigkeit des Begriffs ‚Spielerunde‘ auf und beziehe ihn sowohl auf die räumliche Zentrierung als auch auf die Bildung von zeitlichen Perioden und Phasen des Spiels. So werden bei Wettrennen ‚Runden‘ gezählt und damit auch das reguläre Ende des Wettkampfes bestimmt. Im Brettspiel bezeichnet Runde meist die Periode, in der alle Spieler einmal am Zug waren. Es ist üblich, über die Sitzordnung festzulegen, in welcher Reihenfolge Teilnehmer das Zugrecht erhalten. Solange das Feld nach den Regeln des Spiels transformiert wird, bildet die Runde eine seriell wiederholte Einheit, aus deren Variation sich der Verlauf der Partie zusammensetzt.
Zu beachten ist, dass die Körper der Spieler an allen Zonen Anteil haben. Sie sitzen nicht nur in der Spielerunde und nehmen dort verschiedene Positionen ein, sondern sie greifen auch Zug um Zug ins Feld ein. Spieler können die Position der Materialien im Feld verändern, ohne die eigene Position in der Runde aufgeben zu müssen. Im geregelten Kontakt mit den Materialien sondern sie das Spielfeld überhaupt erst von der Spielerunde ab. Doch auch das Off des Spiels kann nur wirksam werden, wenn sich die Spieler aktiv abwenden und etwas von der Partie fernhalten, was in ihrem Rücken liegt und für die Dauer der Partie ‚außen vor‘ bleiben soll.
Gregory Bateson hat das Spiel als einen meta-kommunikativen Rahmen charakterisiert, in dem leicht paradox signalisiert werden muss, dass Handlungen nicht bis zum bitteren (oder süßen) Ende durchgezogen werden müssen. Das, was sie im Ansatz zu bezwecken scheinen, ist nicht wirklich gemeint. Zwischenschritte können ohne Konsequenz bleiben.5 Ein solcher Rahmen, in dem sich der Wettstreit z. B. nicht zu blutigen Auseinandersetzungen auswachsen muss, materialisiert sich im begrenzten Feld und den kleinen Materialien eines Brettspiels von Anfang an. Das Brettspiel ist eine Gattung, in der Konflikte modellartig simuliert und aus einer Quasi-Außenperspektive kontrolliert werden können. Und doch sind die Ordnung und Symmetrie, die mit der ersten Aufstellung von Figuren verbunden sind, meist nicht das eigentliche Ziel des Spiels. Mit dem Fall von Würfeln und dem Mischen von Karten wird die Mitte planmäßig für Kontingenz und Chaos geöffnet. So kann offenbleiben, was die Spieler eigentlich wollen: Chaos stiften, um Ordnung herzustellen, oder Gleichgewichte schaffen, um sie in die Asymmetrie von Gewinn und Niederlage kippen zu können.6
So ist auch die Spielerunde durch eine widersprüchliche Überlagerung von Konsens und Konflikt geprägt. Die Spieler sitzen gemeinsam am Tisch und einigen sich auf Regeln, im Spielfeld kämpfen sie jedoch meist als Parteien gegeneinander. Viele Paradoxien bündeln sich in der Konstruktion von Spielern, die ihre Identität über das Spiel hinaus behalten und in neue Partien mitnehmen können. Sie müssen, wie Bateson betont, bereits in der Partie signalisieren, dass ein Teil von ihnen außerhalb des Spiels bleibt und dass sie aus der Partie aussteigen und zu anderen Spielen und Regeln übergehen können, ohne ihre Identität zu verlieren. So wissen die Spieler am Ende vielleicht selbst nicht mehr genau, ob sie vor allem diese eine Partie gewinnen, oder einfach nur wiederholt spielen wollen.
Auch das Off – oder der Spielraum – ist doppelt charakterisiert und bleibt bereits in der räumlichen und zeitlichen Verortung unsicher: als etwas, was nicht zum Spiel gehört, scheint die Instanz vor allem im Rücken der Spieler zu liegen. Als Regel, die festlegt, was im Austausch von Spielfeld und Spielrunde relevant ist, und zugleich Zugmöglichkeiten und Spielräume offen lässt, dringt sie jedoch tief ins Innere des Spiels und seine Gegenwart ein und verbindet die getrennten Sphären Feld und Runde. Der Spielraum ähnelt dem Grund, der im Hervorbringen einer Figur verschwindet.7
Der Spielraum verklammert Spielrunde und Spielfeld, indem festgelegt wird, was im Spielfeld nicht passieren darf, ohne dass Runde und Partie dadurch abgebrochen werden müssten.8 Eine frühe Grundregel des Brettspiels besteht z. B. darin, dass die Spieler abwechselnd ziehen. Mit der doppelten Negation („Es ist nicht erlaubt, dass ein Spieler wiederholt zieht, ohne dass sein Mitspieler am Zug war“; oder: „es kann nicht sein, dass die Partie nach einem Doppelzug nicht abgebrochen wird“) wird festgeschrieben, was – bei allen Wahlmöglichkeiten – geschehen muss, wenn die Partie fortgesetzt werden soll.
Mit dem Off sind Regeln der Irrelevanz verbunden, die für eine stark selektive Wahrnehmung des Feldes durch die Spielerunde sorgen.9 Die Spieler sehen über das hinweg, was im Feld und in der Spielerunde nach den Regeln keinen Unterschied machen soll, zum Beispiel das leichte Zurechtrücken einer Figur. Natürlich kann es zur Quelle des Streits werden, ob ein Spieler die Figur berührt hat (und damit führen muss) oder nur zurechtgerückt hat. Der Spielraum nistet sich also auch im Feld und in der Spielerunde ein. Er lässt sich nicht auf eine räumliche Zone reduzieren, die die Spielerunde als isolierbare Wirklichkeit von außen einfasst, sondern ist auch eine Art gemeinsame Vergangenheit aller Teile und Teilnehmer des Spiels, aus dem die Zwänge und Wahlmöglichkeiten erwachsen.
Das Verhältnis von Spielraum und Spielerunde hat ein ebenso destruktives wie kreatives Potential. Die Partie kann aus dem Spielraum heraus aufgebrochen werden, der geregelte Kontakt zwischen Feld und Runde zusammenbrechen und ein offener Konflikt den Konsens dominieren. Die Partie kann sich aber auch im Konsens entwickeln, durch neue Regeln erweitert oder eingeschränkt werden.10 Dieses Wechselspiel von destruktiven und kreativen Partieverläufen...
| Erscheint lt. Verlag | 6.3.2023 |
|---|---|
| Reihe/Serie | ISSN | Trends in Medieval Philology |
| Zusatzinfo | 1 b/w and 6 col. ill. |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Germanistik |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Literaturwissenschaft | |
| Schlagworte | chivalric romance • Competition • Duel • Eilhart von Oberg • Eilhart, von Oberg • Hartmann von Aue: Erec • Hartmann, von Aue: Erec • Heinrich • Heinrich, von Veldeke: Eneasroman • Heinrich, von Veldeke: Eneas Romance • Höfischer Roman • invective poems • Legende • Legends • Märe • Märe (myths) • Mediävistik • Medieval Studies • streitgedicht • Thomasin, von Zerklaere: Der welsche Gast • Thomasin von Zerklaere: Der welsche Gast (The Italian Guest) • von Veldeke: Eneas Romance • Wettkampf • Zweikampf |
| ISBN-10 | 3-11-077501-8 / 3110775018 |
| ISBN-13 | 978-3-11-077501-3 / 9783110775013 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich