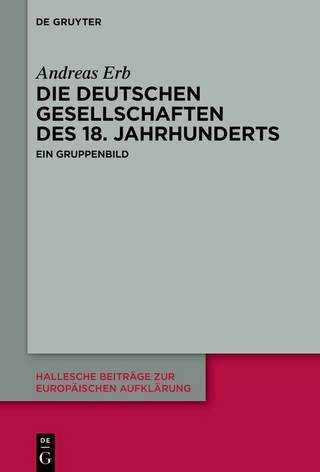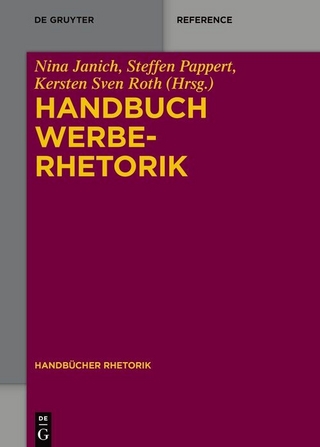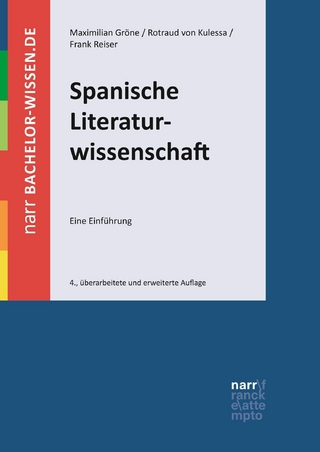Künstliche Intelligenz und Rhetorik (eBook)
331 Seiten
De Gruyter (Verlag)
978-3-11-119989-4 (ISBN)
Wer unsere heutige Medienwirklichkeit verstehen will, kommt nicht umhin, sich mit den Technologien rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Algorithmen auseinanderzusetzen. Folgerichtig hat sich in jüngerer Zeit innerhalb der Geistes- und Kulturwissenschaften ein Forschungsstrang entwickelt, der diese Technologien - zumeist aus kritisch-interventionistischer Perspektive - ins Zentrum rückt.
Die vorliegende Arbeit widmet sich dagegen 'postkritisch' und 'bottom-up' den gesellschaftlichen Selbstbeobachtungen im Hinblick auf die KI-Technologien im öffentlichen Diskurs und entwickelt für deren Erforschung das Programm einer Medienkulturrhetorik. Dieses Programm bringt Kulturwissenschaft und Rhetorik zusammen, um die Handlungsmöglichkeiten spätmoderner Subjekte im 'KI-Zeitalter' zu ergründen, und wird im Rahmen einer empirischen Fallstudie zur massenmedialen Berichterstattung über KI und der Auseinandersetzung mit ebendieser in den sozialen Medien am Beispiel Facebook erprobt.
Anspruch dieser Untersuchung ist es, sowohl einen Beitrag zur Weiterentwicklung kulturwissenschaftlicher Methodologie als auch für ein tieferes Verständnis unserer Kulturen zu leisten und dabei zugleich Anknüpfungspunkte für die (didaktische) Praxis zu bieten.
1 Einleitung
How are we free when we let algorithms take control?1 lautet eine Zeile des Songs Followers des niederländisch-amerikanischen Duos Area21 aus dem Jahr 2021, in dem die Beschränkungen des Selbst in der gegenwärtigen, von sozialen Medien geprägten, Lebenswirklichkeit reflektiert werden. Eine beiläufige Frage, wie sie in vielen anderen popkulturellen und massenmedialen Erzeugnissen aufgeworfen werden könnte und wird – in Filmen, Romanen, Zeitungsartikeln, Social-Media-Postings. Sie dreht sich um die Figur des Algorithmus und instanziiert zugleich eine Wahrheit über ebendiese: Wir Menschen haben Algorithmen die Kontrolle über unsere Freiheit übernehmen lassen. Spannend ist daran, dass ein vormals insbesondere in mathematischen und informatischen Kontexten vorkommender Begriff wie der des Algorithmus mittlerweile auf eine Weise in den öffentlichen Diskurs migriert ist, dass er in scheinbar unbedeutenden symbolischen Versatzstücken wie demjenigen eines beliebigen Musikstücks en passant eingestreut wird, voraussetzend, dass die Rezipienten2 damit etwas anfangen können. In solchen Versatzstücken findet sich somit ein Hinweis darauf, dass „der“ Algorithmus zu einer Deutungskategorie spätmoderner Gesellschaften geworden ist, die es zu examinieren gilt. Eng damit verbunden ist der oftmals im selben Atemzug genannte Begriff der Künstlichen Intelligenz (KI).
KI-Anwendungen sind heutzutage geradezu omnipräsent und finden sich in mannigfaltigen Alltagsbereichen: In der Arbeitswelt werden neben einfachen Arbeitsaufgaben zunehmend auch komplexere Tätigkeiten durch KI übernommen wie etwa das (kreative) Schreiben oder das Lösen juristischer Fälle. In der Freizeit werden Kaufentscheidungen (z. B. Amazons Empfehlungs-Algorithmus), Restaurantbesuche (z. B. Bewertungsportale wie TripAdvisor oder Yelp), aber auch Wissensbestände (zu denken wäre an Wikipedia oder Google) zunehmend durch KI-Systeme figuriert. Algorithmen werden die neuen „Gatekeeper“ von Verlagen, Beethovens unvollendete 10. Sinfonie wird durch KI „vollendet“3. In der Kriegsführung wird auf „intelligente“ Drohnen, in der Medizin auf „intelligente“ Diagnostikverfahren vertraut. Die immense Bedeutungszunahme von KI-Technologien in den letzten Jahren schlägt sich nicht nur implizit in beiläufigen Songzitaten nieder, sondern auch explizit in der öffentlichen Diskussion. Über die (Un-)Möglichkeitspotenziale von KI und Algorithmen wird leidenschaftlich debattiert. Elon Musk und Mark Zuckerberg stehen paradigmatisch für den Streit um die Zukunft der Menschheit im Lichte Künstlicher Intelligenz, zwischen Dystopie und Utopie.4
Ein Blick in die Mediengeschichte lehrt, dass neue5 Technologien stets von Aneignungspraktiken begleitet werden, die über den Erfolg der Technologie und die Art von deren Implementierung entscheiden. Die Form des Mediums präfiguriert zwar bestimmte Nutzungsweisen, determiniert diese jedoch nicht. Was mit einem Medium geschieht, ist technologisch nicht vollends kontrollierbar, sondern zeigt sich erst im komplexen Wechselspiel von Kultur und Technologie, Subjekt und Objekt, Materie und Diskurs.6 Das „Neue“ und Gegenwärtige scheint dabei stets das Exzeptionelle, das Singuläre, zu sein, das mit seinem disruptiven Potenzial diesmal alles radikal verändert. So verhält es sich gegenwärtig auch mit KI, die diskursiv als revolutionäres „Agens“ heraufbeschworen wird.7 Mit dem sogenannten Deep Learning, einer Unterform des maschinellen Lernens (vgl. dazu S. 51), wurden in den letzten Jahren immense Fortschritte im Hinblick auf die Automatisierung, mithin Autonomisierung, komplexer Prozesse erzielt, die diese Diskussionen beflügeln. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass im Diskurs getätigte Aussagen über KI-Technologien nicht allein konstativen, sondern auch performativen Charakter haben. Mit anderen Worten: Die Rhetoriken8, die sich um die KI-Technologien formieren, sind selbst bedeutsam, insofern sie die Gegenwart und Zukunft unserer Kultur(en) nicht nur beschreiben, sondern mitgestalten.
Das Stichwort Kultur(en) ist gefallen – genuiner Forschungsgegenstand der Kulturwissenschaften. Kulturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler haben es sich zur Aufgabe gemacht, gegenwärtige Kultur(en) in all ihren Facetten zu erforschen. Wenn Kultur(en) dabei heutzutage nur als Medienkultur(en) zu begreifen sind, KI-Technologien die aktuellen Medien maßgeblich prägen, womöglich selbst als neue Medien zu verstehen sind9, und deren Transformationskraft von den Kräften des Diskurses nicht zu trennen ist, dann führt für die Kulturwissenschaften10 kein Weg daran vorbei, sowohl KI-Technologien als auch deren Diskursivierung und Rezeption zu untersuchen. So haben sich die Kulturwissenschaften in den vergangenen Jahren auch vermehrt der Erforschung Künstlicher Intelligenz gewidmet, sodass ein disperser Forschungsstrang entstanden ist, der unter dem Begriff der Critical Algorithm Studies firmiert (vgl. S. 56). Im Vordergrund steht dabei die kritische Frage, welchen Einfluss KI-Technologien, insbesondere festgemacht an der Figur „des“ Algorithmus, auf unsere Gesellschaften haben und wie damit umgegangen werden kann. Es geht um Echokammern und algorithmische Opazität, die Überwachung und „Algorithmisierung“ des Subjekts, die Verwandlung der Gesellschaft in eine „Numerokratie“ und das diskriminierende (wie etwa rassistische und sexistische) Potenzial der Technologien.11
Diese Studien, die als Pionier-Studien ein vormals exklusives Feld aus den MINT-Disziplinen der kulturwissenschaftlichen Forschung zugänglich machen, werfen ein Licht auf die Restriktionen und bedenklichen Tendenzen, die mit den KI-Technologien einhergehen und ebnen damit den Weg, als Gesellschaft zu intervenieren. Doch auch sie können sich nicht der Performativität und Selbstrekursivität ihrer eigenen Sprechakte entziehen, sodass Forscher wie Nick Seaver (2017) und Tarleton Gillespie (2017) vor akademischen Erzählungen warnen, die ein spezifisches Bild „des“ Algorithmus zementieren, das gleichermaßen mit Vorstellungen im öffentlichen Diskurs intraagiert.12 Sie rufen dazu auf, sich den Praktiken, Narrativen und Diskursen rund um die Technologien bottom up, d. h. empirisch, zu widmen, um sich so einem holistischen Verständnis gegenwärtiger „Algorithmuskulturen“ annähern zu können. Die vorliegende Arbeit knüpft an dieses Desideratum an, indem sie das zum Forschungsgegenstand macht, was hier als Rhetoriken Künstlicher Intelligenz bezeichnet wird. Von Rhetoriken im Plural zu sprechen bedeutet, dass diskursive Versatzstücke rund um KI-Technologien aufgespürt werden sollen, die sodann von der Warte der Kulturwissenschaft und der Wissenschaft der Rhetorik aus perspektiviert werden.
Dafür wird im Kapitel 2. Grundzüge des kulturwissenschaftlichen Programms einer Medienkulturrhetorik – Disziplinäre und theoretisch-methodologische Verortung in einem ersten Schritt ein medienkulturrhetorisches Forschungsprogramm entworfen. Da die Kulturwissenschaft als akademische Disziplin im Singular noch verhältnismäßig jung ist, wird zunächst die disziplinäre Ausgangsposition dieser Arbeit erläutert. Kulturwissenschaft, so das hiesige Verständnis, lässt sich nicht anhand eines spezifischen Kanons fixieren; kulturwissenschaftlich zu arbeiten heißt gleichzeitig auch immer, diese Disziplin ein Stück weit selbst (fort) zu schreiben, wie ein Detektiv (Vidal, vgl. dazu S. 13f.) nicht nur nach empirischen, sondern auch nach akademischen Spuren zu suchen, mit denen sich der Wunderkammer Kultur (Goldstein, vgl. dazu S. 13) angenähert werden kann. Die Rhetorik wird dann in gewisser Weise zur flankierenden Querschnittsdisziplin, die alles zusammenhält und vor Beliebigkeit und Willkür schützt: Denn, mit der Wissenschaft der Rhetorik gesprochen, wird es stets um das intersubjektiv Persuasive gehen, an dem sich alles Konstatierte messen lassen muss.
Im Unterkapitel 2.1 Medien – Kultur – Medienkultur(en) werden die Grundbegriffe Medien, Kultur und Medienkultur(en) genauer examiniert, da sie die Grundlage dieser Arbeit bilden, auf deren Hintergrundfolie der spezifische Forschungsgegenstand erst in den Blick genommen werden kann. Die Arbeit stützt sich auf einen engen „technischen“ Medienbegriff, wie ihn auch der Medienwissenschaftler Michael Klemm (vgl. dazu S. 16) verwendet, und orientiert sich sodann am „Koblenzer“ Kulturbegriff, da mit dessen fünf Dimensionen die Essenzialien von Kultur grundsätzlich erfasst werden, ergänzt diesen jedoch explizit um Aspekte der kulturwissenschaftlich (aktuell) bedeutsamen Strömungen des Poststrukturalismus und Posthumanismus. Daraus ergibt sich, zusammengeführt, das spezifische Verständnis gegenwärtiger Medienkultur(en) als Ausgangsbasis der weiteren Explorationen.
Das Unterkapitel 2.2 Rhetorik – Medien – Medienrhetorik setzt sich im Anschluss daran mit den Begrifflichkeiten und Disziplinen der Rhetorik und Medienrhetorik auseinander. Hier gilt es insbesondere herauszuarbeiten, wie sich unser Alltagsverständnis von Rhetorik, das mitunter von den...
| Erscheint lt. Verlag | 4.10.2023 |
|---|---|
| Reihe/Serie | ISSN | Rhetorik-Forschungen |
| Zusatzinfo | 1 b/w and 156 col. ill., 1 b/w tbl. |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Literaturwissenschaft |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Sprachwissenschaft | |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Technik | |
| ISBN-10 | 3-11-119989-4 / 3111199894 |
| ISBN-13 | 978-3-11-119989-4 / 9783111199894 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 11,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich