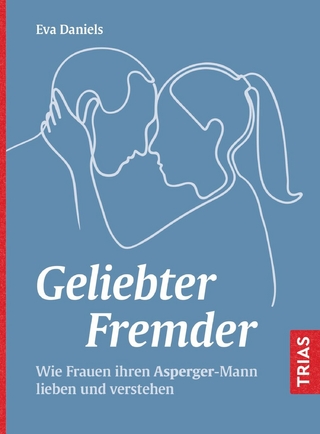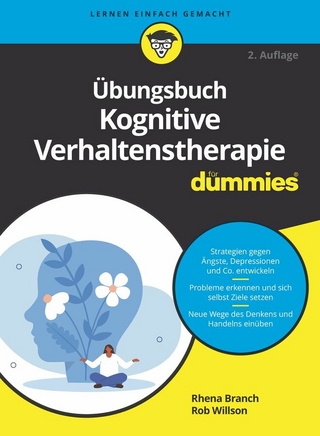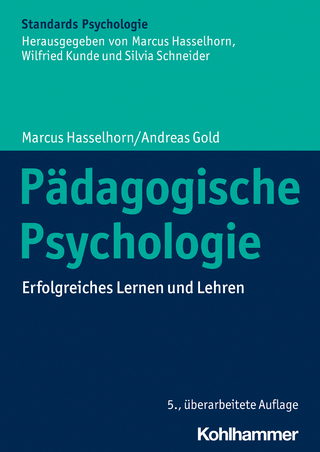Schriftspracherwerb (eBook)
171 Seiten
Kohlhammer Verlag
978-3-17-043542-1 (ISBN)
Prof. Dr. phil. Ulrich Mehlem war bis 2022 Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Literalität und einwanderungsbedingte Mehrsprachigkeit an der Goethe-Universität Frankfurt.
Prof. Dr. phil. Ulrich Mehlem war bis 2022 Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Literalität und einwanderungsbedingte Mehrsprachigkeit an der Goethe-Universität Frankfurt.
2 Schriftspracherwerb und Literalität
2.1 Die kommunikativen, kognitiven und grammatischen Aufgaben des Schriftspracherwerbs
Lesen und Schreiben zu lernen steht in einem engen Zusammenhang mit der Ermöglichung von Teilhabe an einer Gesellschaft, die in hohem Maße durch schriftliche Kommunikation charakterisiert ist. Diese neue Form der Kommunikation ist auch durch einen anderen Sprachgebrauch gekennzeichnet, den Kinder zusammen mit dem neuen Medium der Schrift lernen müssen. Lesen und Schreiben lernen im Anfangsunterricht steht also im größeren Kontext des Erwerbs literaler Fähigkeiten. Der Begriff der Literalität, der sich mittlerweile in Deutschland als Übersetzung des englischen Terminus ›literacy‹ durchgesetzt hat, bezeichnet individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit geschriebener Sprache (Handlungsaspekt) in einem engen Zusammenhang mit spezifischen gesellschaftlichen, historischen und kulturellen Voraussetzungen. Von zentraler Bedeutung sind hierbei soziale Praktiken, in denen diese Fähigkeiten erworben bzw. eingesetzt werden (Kulturaspekt). Der Begriff erfasst schließlich auch Besonderheiten der verwendeten sprachlichen Formen und Strukturen der geschriebenen Sprache (Strukturaspekt, vgl. Feilke, 2011, 2016). Nach einigen einführenden Überlegungen zur kulturellen Bedeutung der Schrift werden in diesem Kapitel daher die materiellen und medialen Dimensionen des Schriftgebrauchs ( Kap. 2.2), ihre kulturelle und kommunikative Bedeutung ( Kap. 2.3) und schließlich die strukturellen Besonderheiten geschriebener Sprache ( Kap. 2.4) vorgestellt. Es schließt sich ein einfaches, vom Autor entwickeltes Analyseraster an, mit dessen Hilfe der Grad der Literalität eines Textes ermittelt werden kann ( Kap. 2.5). Das Kapitel schließt mit einer Klärung der für diesen Lernbereich einschlägigen Kompetenzen ( Kap. 2.6) und den Aufgaben ( Kap. 2.7).
Erkenntnisse der Psychologie und der Soziolinguistik haben dazu beigetragen, dass der Begriff des Schriftspracherwerbs den des Erstlesens/Erstschreibens im Anfangsunterricht ersetzt hat. Damit wird auch die Aufgabe eines neuen Spracherwerbs deutlich, der den bisherigen, mündlichen Spracherwerb auf eine neue Stufe hebt. Ein Klassiker der modernen Psychologie, Lev Semjonowitsch Vygotskij, hat diesen Prozess tatsächlich als zweiten Spracherwerb bezeichnet und ihn mit dem Übergang von der Arithmetik zur Algebra in der Mathematik verglichen (Vygotskij, 2001, S. 315). Der Deutschdidaktiker Hubert Ivo spricht davon, wie der »gewachsene Schnabel« der Volkssprache durch die Schriftlichkeit »unter die Herrschaft der Grammatik gerät«, an der sich »[…] Rechtlautung, grammatische und lexikalische Korrektheit sowie Rechtschreibung« ausrichtet (Ivo, 1999, S. 71).
Dem steht seit der Reformpädagogik vor gut 120 Jahren eine verbreitete Auffassung gegenüber, die das Lesen und Schreiben lernen möglichst eng an die Sprache des Kindes anschließen möchte, also die Zumutungen des formalen Sprachunterrichts vermeiden oder noch möglichst lange aufschieben möchte. Lesen und Schreiben lernen wird dann häufig verkürzt auf die bloße Umsetzung gesprochener Sprache in Schrift statt der Aneignung neuer sprachlicher Formen der Kommunikation, eines neuen Registers.
Solche Vorbehalte gegenüber der Schrift durchziehen die Jahrtausende seit ihrer Entstehung. Einer der einflussreichsten Stichwortgeber für die spätere – auch pädagogische – Kritik ist Platon. In seinem Dialog Phaidros (Platon, 2013, 274e, 275a) greift Sokrates auf einen ägyptischen Mythos zurück, wonach die Schrift von dem Gott Theut erfunden wurde. In dem Dialog mit dem Gott lässt er den Pharao argumentieren: Durch die Möglichkeit, Erinnerungen in sprachlicher Form aufzubewahren, werde gerade nicht das Gedächtnis der Menschen verbessert, sondern ihre Vergesslichkeit gefördert. Hieran schließt Sokrates seine eigene Kritik: Die schriftlichen Zeugnisse seien im Vergleich zu einem wirklichen Gespräch nur tote Zeichen, deren Aussage immer dieselbe bleibe und die die Fragen ihrer Leser nie beantworten würden.
Hier wird – ganz im Sinne der späteren Pädagogik – die Unmittelbarkeit der Beziehung von Lernendem und Lehrendem, die Möglichkeit eines echten Dialogs zwischen beiden, in dem gemeinsam auch neue Fragen gestellt und beantwortet werden, gegen die Erstarrung eines schriftlich überlieferten Textes ausgespielt, mit dem eben keine Beziehung, kein lebendiger Austausch möglich sei (Mehlem, 2018).
So richtig das Insistieren auf der Beziehung und dem Dialog für das Lernen ist, so unverzichtbar stellt sich aus heutiger Sicht die schriftliche Überlieferung nicht nur für Bildungsprozesse, sondern für das Funktionieren der Gesellschaft insgesamt dar. Die Entlastung des Gedächtnisses durch schriftliche Dokumente bedeutet eben nicht, dass weniger gedacht, sondern dass der Fokus auf andere Denktätigkeiten gerichtet wird. Es kommt zu einer Überwindung räumlicher und zeitlicher Grenzen der Kommunikation, die in keinem Verhältnis mehr zu den unmittelbaren Beziehungen im Sinne eines signifikanten Anderen (Mead, 2013) steht.
Vor allem aber ist die These, dass ein Text nur immer dasselbe sagt, klar zurückzuweisen. Bedeutende Texte der Menschheitsgeschichte wurden tatsächlich von jeder Generation immer wieder neu gelesen, so dass sie auch immer wieder neue Fragen beantworten konnten, die für ihre damaligen Autor*innen überhaupt keine Rolle gespielt hatten. Um aber Antworten auf solche Fragen zu bekommen, muss ein*e Leser*in zunächst einmal sehr viel über geschriebene Sprache und ihre »kategoriale Differenz« (Ivo, 1999, S. 71) zur gesprochenen Sprache lernen.
2.2 Merkmale der gesprochenen und geschriebenen Sprache
In diesem Kapitel soll es darum gehen, gesprochene und geschriebene Sprache voneinander zu unterscheiden und hierbei nicht nur die physikalische Ebene der Zeichen, sondern auch die pragmatisch-kommunikative und die formal-sprachliche genauer zu betrachten.
In einem ersten Schritt sollen einige wichtige Unterschiede von gesprochener und geschriebener Sprache festgehalten werden (vgl. Dürscheid, 2000):
Tab. 2.1: Merkmale gesprochener und geschriebener Sprache
Die Merkmalstabelle beginnt mit einigen physikalischen Aspekten des jeweiligen Mediums: Bei der gesprochenen Sprache handelt es sich um Geräusche/Töne, die durch die Artikulationsorgane des Mund- und Rachenraums im Zusammenspiel mit der Atmung hervorgebracht und in Form von Schallwellen übertragen, über das Ohr akustisch wahrgenommen und im Gehirn kognitiv verarbeitet werden. Bei der geschriebenen Sprache bedient sich der Mensch zusätzlich zu seinen Organen (Hände, Augen) eines Schreibwerkzeugs, das auf einer Unterlage mehr oder weniger dauerhafte Spuren hinterlässt. Die Rezeption beginnt entsprechend mit der visuellen Wahrnehmung dieser Zeichen. Auch Flüchtigkeit bzw. Dauerhaftigkeit des Produkts und Geschwindigkeit der Verarbeitung lassen sich aus diesen materiellen Bedingungen des Sprechens und Schreibens ableiten.
Bei der zeitlichen Struktur von Produktion und Rezeption (Merkmal 6) wird dagegen bereits ein einfaches Kommunikationsmodell (vgl. Merkmal 12) vorausgesetzt, bei dem Sender*in und Empfänger*in von Mitteilungen interagieren. Die Möglichkeit einer Trennung (Zerdehnung) der beiden Handlungen ergibt sich, solange keine modernen Technologien vorausgesetzt werden, erst bei der Schrift. Dort ist die strikte Synchronie aufgehoben, an deren Stelle ein beliebiger Zeitraum treten kann, wie schon das Beispiel Platons eindrucksvoll demonstriert.
Zwei Parameter des Vergleichs betreffen die Entstehungsgeschichte (Merkmale 7, 8). In beiden Fällen liegt die Sprachfähigkeit früher als die Schreibfähigkeit vor, auch wenn keine genauen frühgeschichtlichen Aussagen über konkrete Zeitpunkte möglich sind.
Die Unterscheidung von primärer und sekundärer Symbolisierung (Merkmal 9) geht bereits auf Aristoteles zurück. Der entscheidende Satz aus der Poetik lautet: »Es ist aber das, was im Lautlichen ist, Zeichen für die Zustände der Seele, und das Geschriebene ist [Zeichen, Anm. d. Verf.] für das in der Stimme.« (Aristoteles, 2015, 16a 1, 3–4).
In diesem Satz wird ein zweifacher Vorgang des Bezeichnens vorgenommen. Ausgangspunkt sind zunächst »Zustände der Seele«, also Sachverhalte, die von einem Menschen wahrgenommen und ausgedrückt werden sollen. Die menschliche Stimme bringt nun (lautsprachliche) Wörter hervor, in denen die Bezeichnungen der Sachverhalte enthalten sind. Im zweiten Schritt bringt nun die Schrift graphische Zeichen hervor, in denen dasselbe enthalten ist, was vorher in der Stimme war. Diese Aussage ist...
| Erscheint lt. Verlag | 10.1.2024 |
|---|---|
| Mitarbeit |
Herausgeber (Serie): Andreas Gold, Cornelia Rosebrock, Renate Valtin, Rose Vogel |
| Zusatzinfo | 8 Abb., 49 Tab. |
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Psychologie |
| Schlagworte | Grundschule • Literalität • Pädagogik • Rechtschreibförderung |
| ISBN-10 | 3-17-043542-6 / 3170435426 |
| ISBN-13 | 978-3-17-043542-1 / 9783170435421 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich