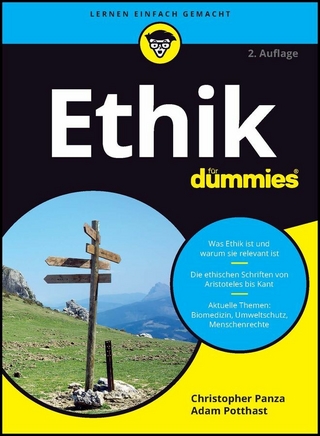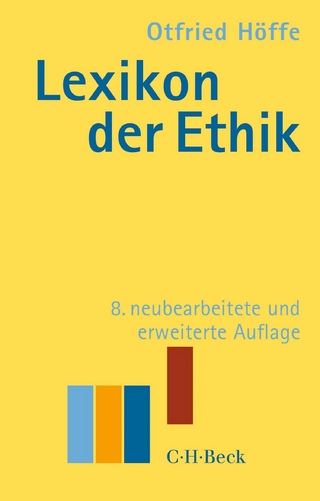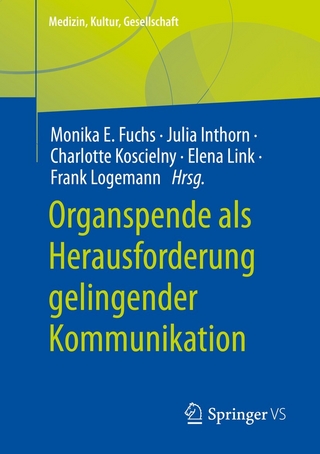Rationaler Egoismus (eBook)
292 Seiten
Books on Demand (Verlag)
978-3-7583-5042-9 (ISBN)
Der Autor ist Gymnasiallehrer i.R. mit den Fächern Mathematik/Ethik.
[Prüfet aber alles, und das Gute behaltet; Paulus]
3. Wie’s (nicht) geht, historisch: Kritik normativ-ethischer Traditionslinien
[Die ebenso steife als sittsame Tartüfferie des alten Kant, mit der er uns auf die dialektischen Schleichwege lockt, … dieses Schauspiel macht uns Verwöhnte lächeln, die wir keine kleine Belustigung darin finden, den feinen Tücken alter Moralisten … auf die Finger zu sehen; Nietzsche]
3.1. Das Schwergewicht: Kants deontologische Ethik
„… handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“ (Der „Kategorische Imperativ“, 1. Fassung150)
Da stimmt wohl zunächst fast jeder vernünftigerweise zu! Das klingt doch eh wie das vertraute „Was du nicht willst dass man dir tu, …“ oder – positiv gewendet – wie die „Goldene Regel“: „Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch!“151 Das hat man sich ja kindlicherseits schon irgendwie einleuchten lassen, bei diversen Streitigkeiten und Machtansprüchen!
3.1.1. Vorsicht: Schleudergefahr bei Kant: „Man denke ja nicht, daß hier das triviale: quod tibi non vis fieri etc. zur Richtschnur oder Prinzip dienen könne …“!? … Diese angebliche Trivialität hat für den Königsberger „keinen wahren sittlichen Wert“, denn sie appelliert offensichtlich subjektiv, auf empirischer „Neigung“sgrundlage und nicht „aus Pflicht“152!?
Kants Konzept der „praktischen Vernunft“ verdankt sich einem philosophisch-„rationalistischen“ Erbe (Plato, Descartes), der scharfen metaphysischen Trennung zwischen einer „intelligiblen“ „Vernunft“sphäre und einer „phainomenalen“ empirischen Sphäre der Sinnlichkeit. Dieser traditionelle Geist/Körper- oder Leib/Seele-Dualismus zeitigt bei unserem kritischen Aufklärer eine prinzipielle Zweiteilung des Menschen, wie er sich gefälligst aufzufassen hat: einmal als Sinnenwesen mit seinen empirisch-vorfindlichen Neigungen und dann eben als „intelligibles“ Wesen „reiner Vernunft“: „Nun findet der Mensch in sich wirklich ein Vermögen, dadurch er sich von allen anderen Dingen, ja von sich selbst, sofern er durch Gegenstände affiziert wird, unterscheidet, und das ist die Vernunft. … Um des willen muß ein vernünftiges Wesen sich selbst, als Intelligenz …, nicht als zur Sinnen- , sondern zur Verstandeswelt gehörig ansehen; mithin hat es zwei Standpunkte, daraus es sich betrachten … kann, einmal sofern es zur Sinnenwelt gehört, unter Naturgesetzen (Heteronomie), zweitens, als zur intelligiblen Welt gehörig, unter Gesetzen, die, von der Natur unabhängig, nicht empirisch, sondern bloß in der Vernunft gegründet sein.“153
Fast selbstverständlich ist schon, dass die kantische selbstgesetzgebende „Freiheit“ des „vernünftigen“ Willens von ihm – zugegebenermaßen – nicht bewiesen werden kann. Was Wunder, da muss man nicht erst moderne Hirnforschung mit ihren spannenden Ergebnissen bemühen, Unabhängigkeit von Naturgesetzen bei einem natürlichen Produkt der Evolution ist ohnehin ein Widerspruch in sich! Wo ein Wille ist, ist aber auch ein Weg! Kant gönnt sich die Freiheit, seine „Freiheit“, als „transzendentale“ Voraussetzung, also „Bedingung der Möglichkeit“ seiner Sittlichkeit, einfach zu „postulieren“: „Wir haben den bestimmten Begriff der Sittlichkeit auf die Idee der Freiheit zuletzt zurückgeführt; diese aber konnten wir, als etwas Wirkliches, nicht einmal in uns selbst und in der menschlichen Natur beweisen; wir sahen nur, daß wir sie voraussetzen müssen“154 – wenn seine Ethik gelingen soll.
Ein unterhaltsamer Zirkel: ein luftiges Postulat, aus dem die Ethik fließt, die wiederum jenes notwendig macht – oder anders: die Vernunft gründet in der Willensfreiheit, die wiederum sich aus jener speist.
Wie auch immer, diese fatale Entgegensetzung von „Vernunft“- und „Sinnenwesen“ hat die prinzipiell-menschenfeindliche zwischen „Pflicht“ und „Neigung“ im Gefolge, so dass Moralität für das Individuum155 nur als uneinsehbare „Unterwerfung“ daherkommt, vor der „alle Neigungen verstummen“: „Pflicht! du erhabener, großer Name, der du nichts Beliebtes, was Einschmeichlung bei sich führt, in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst, doch auch nicht drohst, was natürliche Abneigung im Gemüte erregte und schreckte, um den Willen zu bewegen, sondern bloß ein Gesetz aufstellst, welches von selbst im Gemüte Eingang findet und doch selbst wider Willen(!) Verehrung … erwirbt, vor dem alle Neigungen verstummen …“156
„Gerne dien ich den Freunden, doch tue ich es leider mit Neigung, Und so wurmt es mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin. Da ist kein anderer Rat! Du mußt suchen, sie zu verachten, Und mit Abscheu alsdann tun, wie die Pflicht dir gebeut.“ Schiller liegt hier (ironisch) zweifach falsch, denn 1. wäre „Abscheu“ ja auch eine „Neigung“ und 2. geht er etwas zu weit, denn von Kant wird ja nur Interesselosigkeit verlangt – was ganz, ganz schwierig für den Handelnden sein dürfte und nur dem ganz sturen Formalisten möglich, weswegen kantische Moralität ein eher seltenes Phänomen ist! Auch Kandidat MM packt das eben nur heuchlerisch.
Lächelnd beobachtet man, wie Kant selbst diese Schwierigkeit z.B. in einem Exempel zur Erläuterung der Arbeitsweise des „Kat. Imperativ“s eingesteht: „Noch denkt ein vierter, dem es wohl geht, indessen er sieht, daß andere mit großen Mühseligkeiten zu kämpfen haben … : was geht’s mich an? Mag doch ein jeder so glücklich sein, als es der Himmel will, oder er sich selbst machen kann, … Aber, obgleich es möglich ist, daß nach jener Maxime ein allgemeines (Natur)Gesetz wohl bestehen könnte: so ist es doch unmöglich, zu wollen, daß ein solches Prinzip … allenthalben gelte. Denn, ein Wille, der dieses beschlösse, würde sich selbst widerstreiten, indem der Fälle manche sich doch eräugnen können, wo er anderer Liebe und Teil- nehmung bedarf und wo er, durch ein solches aus seinem eigenen Willen entsprungenes Naturgesetz, sich selbst alle Hoffnung des Beistands, den er sich wünscht,rauben würde.“157 Nur durch einen Appell an den rationalen Egoismus jedes Individuums, also seine subjektiv-vernünftige Interessiertheit gelingt ihm überhaupt seine Argumentation!
3.1.2. „Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz.“158 Wohlgemerkt, nochmal: abstrakt bloß fürs „Gesetz“, ohne subjektives Interesse am etwaigen Inhalt desselben! Diese abstrakte Anbetung der Pflicht als solcher realisiert sich dann prompt staatsphilosophisch in einer Orgie untertäniger Pflichten, die sich appellatorisch an die „glückliche Einfalt“159 braver Untertanenmentalität richtet. So legitimiert sich bei Kant „moralisch“ jede machtvoll durchgesetzte Pflicht, denn es bedarf ja „keiner Wissenschaft und Philosophie … , um zu wissen, was man zu tun habe, um ehrlich und gut, ja sogar, um weise und tugendhaft zu sein.“160 So gilt für den Staatsbürger eben auch, dass „der Ursprung der obersten Gewalt … für das Volk … unerforschlich (ist), d.i. der Untertan soll nicht über diesen Ursprung … vernünfteln. Denn … das Volk … kann und darf nicht anders urteilen, als das gegenwärtige Staatsoberhaupt es will. … , denn wollte der Untertan, der den letzten Ursprung nun ergrübelt hätte, sich jener jetzt herrschenden Autorität widersetzen, so würde er nach den Gesetzen derselben, d.i. mit allem Recht, bestraft, vertilgt oder … ausgestoßen werden. Ein Gesetz, das so heilig (unverletzlich) ist, … wird so vorgestellt, als ob es nicht von Menschen, aber doch von irgend einem höchsten tadelfreien Gesetzgeber herkommen müsse, und das ist die Bedeutung des Satzes: „alle Obrigkeit ist von Gott“, welcher nicht einen Geschichtsgrund der bürgerlichen Verfassung, sondern eine Idee, als praktisches Vernunftprinzip, aussagt: der jetzt bestehenden gesetzgebenden Gewalt gehorchen zu sollen; ihr Ursprung mag sein, welcher er wolle.“161 Analog zeigt sich Kants „aufgeklärte“ Untertanenanbetung z.B. in der 2. Vorrede seiner „Kritik der reinen Vernunft“ zum Stichwort „Freiheit“. Angesichts seines fundamentalen Einfalls, mittels einer „Kritik der reinen Vernunft“ sich der Drangsale der theoretischen Beweisbarkeit der spekulativen Ideen „Gott, Freiheit und Unsterblichkeit“ zu entledigen und diese gerade dadurch, weil nicht beweisbar auch nicht widerlegbar...
| Erscheint lt. Verlag | 12.3.2024 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Ethik |
| ISBN-10 | 3-7583-5042-5 / 3758350425 |
| ISBN-13 | 978-3-7583-5042-9 / 9783758350429 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 285 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich