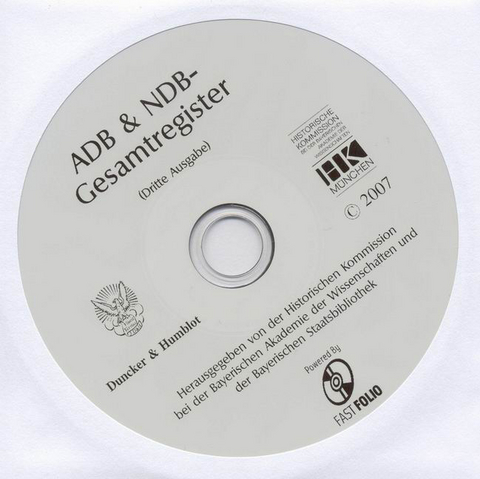
Allgemeine Deutsche Biographie & Neue Deutsche Biographie. Gesamtregister auf CD-ROM - Dritte Ausgabe. (Lieferung mit 23. Bd.)
Hrsg. von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Bayerischen Staatsbibliothek.
2007
|
3. Auflage
Duncker & Humblot (Hersteller)
978-3-428-12582-1 (ISBN)
Duncker & Humblot (Hersteller)
978-3-428-12582-1 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
Die Neue Deutsche Biographie (NDB) informiert in prägnanten, wissenschaftlich fundierten Artikeln über bedeutende Persönlichkeiten des deutschen Sprachraums vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. Aufgenommen sind verstorbene Personen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens wie Politik und Religion, Wirtschaft und Technik, Wissenschaft, Kunst und Kultur. Für den deutschsprachigen Raum stellt die NDB das maßgebliche biographische Lexikon dar. Sie wird - wie ihre Vorgängerin, die 1873-1912 in 56 Bänden erschienene Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) - von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München herausgegeben, erscheint seit 1953 und ist auf insgesamt 28 Bände angelegt. Die ersten 23 Bände umfassen den alphabetischen Bereich Aachen - Schwarz und enthalten mehr als 20.800 Artikel zu Einzelpersonen und Familien.
Die NDB publiziert ausschließlich Originalbeiträge, die - von etwa 9.800 Fachleuten verschiedener Disziplinen verfaßt und namentlich gezeichnet - den jeweiligen Stand der Forschung repräsentieren. Die Artikel folgen einer Systematik, die neben der Darstellung und historischen Einordnung von Leben und Werk regelmäßig Angaben vorsieht u. a. zu Namensvarianten, zur Genealogie, zu den wichtigsten Werken und Sekundärliteraur sowie zu Quellen und Porträts.
Die Bandregister erfassen sowohl alle Persönlichkeiten, denen eigene Artikel gewidmet sind, als auch einige der in den Genealogien und im Text genannten wichtigen Personen. Das digitale Gesamtregister von ADB und NDB auf CD-ROM (siehe letzte Seite) ermöglicht einen schnellen und komfortablen Zugriff auf etwa 47.000 Artikel der ADB und NDB und erweitert zugleich die Abfrage- und Analysemöglichkeiten.
Die von der Redaktion aufgebaute und kontinuierlich ergänzte biographische Dokumentation umfaßt inzwischen mehr als 140.000 Namen. Hieraus wählen die verantwortlichen Redakteure die zu berücksichtigenden Persönlichkeiten aus, suchen zu diesen kompetente Autorinnen und Autoren und betreuen die Artikel bis zur Drucklegung.
Weitere Informationen zur Konzeption der NDB-Beiträge im Internet unter: http://www.ndb.badw.de
Textproben
Schlom (Salomon), ermordet 1196, Münzmeister. (jüd.)
S., urkundlich erwähnt 1194 und in einer hebr. Chronik um 1200 "Salomon" genannt, ist der erste namentlich bekannte Jude im Herrschaftsbereich der Babenberger; Hzg. Leopold V. (reg. 1177-94) berief ihn vor 1194 als Münzmeister nach Österreich. Er stammte vermutlich aus Bayern (Regensburg?); denkbar, aber weniger wahrscheinlich ist eine Herkunft aus Böhmen (Prag). Seine Funktion in hzgl. Diensten war die eines Monetars, in der er wohl für die Versorgung der Münzstätte in Krems mit Silber (v. a. Bruchsilber) zu sorgen hatte. Vermutlich verlor er seine Position 1194 nach dem Eintreffen des Lösegelds für den engl. Kg. Richard Löwenherz, da Leopold V. damals eine aus führenden Wiener Bürgern bestehende Münzergenossenschaft ins Leben rief, der keine Juden angehören sollten.
1194 wurde in (Bad) Fischau ein Prozeß entschieden, den das Kloster Formbach (Vornbach) am Inn wegen eines vermutlich in Grinzing (b. Wien) gelegenen Weinbergs gegen S. anstrengte. Die Umstände weisen darauf hin, daß er diesen Weinberg als Grundherr besaß. 1194 sprach der Herzog den Weinberg dem Kloster zu. Eine 1195 erfolgte Revision des Urteils durch Leopolds Nachfolger Friedrich I. (reg. 1194-98) bestätigte zwar Formbach den Besitz, doch mußte der Abt S. eine Entschädigung zahlen. In der Stadt, im Bereich der heutigen Seitenstettengasse / Desider-Friedman-Platz besaß S. vier Grundstücke (Hofstätten), neben denen er eine Synagoge erbauen ließ (scola iudeorum), die urkundlich 1204 als noch bestehend geführt wird. Es handelt sich um die älteste Synagoge in Wien.
Dem Haushalt S.s gehörten mindestens 15 jüd. Personen an, er hatte aber auch christl. Knechte und Mägde. 1196 verübte einer der christl. Diener in S.s Haus einen Diebstahl, der gerichtlich verfolgt wurde. Die Frau des Diebs beklagte sich über das Vorgehen gegen ihren Mann bei sich in Wien aufhaltenden Kreuzfahrern, die hierauf in S.s Haus eindrangen und ihn zusammen mit 15 anderen Juden erschlugen. Hzg. Friedrich I. ließ die Rädelsführer hinrichten, begnadigte aber die anderen, weil sie sich auf einer Kreuzfahrt befanden.
L K. Lohrmann, Die Wiener Juden im MA, Gesch. d. Juden in Wien 1, 2000, S. 28 ff. (Qu, Bibliogr.); Hist. Lex. Wien.
Klaus Lohrmann
Schmidt, Auguste Friederike Wilhelmine, Pädagogin, Frauenrechtlerin, Publizistin, * 3.8.1833 Breslau, + 10.6.1902 Leipzig. (ev.)
V Friedrich (1790-1863), preuß. Hptm. d. Artillerie; M Emilie (1802-76), T d. Johann Gottlieb Schöps (um 1770-1837), Rgt.arzt, u. d. Juliane Charlotte Grau ( n. 1837); Schw Anna (1837-1908, N. N. Schmidt, Hptm.), Lehrerin in L., Clara (1843-1922, N. N. Claus, Musikdir.), Sängerin, Musiklehrerin in L.; - ledig.
S. besuchte seit 1842 die Kgl. Luisenschule in Posen. 1850 absolvierte sie das Lehrerinnenexamen; in Breslau legte sie das Schulvorsteherinnenexamen ab und war seit 1850 über 40 Jahre nahezu ununterbrochen im Erziehungsberuf tätig. Sie lebte mit ihrer Mutter und ihren Schwestern Anna und Clara zusammen. 1861 übersiedelte sie nach Leipzig, wo sie 1862 eine Anstellung als Lehrerin für Literatur und Geschichte an der von Ottilie v. Steyber (1804-70) gegründeten privaten Mädchenschule fand. Im März 1865 gründete sie mit Louise Otto-Peters (1819-95) den "Leipziger Frauenbildungsverein", der erste Frauenverein, der nicht wohltätigen Zwecken gewidmet war, sondern die Förderung der Frauenbildung zum Ziel hatte. Im Okt. 1865 wurde der "Allgemeine Dt. Frauenverein" (ADF) in Leipzig gegründet, woran S., die spätere langjährige stellv. Vorsitzende, federführend beteiligt war. August Bebel (1840-1913) nahm an der Gründungsversammlung als Gast teil. Der ADF, mit dem die organisierte bürgerliche Frauenbewegung ihren Anfang nahm, setzte sich zunächst das Ziel, die zahlreichen Hindernisse bei den Bildungs- und Berufsausbildungsmöglichkeiten für Frauen zu beseitigen. 1866-95 redigierte S. mit Louise Otto-Peters das Vereinsorgan "Neue Bahnen", anschließend gab sie es allein heraus und übernahm auch den Vorsitz des ADF. S. publizierte überwiegend Themen zur Frauen- bzw. Mädchenbildung in den "Neuen Bahnen", 1870-92 leitete sie das Steybersche Institut. Eine ihrer begabtesten Schülerinnen, Clara Zetkin (1857-1933), wurde Begründerin der proletarischen Frauenbewegung. S., die schon 1869 den "Verein dt. Lehrerinnen und Erzieherinnen" mitinitiiert hatte, gründete 1890 mit Helene Lange (1848-1930) u. a. den "Allgemeinen Dt. Lehrerinnenverein". 1894 wurden unter maßgeblicher Beteiligung S.s vom ADF Gymnasialkurse für Mädchen in Leipzig eröffnet. Deutschlandweit war dies die dritte Möglichkeit für Mädchen, das Abitur abzulegen und die Berechtigung zum Hochschulzugang zu erwerben. Als erste Vorsitzende (1894-99) des von ihr 1894 mitgegründeten "Bundes Dt. Frauenvereine" (BDF) vermittelte sie erfolgreich in den hartnäckigen Richtungskämpfen zwischen den einzelnen Flügeln. S. gehört zu den Gründerinnen der organisierten bürgerlichen Frauenbewegung und zu den frühen Förderinnen von qualifizierter Berufsausbildung und des Universitätszugangs für Mädchen und Frauen in Deutschland.
W Aus schwerer Zeit, 1895; Louise Otto-Peters, die Dichterin u. Vorkämpferin f. Frauenrecht, 1895 (mit H. Rösch, W-Verz.).
L A. S., Zwei Reden gehalten v. Rosalie Büttner u. Dr. Käthe Windscheid, Zum Besten d. Auguste Schmidt-Hauses, 1902; M. Friedrichs, A. S. als Frauenrechtlerin, 1904; A. Plothow, Die Begründerinnen d. dt. Frauenbewegung, 1907; M. Schmidt-Goßrau, A. S., Eine mütterliche Frau als Trägerin dt. Volkstums, Zu ihrem 100. Geb.tag, 3. Aug. 1933, 1933; H. Neubach, in: Ostdt. Gedenktage 2001/2002, S. 201-05 (P); J. Ludwig, I. Nagelschmidt u. S. Schötz, Leben ist Streben, Das erste A.-S.-Buch, 2003; E. Wegener, Unbekanntes z. Biogr. v. A. S. aus d. Fam.archiv, in: Topogr. u. Mobilität in d. dt. Frauenbewegung, Ergebnisse d. wiss. Kolloquiums d. Dt. Staatsbürgerinnen-Verbandes e.V. am 2. Nov. 2002, hg. v. I. Hundt, 2003, S. 8-16.
P Ölgem. v. Carl Schmidt, Dresden; Bildnisbüste v. A. Lehnert (beide Leipzig, Stadtgeschichtl. Mus.); Gedenkstein (Lapidarium d. Alten Johannisfriedhofs, Leipzig).
Astrid Franzke
Schneider, Romy (eigtl. Rosemarie Magdalena Albach-Retty), Schauspielerin, * 23.9.1938 Wien, + 29.5.1982 Paris, Boissy-sans-Avoir (Île-de-France).
(Ein Auszug) [...] Mit 14 Jahren übernahm sie - ohne schauspielerische Ausbildung, aber durch ungezwungene Natürlichkeit überzeugend - in dem Heimatfilm "Wenn der weiße Flieder wieder blüht" (1953, Regie: Hans Deppe) ihre erste Filmrolle an der Seite ihrer Mutter, die mit ihrem zweiten Ehemann die Schauspielkarriere ihrer Tochter systematisch förderte. In der Rolle der "Sissi" wurde S. zum populären Star. [...] Nur einmal noch spielte S. in einer dt. Produktion, in der Verfilmung von Heinrich Bölls "Gruppenbild mit Dame" (1976/77) in der Regie von Aleksandar Petrovic, in dem sie eine Frau verkörperte, die sich in ihrem eigenen Land fremd fühlt - fast eine Metapher für S.s Leben und Karriere selbst. [...]
Wolfgang Jacobsen
Schreck (Terrentius, chines. Deng Yuhan), Johannes, Jesuit, Arzt, Astronom, * 1576 Bingen b. Sigmaringen, + 30.5.1630 Peking, Jesuitenfriedhof Shala b. Peking.
V Sebastian, Jurist (?); M N. N.
S. studierte seit 1590 in Freiburg (Br.) Medizin und Naturwissenschaften, erhielt 1594 das Bakkalaureat und wurde 1596 zum Magister promoviert. 1603 studierte er in Padua, wo er Galilei kennenlernte. 1611 wurde er in die 1603 von Fürst Federico Cesi (1585- 1630) gegründete "Accademia dei Lincei" aufgenommen. Zusammen mit seinem Freund Johannes Faber (1570-1640) sowie Fabio Colonna (1567-1640) redigierte, ergänzte und kommentierte er den umfangreichen "Thesaurus rerum medicarum Novae Hispaniae" des Francisco Hernandez (gedr. 1651). 1611 trat S. in den Jesuitenorden ein und reiste 1618 mit P. Niklaas Trigault (1577-1628) nach China, um dort als Missionar zu wirken. In Goa sammelte und beschrieb er 500 in Europa bislang unbekannte Pflanzen (Plinius Indicus, Ms. verschollen). Nach zwei Jahren Vorbereitungs- und Wartezeit in Macao gelangte er 1623 über Hangzhou nach Peking. 1629 wurde er zusammen mit Nicolo Longobardi (1559-1654) von dem ksl. Kommissar Paul Xu Guangqi (1562-1633) mit der Durchführung einer grundlegenden Kalenderrefom betraut. Dazu plante S. die Konstruktion neuer astronomischer Instrumente und konzipierte ein umfangreiches Übersetzungsprojekt für astronomische und mathematische Werke (1633- ca. 1638 u. d. T. "Chongzhen lishu" veröff.). Nach seinem Tod führten Johann Adam Schall v. Bell (1592-1666) und Giacomo Rho (1592-1638) die Arbeiten weiter.
S.s Hauptleistung liegt in der Initiierung der chines. Kalenderreform, mit der die astronomischen Kenntnisse des Abendlandes in China eingeführt wurden und die den Jesuiten zeitweise eine einflußreiche Position als Berater des Kaisers verschaffte. S. stand mit Johannes Kepler in Verbindung, der ihm die "Tabulae Rudolphinae" schickte. Daneben schrieb er eine Reihe von Pionierarbeiten in chines. Sprache, so ein Werk über Trigonometrie (Dace), ein weiteres über Sinus, Tangenten und Sekanten (Baxian biao, hg. v. A. Schall) und einen Abriß der Astronomie (Cetian yueshuo, 1628). Von besonderer Bedeutung ist die erste Darstellung der menschlichen Anatomie nach westl. Muster in China (Taixi renshen shuogai, 1643, hg. v. Bi Gongchen). Mehrfach aufgelegt wurde ein Abbildungswerk über europ. Maschinen (Yuanxi qiqi tushuo, 1627, hg. v. Philipp Wang Zheng) mit Auszügen aus den Werken von Jacques Besson, Konrad Zeising, Agostino Ramelli, Vittorio Zonca u. a., das auch die Grundlagen der Mechanik erläutert; es wurde in die ksl. Enzyklopädie "Gujin tushu jicheng" (1726) aufgenommen.
L G. Gabrieli, Giovanni S., Linceo, gesuita e missionario in Cina e le sue lettere dall' Asia, Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche, Acc. dei Lincei, Reihe 6, Bd. 12, 1936, S. 462-514; B. H. Willeke, Terrenz, in: Dict. of Ming Biogr. 1976, S. 1282-84; H. Walravens, China illustrata, Das europ. Chinaverständnis im Spiegel d. 16. bis 18. Jh., 1987, S. 22-35; ders., The Qiqi tushuo revisited, Missionary approaches and linguistics in Mainland China and Taiwan, hg. v. Ku Wei-ying, 2001, S. 183-98; ders., Ein wenig bek. Brief d. Gel. J. S., in: China Heute Nr. 136, 2004; I. Iannaccone, J. S. (Terrentius), scienziato, linceo, gesuita e missionario nell' impero dei Ming, in: Asia orientale 5/6, 1987, S. 49-85; ders., J. S. Terrentius, Le scienze rinascimentali e lo spirito dell' Acc. dei Lincei nella Cina dei Ming, 1998; E. Zettl, J. S. Terrentius Constantiensis, Wissenschaftler u. China-Missionar (1576-1630), 2001.
Hartmut Walravens
Die NDB publiziert ausschließlich Originalbeiträge, die - von etwa 9.800 Fachleuten verschiedener Disziplinen verfaßt und namentlich gezeichnet - den jeweiligen Stand der Forschung repräsentieren. Die Artikel folgen einer Systematik, die neben der Darstellung und historischen Einordnung von Leben und Werk regelmäßig Angaben vorsieht u. a. zu Namensvarianten, zur Genealogie, zu den wichtigsten Werken und Sekundärliteraur sowie zu Quellen und Porträts.
Die Bandregister erfassen sowohl alle Persönlichkeiten, denen eigene Artikel gewidmet sind, als auch einige der in den Genealogien und im Text genannten wichtigen Personen. Das digitale Gesamtregister von ADB und NDB auf CD-ROM (siehe letzte Seite) ermöglicht einen schnellen und komfortablen Zugriff auf etwa 47.000 Artikel der ADB und NDB und erweitert zugleich die Abfrage- und Analysemöglichkeiten.
Die von der Redaktion aufgebaute und kontinuierlich ergänzte biographische Dokumentation umfaßt inzwischen mehr als 140.000 Namen. Hieraus wählen die verantwortlichen Redakteure die zu berücksichtigenden Persönlichkeiten aus, suchen zu diesen kompetente Autorinnen und Autoren und betreuen die Artikel bis zur Drucklegung.
Weitere Informationen zur Konzeption der NDB-Beiträge im Internet unter: http://www.ndb.badw.de
Textproben
Schlom (Salomon), ermordet 1196, Münzmeister. (jüd.)
S., urkundlich erwähnt 1194 und in einer hebr. Chronik um 1200 "Salomon" genannt, ist der erste namentlich bekannte Jude im Herrschaftsbereich der Babenberger; Hzg. Leopold V. (reg. 1177-94) berief ihn vor 1194 als Münzmeister nach Österreich. Er stammte vermutlich aus Bayern (Regensburg?); denkbar, aber weniger wahrscheinlich ist eine Herkunft aus Böhmen (Prag). Seine Funktion in hzgl. Diensten war die eines Monetars, in der er wohl für die Versorgung der Münzstätte in Krems mit Silber (v. a. Bruchsilber) zu sorgen hatte. Vermutlich verlor er seine Position 1194 nach dem Eintreffen des Lösegelds für den engl. Kg. Richard Löwenherz, da Leopold V. damals eine aus führenden Wiener Bürgern bestehende Münzergenossenschaft ins Leben rief, der keine Juden angehören sollten.
1194 wurde in (Bad) Fischau ein Prozeß entschieden, den das Kloster Formbach (Vornbach) am Inn wegen eines vermutlich in Grinzing (b. Wien) gelegenen Weinbergs gegen S. anstrengte. Die Umstände weisen darauf hin, daß er diesen Weinberg als Grundherr besaß. 1194 sprach der Herzog den Weinberg dem Kloster zu. Eine 1195 erfolgte Revision des Urteils durch Leopolds Nachfolger Friedrich I. (reg. 1194-98) bestätigte zwar Formbach den Besitz, doch mußte der Abt S. eine Entschädigung zahlen. In der Stadt, im Bereich der heutigen Seitenstettengasse / Desider-Friedman-Platz besaß S. vier Grundstücke (Hofstätten), neben denen er eine Synagoge erbauen ließ (scola iudeorum), die urkundlich 1204 als noch bestehend geführt wird. Es handelt sich um die älteste Synagoge in Wien.
Dem Haushalt S.s gehörten mindestens 15 jüd. Personen an, er hatte aber auch christl. Knechte und Mägde. 1196 verübte einer der christl. Diener in S.s Haus einen Diebstahl, der gerichtlich verfolgt wurde. Die Frau des Diebs beklagte sich über das Vorgehen gegen ihren Mann bei sich in Wien aufhaltenden Kreuzfahrern, die hierauf in S.s Haus eindrangen und ihn zusammen mit 15 anderen Juden erschlugen. Hzg. Friedrich I. ließ die Rädelsführer hinrichten, begnadigte aber die anderen, weil sie sich auf einer Kreuzfahrt befanden.
L K. Lohrmann, Die Wiener Juden im MA, Gesch. d. Juden in Wien 1, 2000, S. 28 ff. (Qu, Bibliogr.); Hist. Lex. Wien.
Klaus Lohrmann
Schmidt, Auguste Friederike Wilhelmine, Pädagogin, Frauenrechtlerin, Publizistin, * 3.8.1833 Breslau, + 10.6.1902 Leipzig. (ev.)
V Friedrich (1790-1863), preuß. Hptm. d. Artillerie; M Emilie (1802-76), T d. Johann Gottlieb Schöps (um 1770-1837), Rgt.arzt, u. d. Juliane Charlotte Grau ( n. 1837); Schw Anna (1837-1908, N. N. Schmidt, Hptm.), Lehrerin in L., Clara (1843-1922, N. N. Claus, Musikdir.), Sängerin, Musiklehrerin in L.; - ledig.
S. besuchte seit 1842 die Kgl. Luisenschule in Posen. 1850 absolvierte sie das Lehrerinnenexamen; in Breslau legte sie das Schulvorsteherinnenexamen ab und war seit 1850 über 40 Jahre nahezu ununterbrochen im Erziehungsberuf tätig. Sie lebte mit ihrer Mutter und ihren Schwestern Anna und Clara zusammen. 1861 übersiedelte sie nach Leipzig, wo sie 1862 eine Anstellung als Lehrerin für Literatur und Geschichte an der von Ottilie v. Steyber (1804-70) gegründeten privaten Mädchenschule fand. Im März 1865 gründete sie mit Louise Otto-Peters (1819-95) den "Leipziger Frauenbildungsverein", der erste Frauenverein, der nicht wohltätigen Zwecken gewidmet war, sondern die Förderung der Frauenbildung zum Ziel hatte. Im Okt. 1865 wurde der "Allgemeine Dt. Frauenverein" (ADF) in Leipzig gegründet, woran S., die spätere langjährige stellv. Vorsitzende, federführend beteiligt war. August Bebel (1840-1913) nahm an der Gründungsversammlung als Gast teil. Der ADF, mit dem die organisierte bürgerliche Frauenbewegung ihren Anfang nahm, setzte sich zunächst das Ziel, die zahlreichen Hindernisse bei den Bildungs- und Berufsausbildungsmöglichkeiten für Frauen zu beseitigen. 1866-95 redigierte S. mit Louise Otto-Peters das Vereinsorgan "Neue Bahnen", anschließend gab sie es allein heraus und übernahm auch den Vorsitz des ADF. S. publizierte überwiegend Themen zur Frauen- bzw. Mädchenbildung in den "Neuen Bahnen", 1870-92 leitete sie das Steybersche Institut. Eine ihrer begabtesten Schülerinnen, Clara Zetkin (1857-1933), wurde Begründerin der proletarischen Frauenbewegung. S., die schon 1869 den "Verein dt. Lehrerinnen und Erzieherinnen" mitinitiiert hatte, gründete 1890 mit Helene Lange (1848-1930) u. a. den "Allgemeinen Dt. Lehrerinnenverein". 1894 wurden unter maßgeblicher Beteiligung S.s vom ADF Gymnasialkurse für Mädchen in Leipzig eröffnet. Deutschlandweit war dies die dritte Möglichkeit für Mädchen, das Abitur abzulegen und die Berechtigung zum Hochschulzugang zu erwerben. Als erste Vorsitzende (1894-99) des von ihr 1894 mitgegründeten "Bundes Dt. Frauenvereine" (BDF) vermittelte sie erfolgreich in den hartnäckigen Richtungskämpfen zwischen den einzelnen Flügeln. S. gehört zu den Gründerinnen der organisierten bürgerlichen Frauenbewegung und zu den frühen Förderinnen von qualifizierter Berufsausbildung und des Universitätszugangs für Mädchen und Frauen in Deutschland.
W Aus schwerer Zeit, 1895; Louise Otto-Peters, die Dichterin u. Vorkämpferin f. Frauenrecht, 1895 (mit H. Rösch, W-Verz.).
L A. S., Zwei Reden gehalten v. Rosalie Büttner u. Dr. Käthe Windscheid, Zum Besten d. Auguste Schmidt-Hauses, 1902; M. Friedrichs, A. S. als Frauenrechtlerin, 1904; A. Plothow, Die Begründerinnen d. dt. Frauenbewegung, 1907; M. Schmidt-Goßrau, A. S., Eine mütterliche Frau als Trägerin dt. Volkstums, Zu ihrem 100. Geb.tag, 3. Aug. 1933, 1933; H. Neubach, in: Ostdt. Gedenktage 2001/2002, S. 201-05 (P); J. Ludwig, I. Nagelschmidt u. S. Schötz, Leben ist Streben, Das erste A.-S.-Buch, 2003; E. Wegener, Unbekanntes z. Biogr. v. A. S. aus d. Fam.archiv, in: Topogr. u. Mobilität in d. dt. Frauenbewegung, Ergebnisse d. wiss. Kolloquiums d. Dt. Staatsbürgerinnen-Verbandes e.V. am 2. Nov. 2002, hg. v. I. Hundt, 2003, S. 8-16.
P Ölgem. v. Carl Schmidt, Dresden; Bildnisbüste v. A. Lehnert (beide Leipzig, Stadtgeschichtl. Mus.); Gedenkstein (Lapidarium d. Alten Johannisfriedhofs, Leipzig).
Astrid Franzke
Schneider, Romy (eigtl. Rosemarie Magdalena Albach-Retty), Schauspielerin, * 23.9.1938 Wien, + 29.5.1982 Paris, Boissy-sans-Avoir (Île-de-France).
(Ein Auszug) [...] Mit 14 Jahren übernahm sie - ohne schauspielerische Ausbildung, aber durch ungezwungene Natürlichkeit überzeugend - in dem Heimatfilm "Wenn der weiße Flieder wieder blüht" (1953, Regie: Hans Deppe) ihre erste Filmrolle an der Seite ihrer Mutter, die mit ihrem zweiten Ehemann die Schauspielkarriere ihrer Tochter systematisch förderte. In der Rolle der "Sissi" wurde S. zum populären Star. [...] Nur einmal noch spielte S. in einer dt. Produktion, in der Verfilmung von Heinrich Bölls "Gruppenbild mit Dame" (1976/77) in der Regie von Aleksandar Petrovic, in dem sie eine Frau verkörperte, die sich in ihrem eigenen Land fremd fühlt - fast eine Metapher für S.s Leben und Karriere selbst. [...]
Wolfgang Jacobsen
Schreck (Terrentius, chines. Deng Yuhan), Johannes, Jesuit, Arzt, Astronom, * 1576 Bingen b. Sigmaringen, + 30.5.1630 Peking, Jesuitenfriedhof Shala b. Peking.
V Sebastian, Jurist (?); M N. N.
S. studierte seit 1590 in Freiburg (Br.) Medizin und Naturwissenschaften, erhielt 1594 das Bakkalaureat und wurde 1596 zum Magister promoviert. 1603 studierte er in Padua, wo er Galilei kennenlernte. 1611 wurde er in die 1603 von Fürst Federico Cesi (1585- 1630) gegründete "Accademia dei Lincei" aufgenommen. Zusammen mit seinem Freund Johannes Faber (1570-1640) sowie Fabio Colonna (1567-1640) redigierte, ergänzte und kommentierte er den umfangreichen "Thesaurus rerum medicarum Novae Hispaniae" des Francisco Hernandez (gedr. 1651). 1611 trat S. in den Jesuitenorden ein und reiste 1618 mit P. Niklaas Trigault (1577-1628) nach China, um dort als Missionar zu wirken. In Goa sammelte und beschrieb er 500 in Europa bislang unbekannte Pflanzen (Plinius Indicus, Ms. verschollen). Nach zwei Jahren Vorbereitungs- und Wartezeit in Macao gelangte er 1623 über Hangzhou nach Peking. 1629 wurde er zusammen mit Nicolo Longobardi (1559-1654) von dem ksl. Kommissar Paul Xu Guangqi (1562-1633) mit der Durchführung einer grundlegenden Kalenderrefom betraut. Dazu plante S. die Konstruktion neuer astronomischer Instrumente und konzipierte ein umfangreiches Übersetzungsprojekt für astronomische und mathematische Werke (1633- ca. 1638 u. d. T. "Chongzhen lishu" veröff.). Nach seinem Tod führten Johann Adam Schall v. Bell (1592-1666) und Giacomo Rho (1592-1638) die Arbeiten weiter.
S.s Hauptleistung liegt in der Initiierung der chines. Kalenderreform, mit der die astronomischen Kenntnisse des Abendlandes in China eingeführt wurden und die den Jesuiten zeitweise eine einflußreiche Position als Berater des Kaisers verschaffte. S. stand mit Johannes Kepler in Verbindung, der ihm die "Tabulae Rudolphinae" schickte. Daneben schrieb er eine Reihe von Pionierarbeiten in chines. Sprache, so ein Werk über Trigonometrie (Dace), ein weiteres über Sinus, Tangenten und Sekanten (Baxian biao, hg. v. A. Schall) und einen Abriß der Astronomie (Cetian yueshuo, 1628). Von besonderer Bedeutung ist die erste Darstellung der menschlichen Anatomie nach westl. Muster in China (Taixi renshen shuogai, 1643, hg. v. Bi Gongchen). Mehrfach aufgelegt wurde ein Abbildungswerk über europ. Maschinen (Yuanxi qiqi tushuo, 1627, hg. v. Philipp Wang Zheng) mit Auszügen aus den Werken von Jacques Besson, Konrad Zeising, Agostino Ramelli, Vittorio Zonca u. a., das auch die Grundlagen der Mechanik erläutert; es wurde in die ksl. Enzyklopädie "Gujin tushu jicheng" (1726) aufgenommen.
L G. Gabrieli, Giovanni S., Linceo, gesuita e missionario in Cina e le sue lettere dall' Asia, Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche, Acc. dei Lincei, Reihe 6, Bd. 12, 1936, S. 462-514; B. H. Willeke, Terrenz, in: Dict. of Ming Biogr. 1976, S. 1282-84; H. Walravens, China illustrata, Das europ. Chinaverständnis im Spiegel d. 16. bis 18. Jh., 1987, S. 22-35; ders., The Qiqi tushuo revisited, Missionary approaches and linguistics in Mainland China and Taiwan, hg. v. Ku Wei-ying, 2001, S. 183-98; ders., Ein wenig bek. Brief d. Gel. J. S., in: China Heute Nr. 136, 2004; I. Iannaccone, J. S. (Terrentius), scienziato, linceo, gesuita e missionario nell' impero dei Ming, in: Asia orientale 5/6, 1987, S. 49-85; ders., J. S. Terrentius, Le scienze rinascimentali e lo spirito dell' Acc. dei Lincei nella Cina dei Ming, 1998; E. Zettl, J. S. Terrentius Constantiensis, Wissenschaftler u. China-Missionar (1576-1630), 2001.
Hartmut Walravens
| Sprache | deutsch |
|---|---|
| Gewicht | 70 g |
| Einbandart | Jewelcase |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Allgemeines / Lexika |
| Schlagworte | Biographisches Nachschlagewerk • CD-ROM, DVD-ROM / Geschichte/Allgemeines, Lexika • Historische Persönlichkeit /Biographie • Software (CD-ROM) • SOFTWARE/Geschichte/Allgemeines, Lexika |
| ISBN-10 | 3-428-12582-7 / 3428125827 |
| ISBN-13 | 978-3-428-12582-1 / 9783428125821 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |