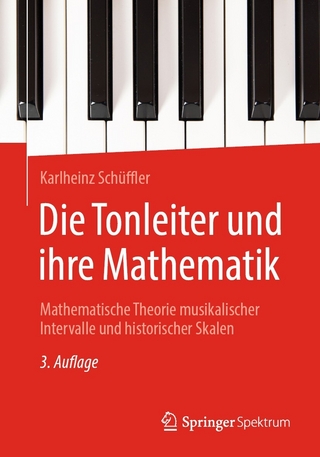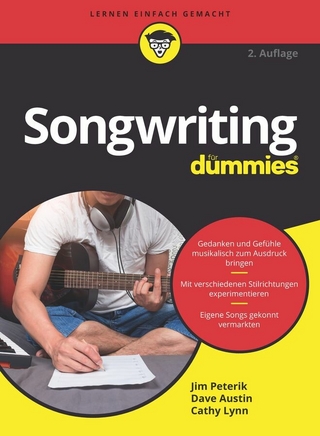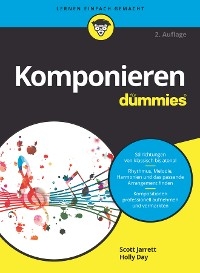Bachs Passionen (eBook)
128 Seiten
Schott Music (Verlag)
978-3-7957-8550-5 (ISBN)
Gottfried Scholz, ausgewiesen durch zahlreiche Publikationen zur Musik des Barock, lehrte als Professor für musikalische Analyse an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien.
Gottfried Scholz, ausgewiesen durch zahlreiche Publikationen zur Musik des Barock, lehrte als Professor für musikalische Analyse an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien.
Einleitung: Passionsmusiken vor Bach - Die Anforderungen der Leipziger Kirchengemeinde - Zum Stil der Bachschen Passionen und zu deren theologischen Bezügen - Die Matthäus-Passion - Die Leidensstationen der Matthäus-Passion - Die Johannes-Passion - Die Leidensstationen in der Johannes-Passion - Spätere Bearbeitungen der Passionen durch Bach - Zur Aufführungspraxis und Rezeptionsgeschichte - Die verlorengegangene Markus-Passion und Bachs zweifelhafte Autorschaft an der Lukas-Passion - Passionsbezüge im Kantatenwerk Bachs - Literaturverzeichnis - Glossar - Quellenangaben der Notenbeispiele
III. Zum Stil der Bachschen Passionen und zu deren
theologischen Bezügen
Den Passionen Bachs kommt ein stilistischer Eigenwert zu; sie sind mit anderen Werken dieser Gattung kaum vergleichbar. Der Komponist hat es verstanden, verschiedenartige Textquellen sowie unterschiedliche musikalische Techniken, beide aus divergenten historischen Bereichen stammend, zu einem homogenen Kunstwerk zu vereinen.
Die Unantastbarkeit des Bibelworts in Luthers Übersetzung stand für Bach wie für die Leipziger Kirchengemeinde außer Frage. Dieser konservativ-orthodoxe Standpunkt differierte mit jenem anderer protestantischer Zentren. In Hamburg war zum Beispiel die Nachdichtung des Evangelientextes üblich gewesen. In dieser Version hat Barthold Heinrich Brockes seine Libretti geschrieben; sie dienten als textliche Vorlage der Passionskompositionen von Händel und Telemann.
Bachs Passionen stehen in Bezug auf die Vertonung des Bibelworts in der Tradition von Johann Walter und Heinrich Schütz. Doch sind Wortausdeutungen bei Bach viel komplexer konzipiert, da in seinen Werken die Praktiken der musikalischen Rhetorik eine eindrucksvolle Deklamation und oft auch eine sinntragende Wort-Ton-Beziehung (Hypotyposis) ermöglichen. Das gilt nicht nur für die Solopartien, sondern auch für die Chorsätze der Turba-Texte, die den polyphonen, oft imitatorischen Stil motettischer Tradition dramatisch in die Schilderung des Geschehens einbringen.
In letzter Zeit wurde bisweilen die Frage aufgeworfen, ob Bach, vor allem in der Johannes-Passion, antijüdische Akzente gesetzt hat. Dies möchte ich verneinen; unter dem Begriff „die Jüden“ ist die anonyme Menschenmenge Jerusalems zu verstehen, deren Haltung zu Jesus zwischen dem „Hosianna“ vom Palmsonntag und dem „kreuzige ihn“ fünf Tage später schwankte. Martin Luthers Antijudaismus ist bekannt. Als gläubiger Protestant verstand Bach die Bibelworte jedenfalls als absolut gültig, auch in Luthers Übersetzung.
Die Wiederkehr gleichlautender Turba-Chöre belegt zwar die Insistenz der Forderung nach dem Tode Jesu, sie kann aber schwerlich als Symbol für die „Verstocktheit der Juden“ (Dagmar Hoffmann-Axthelm 1989, S. 50) verstanden werden. Dieser Ansicht hat Lothar Steiger (1994) entgegengehalten, daß die historische Ursache für den Tod Jesu im Verhalten der Juden wie der Heiden von Jerusalem liegt, daß aber, theologisch gesehen, die Schuld allen Christen der späteren Zeit zukommt. In diesem Sinne beantwortet die Bachsche Matthäus-Passion die Schuldfrage eindeutig mit den Worten „Ich bin’s, ich sollte büßen.“ Dieser Choraltext faßt Bachs eigenen Standpunkt und den der Leipziger Kirche eindrucksvoll zusammen.
Die evangelischen Kirchenlieder stellten in der reformatorischen Gottesdienstordnung, die auf die sogenannte ‚Deutsche Messe‘ (1526) von Martin Luther zurückgeht, eine wesentliche Neuerung dar. In der althergebrachten katholischen Meßfeier war der Gemeinde nur eine geringe aktive Beteiligung möglich gewesen; im Hauptteil der Messe, dem Canon missae, hatten die Gläubigen zu schweigen. Während ein Chor – sofern vorhanden – das Sanctus und das Benedictus sang, waren selbst die bedeutsamen Worte des Zelebranten unhörbar.
Im bewußten Gegensatz dazu bot die deutsche evangelische Kirche wie auch schon vorher die böhmisch-hussitische den gläubigen Laien im Gesang der Hymnen eine aktive Identifikation mit dem liturgischen Geschehen an. Für Martin Luther ist die Musik „eine schöne herrliche Gabe Gottes und nahe der Theologiae“ (Vorrede zu den ‚Symphonie iucundae‘). Eine Einbindung der bekannten Kirchenlieder in den Verlauf der langen Passionsaufführungen hatte daher zwei geradezu homiletische Wirkungen: Der Bibeltext regte zu persönlichem Bekenntnis an (,Ich‘-Lieder), und die Texte der bekannten und oft gesungenen Liedstrophen wurden durch ihre Platzierung in einen direkten Kontext zur jeweiligen Passionsaussage gestellt.
Die in der freien Poetik verwendeten Texte sind eigentlich aus der Bibelexegese abzuleiten, konkret aus den Predigten, denen ja nicht nur die Aufgabe katechetischer Lehre, sondern auch die der Weckung emotionaler Regungen im Zuhörerkreis zukommt. Aufgrund der Forschungen von Elke Axmacher (1985) ist erwiesen, welche Predigtsammlungen Bach und seine Librettisten gekannt haben müssen, aus denen sie als Laien theologisch vertretbare Wendungen und Sprachbilder übernehmen konnten, die auch die Leipziger Obrigkeit als zensierende Instanz anstandslos akzeptierte.
Die Predigten, vor allem die der protestantischen Glaubensgemeinschaften, waren im 17. und 18. Jahrhundert stark von der zeitgenössischen Rhetorik beeinflußt. Humanistische Denkrichtungen wußten die Formulierungsanweisungen von Cicero und Quintilian in die emphatische Sprachkunst der Zeit zu übernehmen. Dabei maß man den Hauptaufgaben der Rhetorik, nämlich docere – movere – delectare – persuadere (belehren – bewegen – erfreuen – überzeugen), eine neue Bedeutung zu.
Der Einfluß der klassischen Rhetorik auf die Musik vollzog sich über die Regeln zur kunstvollen Deklamation. Musik wurde als ‚Klangrede‘ begriffen. Aus der Systematik, wie eine wohlgesetzte Rede aufgebaut werden soll, übernahm die Musik Gliederungsbegriffe wie Exordium oder Conclusio. Der effektvolle Vortragsstil verlangte außerdem den sinnvollen Einsatz von ‚Figuren‘, welche die Bedeutung einzelner Aussagen durch einen die Mitteilung unterstreichenden Vortragsstil untermauern. Solche Figuren wurden aus der literarischen Rhetorik in die Kompositionslehre übertragen und auch dort mit den meist griechischen Fachausdrücken belegt. Sie beziehen sich in der Musik auf melodische, harmonische oder strukturelle Hervorhebungen, die als Ausschmückung des Tonsatzes verstanden wurden.
Die wesentlichen Kategorien der musikalischen Figurenlehre sind:
– Figuren der Bildhaftigkeit (Hypotyposis): Anabasis, Katabasis, Circulatio ...
– Wiederholungsfiguren: Anadiplosis, Klimax ...
– Pausenfiguren: Apokope, Abruptio, Suspiratio ...
– Intervallfiguren: Exclamatio, Passus duriusculus, Hyperbole, Interrogatio ...
– Satzfiguren: Katachresis, Parrhesia ...
Die Bedeutung dieser Begriffe wird im Glossar erläutert.
Die ursprünglich der Sprache vorbehaltene Formulierungskunst wurde etwa seit 1600 verstärkt auf die Kompositionstechnik übertragen, da sich die ausdrucksvolle (Vokal-)Musik stark an den rhetorischen Regeln orientierte, welche die mittelalterliche Spekulation, Musik sei tönendes Abbild des Kosmos, ersetzten (Gottfried Scholz 1993). Im Rahmen rhetorischer Praktiken zählt besonders die Affektenlehre zur Kunst, Gefühle zu wecken oder zu vermitteln. Im frühen 18. Jahrhundert war die Oper der spezielle Schauplatz, auf dem die unterschiedlichsten Affekte von rasender Rache bis zu schmerzlichstem Liebeskummer musikalisch effektvoll ausgedrückt wurden. Diese oft allzu dramatischen Expressionen waren der Kirchenmusik und ihren Oberen seit jeher suspekt. Andererseits kann sich eine Kompositionspraxis, die an zeitgebundene Hörgewohnheiten appelliert, nicht völlig der Ästhetik der jeweiligen Gegenwart verschließen. Bach stand also stilistisch zwischen zwei Positionen, wobei die eine auf der üblichen Reserviertheit von Kirchen gegenüber Neuerungen beruhte, die andere aber dem allgemeinen Zeitstil nach ausdrucksstarker Vermittlungsfähigkeit einer erregenden Botschaft entsprach. Wenn in Bachs Passionen wie in seinen Kantaten die Einbeziehung von Rezitativ und Arie zur Usance wurde, belegt dies bereits die stilistische Nähe zur Oper wie zum Oratorium seiner Zeit. Damit näherte er sich den stilistischen Grenzen, die der Leipziger Rat dem Thomaskantor als Leitlinie für sein kompositorisches Schaffen gesetzt hatte. Heißt es doch in Bachs Anstellungsrevers, seine Kirchenmusik dürfe nicht „opernhaftig“ sein. Als Gegengewicht wurde das evangelische Kirchenlied im üblichen Kantionalsatz, aber auch als cantus firmus innerhalb einer Arie oder eines bewegten Chorsatzes eingesetzt. Insgesamt verwischt sich die stilistische Trennung der drei funktionsbezogenen barocken Stilbereiche: Kirchen-, Theater- und Kammermusik. In diesem Sinne zeigt Bachs geistliche Musik die gleiche Tendenz, wie sie die Musikästhetik seines Hamburger Zeitgenossen Johann Mattheson erkennen läßt. Diese Entwicklung darf nicht mit dem Etikett „Verweltlichung der musica sacra“ abgetan werden; in der gegenseitigen Annäherung der drei Stile spiegelt sich eine langsame Emanzipation der Musik wider, die das Kunstwerk an sich stärker in den Vordergrund stellte, auf Kosten seiner Dienlichkeit gegenüber der erwünschten Funktion; damit wäre eine Brücke zu Beethoven geschlagen. Das heißt nicht etwa, daß Bach diesbezüglich als vorauseilender Revolutionär angesehen werden müßte; doch blieb auch er im Laufe seines langen Lebens nicht unbeeinflußt...
| Erscheint lt. Verlag | 9.12.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | Mainz |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Kunst / Musik / Theater ► Musik |
| Schlagworte | Bach • Johannes-Passion • Markus-Passion • Matthäus-Passion • Passionen |
| ISBN-10 | 3-7957-8550-2 / 3795785502 |
| ISBN-13 | 978-3-7957-8550-5 / 9783795785505 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich