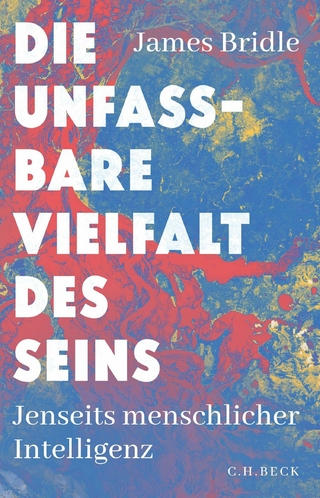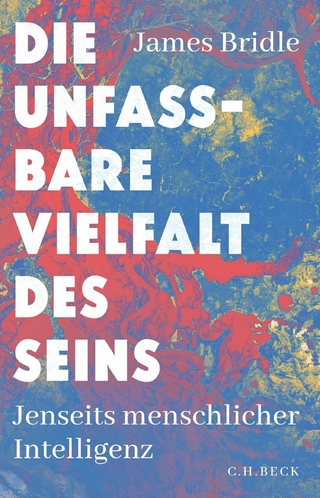Die Stadt in der Stadt (eBook)
XI, 454 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-07562-0 (ISBN)
PD Dr. Gabriela Muri ist Architektin und Kulturwissenschaftlerin, Privatdozentin für Populäre Kulturen an der Universität Zürich, Dozentin am Departement Soziale Arbeit der ZHAW sowie für Architektursoziologie an der ETH Zürich. Sie befasst sich in Forschungs- und Praxisprojekten mit raum- und zeittheoretischen Fragestellungen, mit Stadtentwicklung, Jugendkulturen sowie urbanen Eventkulturen.
PD Dr. Gabriela Muri ist Architektin und Kulturwissenschaftlerin, Privatdozentin für Populäre Kulturen an der Universität Zürich, Dozentin am Departement Soziale Arbeit der ZHAW sowie für Architektursoziologie an der ETH Zürich. Sie befasst sich in Forschungs- und Praxisprojekten mit raum- und zeittheoretischen Fragestellungen, mit Stadtentwicklung, Jugendkulturen sowie urbanen Eventkulturen.
Inhalt 5
Vorwort und Dank 11
1 Einleitung 12
1.1 Zur Relevanz des Situativen in der Gegenwart 14
1.2 Die Stadt in der Stadt 17
1.3 Urbane Öffentlichkeiten als Bühnen des Alltags 19
Bilder, Texte und Texturen – Simultaneität und Durchdringung 20
Paradoxe Ausgangslage: Alltagssituationen in urbanen Öffentlichkeiten 21
1.4 Fragestellungen und Arbeitshypothesen 21
Raum- und stadttheoretische Perspektive: Alltägliche Konstitution von Räumen in urbanen Öffentlichkeiten 21
Zeittheoretische und situationslogische Perspektive: Situation und Interaktionsordnung 23
Subjektorientierte Perspektive: Handlungsund Wahrnehmungsmuster in polyzentrisch orientierten Alltagsräumen 26
Bildtheoretische Perspektive: Bildrepräsentationen und Praxis im öffentlichen Raum 29
Erste Arbeitshypothese 30
Zweite Arbeitshypothese 31
1.5 Aufbau und Methoden 31
Bedeutung der Arbeit 32
Teil I Die Stadt in der Stadt 34
2 Die Stadt in der Stadt I: Die raumwissenschaftliche Perspektive 37
2.1 Raumanalyse als Gesellschaftsanalyse 38
2.2 Prozessualer Raumbegriff als forschungsleitende Konfiguration 40
2.3 Stadt als Forschungsfeld 43
Die „Unwirtlichkeit der Städte“ – Urbanität als Zauberwort 45
Die Entwicklung der Disziplinen Raumplanung und Städtebau 47
Urbanität und Öffentlichkeit 52
Zum Begriff der bürgerlichen Öffentlichkeit 53
Öffentlichkeit aus Sicht der Stadtsoziologie 59
2.4 Öffentlichkeitsbegriff und urbane Praxen der Gegenwart 61
2.5 Die Stadt in der Stadt: Zur Dualität von Begriff und Praxis 66
Urbanität und urbane Öffentlichkeit(en) 68
Urbane Öffentlichkeit zwischen Eventisierung und Alltagsnutzungen 71
Urbane Öffentlichkeiten als mehrdimensionale Forschungsfelder: Die Situation als Schlüsselbegriff 74
Stadttheorie im Kontext medialer, globaler und dynamischer Prozesse 75
Topologie: Raum als Informationsträger – Architektur als Medium 79
Die „randlose Stadt“ 80
Kontextbegriff und Architektur 82
Polykontextualität: Subjektive Lesarten über situativ erfahrbare Kontexte hinaus 85
Topologie als Untersuchungsperspektive auf den Raum 86
2.6 Städtischer Alltag: Widerspruch, Transformation, Überlagerung 87
Visualisierungen als Bilder „urbanen Alltags“ 90
Shoppingwelten: Die Inszenierung von Konsumkultur 91
3 Die Stadt in der Stadt II: Die zeitwissenschaftliche Perspektive 94
3.1 Harold Garfinkel: Zur situativen Ordnung von Alltagssituationen 99
3.2 Das Transitorische als Denkfigur einer zeittheoretischen Perspektive 102
Die transitorische Dimension als Element situativer Differenzerfahrung 104
3.3 Michel de Certeau: Praktiken und Taktiken 106
Universelles Subjekt – Interpretierender Akteur ? 110
Urbanologische Perspektive: Der Typus des urbanen Akteurs 111
Der Raum als Geflecht von beweglichen Elementen 114
Wahrnehmungphänomene: Gehen in der Stadt 116
3.4 Marc Augé: Die Moderne – Ein Übermaß an Zeit, Raum und Indiviuum 118
3.5 Temporalität als Dimension einer kulturellen Ordnung des Alltags 122
Zeit als Forschungsgegenstand der Sozial- und Kulturwissenschaften 122
Zeit als Teil eines kollektiv geteilten Wissensvorrates 125
Informelle Formen kultureller Zeiterfahrung 128
Zeit als Interpretationskategorie 130
Weltzeit und Lebensweltzeit als kulturelle Differenzerfahrung 132
Orte und Räume des Wartens 134
Goffmans These eines typisierbaren situativen Territorialverhaltens 136
Übergänge als Elemente von Zeitund Raumstruktur 138
3.6 Stadt und Gedächtnis 140
4 Die Stadt in der Stadt III: Sozialräumliche Kategorien und Konzepte 144
4.1 Henri Lefebvre: Theorie der Praxis, des Raumes und der Gesellschaft 144
La production de l’espace: Ein gesellschaftstheoretisches Konzept 145
Der soziale Raum ist ein soziales Produkt 147
L’espace perçu – die räumliche Praxis 148
Der Raum als cadre de vie 149
Räumliche Praxis: Planung, Architektur, Alltagsleben 150
L’espace conçu – Repräsentationen des Raumes auf der Ebene des Diskurses 151
L’espace vécu – Räume der Repräsentation 152
Probleme und Anschlussmöglichkeiten von Lefebvres Ansatz 154
Zusammenfassung: Lefebvres alltagstheoretische Konzeption 155
Zur Notwendigkeit einer Alltagstheorie im städtischen Kontext 157
4.2 Die Mensch-Umwelt-Beziehung: Sozial- und Kulturökologie 158
Sozialökologie 158
Umweltbegriff 160
4.3 Die Stadt als Bühne – Interaktionistisch-dramaturgische Ansätze 162
Soziotope, Behavior Settings und Skripts 162
4.4 Erving Goffman im Kontext einer mikrosoziologischen Perspektive 165
Goffmans raum- und zeittheoretische Perspektive 166
Goffmans Soziologie der Gelegenheiten 168
Rahmenanalyse: Situationen und Verhaltensnormen 169
4.5 Goffmans Rahmentheorie im Kontext des Symbolischen Interaktionismus 173
Methodologische Konsequenzen des Symbolischen Interaktionismus 176
4.6 Die Szene als Interaktions- und Atmosphärenkonstellation 178
4.7 Sozial organisierte Ausschnitte individueller Welterfahrung 180
Zur „Theatralität“ einer Konzeption des Situativen 182
Rahmen und Selbst: Die Rolle der Subjekte 183
4.8 Situative Identitätspolitik in einem habitustheoretischen Kontext 184
Oevermann: Soziologie der sozialen Deutungsmuster 187
Diskursive Praxis 188
Handlungssequenzen und soziale Ordnung 190
Ethnographie: Zur Relevanz einer zeitund situationstheoretischen Perspektive 191
4.9 Urbanität und Öffentlichkeit zwischen diskursiver Strategie und Praxis der Differenz 194
Anthony Giddens: Grundzüge einer Theorie der Strukturierung 194
Giddens: Handeln und Handelnde 195
Zur Dualität von Struktur als Medium und Ergebnis von Praktiken 197
Die Grenzen individueller Präsenz 197
Kopräsenz und soziale Integration 198
Zur zeitlichen Dimension von Giddens’ Konzeption 200
Zur Situiertheit von Interaktionen in Raum und Zeit 201
Sozial- und Systemintegration 203
Grundbegriffe der Theorie der Strukturierung 204
5 Die Stadt in der Stadt IV: Sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektiven 208
5.1 Aktuelle Ansätze der kulturwissenschaftlichen Stadtforschung 209
Stadtethnographie in Zürich 211
Anthropologie Urbaine 215
Entwicklungen in Deutschland seit den 1970er Jahren 218
Großstädte als Feld kultureller Differenzierung 220
Institut für Volkskunde in Hamburg 224
Zu einer spezifischen Methodologie der (Stadt-)Wahrnehmung 225
Urban Anthropology und Stadtsoziologie in den USA 226
Cultural Studies in Großbritannien 227
American Cultural Studies 228
5.2 Eine Theorie des Situativen im Kontext der Populärkultur ? 228
5.3 Stadt und Alltag: Zur sozialen Topographie von Wohnen und Quartier 231
Sozialgeschichte des Wohnens: gemeinnütziger Wohnungsbau 232
Quartier und Nachbarschaft 233
5.4 Städtische Lebensweisen und Gruppen 236
Gesellschaftliche Ränder und städtische Segregationsprozesse 238
Zur Problematik der Differenz: Kontextualisierung in Gegenwartspraxen 239
5.5 Globale Verstädterung und lokale Prozesse der Differenzproduktion 241
5.6 Globalisierung und urbane Öffentlichkeit 243
Teil II Die Stadt im Kopf: Stadtbilder und ihre Wahrnehmung 247
6 Die Stadt im Kopf: Theoretisch-methodologische Perspektiven 250
6.1 Stadtbilder und ihre Wahrnehmung 251
6.2 Kevin Lynch: The Image of the City 252
6.3 Soziales Handeln und Raumwahrnehmung 254
6.4 Die Methode der Mental Maps 259
6.5 Städtische Symbolstrukturen – Semantische Zugänge 261
Teil III Situative Alltagspraxen: Zwei Fallbeispiele 265
7 Erstes Fallbeispiel: Städtische Jugendszenen und die Reproduktion des Urbanen 268
7.1 Jugendliche Raumaneignung in einem Neubaugebiet 270
7.2 Zusammenfassung der Projektergebnisse 272
Raum- und Zeitpraxen als Felder jugendlicher Bedeutungsproduktion 273
Schnittstellen mit Erwachsenen – intergenerationale Wahrnehmung 274
Expertendiskurse und Raumgestaltung – Alltagspraxis 275
Raumwissen, Raumorientierung und dynamische Aneignung 276
7.3 Garfinkel: Wie wird intergenerationelle Ordnung situativ ausgehandelt ? 279
7.4 Goffman: Zur normativen Relevanz von Alltagssituationen 283
7.5 Alltagshandeln im Kontext von Giddens’ Theorie der Strukturierung 285
Erfahrungsräume und -chancen als Teil der Rekonstruktion des sozialen Raumes 285
7.6 Die Perspektiven der Subjekte: Sozialisationstheoretische Perspektiven 287
7.7 Raum, Zeit und Identität 288
Theoretisch-methodologische Perspektiven auf Raum- und Zeitdimensionen intergenerationeller Praxen im öffentlichen Raum 290
8 Zweites Fallbeispiel: Inszenierungen des Urbanen: Shoppingwelten und Konsumkultur 292
8.1 Konsumkultur und Konsumpraxen im gesellschaftlichen Kontext 293
Konsum und Konsumgesellschaft 294
Konsumsoziologie 295
Konsumkritik 296
8.2 Konsumkultur als Feld gesellschaftlicher Differenzierung 298
John Fiske: Einkaufen und milieuspezifische Konsummuster 299
8.3 Konsumkultur im Spannungsfeld zwischen ästhetischen und sozialen Dimensionen 300
Konsumkritik und alternative Konsummuster 302
8.4 Shoppingwelten: Stadt- und situationstheoretische Einordnung 303
Urbanologische Perspektive: Stadt als Kontext von Shoppingwelten 304
8.5 Konsumkultur als Teil der Populär- und Massenkultur 305
8.6 Praxen der (Re-)Produktion: Alltags- und situationstheoretische Einordnung 306
Polykontextualtität und diskursive Praxis 311
Teil IV Entwurf einer Theorie des Situativen 313
9 Zum Begriff der Situation 316
9.1 Die Beziehung zwischen Situation und Erfahrung 317
Die pragmatistische Konzeption der Wahrheit 318
Dewey: Die Situation als endogen wahrgenommene Erfahrung der Umgebung 319
9.2 Goffman: Die Situation als Teil öffentlicher Erfahrung 320
Dewey und Goffman: Konzeptionen und Dimensionen situativer Erfahrung 322
Situationen in urbanen Öffentlichkeiten: Zur Rolle von Umgebung und Kontext 322
Symbolischer Interaktionismus und die Rolle der Subjekte 323
Zur Semantik von Situationen 325
Der prozessuale Charakter situativen Handelns 326
9.3 Schütz, Luckmann: Die Situation als Element des Wissensvorrats 327
Typik und Relevanz von Wissenselementen in Situationen 329
Zur sozialen Bedingtheit des Wissensvorrats und seiner Relevanz für Situationen 330
9.4 Zur Frage der Generalisierbarkeit von Alltagssituationen 331
Die „cognition distribuée“ als Element der Erfahrung 332
Eine interpretativistische Konzeption des situativen Handelns ? 333
Die Wahrnehmung einer situativen Umgebung als sozialer Akt 334
Mead: Situation als sozialer und prozessualer Akt 335
9.5 Wahrnehmung und soziales Handeln 337
Die intentionale Struktur der sinnlichen Wahrnehmung 339
9.6 Wahrnehmung in einem situativ relevanten soziokulturellen Kontext 340
Situationen als Bedeutungsträger 341
Zur Reichweite von Situationen 343
Alltagsereignisse und Wahrnehmung 345
Situationen als komplexe Wahrnehmungs-, Erfahrungs- und Handlungszusammenhänge 345
9.7 Ethnographische Forschungsfelder als Elemente einer Theorie des Situativen 346
Teil V Die Stadt in der Stadt: Synthese 351
10 Raumtheoretische Einordnung: Zur gesellschaftlichen und prozessualen Bedingtheit des Raumes 354
10.1 Stadttheoretische Einordnung 355
Urbane Öffentlichkeit im Fokus von Städtebau und Planung 357
10.2 Urbane Öffentlichkeiten: Kulturökologie und Umweltbegriff 358
Ein für typisches Verhalten strukturierter Ausschnitt aus der Wirklichkeit 359
11 Zeit- und situationstheoretische Einordnung 361
11.1 Differenz als Element situativ ausgehandelter sozialer Ordnung 361
11.2 Das Transitorische als Denkfigur einer zeittheoretischen Perspektive 362
„Am Rande gehen“: Stadtraumspezifische Rhetorik des Gehens 363
Zielloses Umhergehen: Jugendspezifische Rhetorik des Gehens 364
11.3 Zeit und Situation: Prozess, Diskontinuität, Überlagerung 365
Zur Differenz im Erleben und Deuten urbaner Öffentlichkeiten im Alltag 367
Typologie von situativen Kontexten: Zeitlichkeit als Analysekategorie 368
Stadt und Gedächtnis 370
12 Gesellschaftstheoretische Einordnung: Praxis und normatives Handeln 371
12.1 Lefebvre: Theorie der Praxis, des Raumes und der Gesellschaft 371
12.2 De Certeau: Alltägliche Praktiken und Taktiken 373
12.3 Goffman: Der Rahmen als normatives Konzept situativer Begegnungen 374
Urbane Öffentlichkeiten als normativ wirksame Bedeutungskontexte 375
13 Kultur- und alltagstheoretische Einordnung: Das sinnverstehende Subjekt 377
13.1 Universelles Subjekt – Interpretierender Akteur ? 378
13.2 Alltagspraxis: Soziale Interaktion als interpretativer Prozess 378
Rahmungswissen als Verstehens- und Performanzwissen 380
13.3 Normalität und Abweichung versus situative Handlungskompetenz 381
14 Urbanologische Perspektive: Urbane Kontexte des Situativen 383
14.1 Urbane Kontexte – Pop-Kontextualismus 383
Kultur als Kontext – Stadt als Kontext 387
14.2 Differenztheoretische Begründung von Kontext und Kontextualität 389
Raumbegriff und städtebaulicher Kontext: Das Problem der Materialität 391
Räume und Verhaltensdispositionen 392
14.3 Kontextualität aus sozialisationstheoretischer Perspektive 393
15 Bildtheoretische Einordnung: Zur Semantik urbaner Öffentlichkeiten 394
15.1 Zur Bildhaftigkeit urbaner Öffentlichkeiten 395
15.2 Diskursiv relevante Bildrepräsentationen urbaner Öffentlichkeiten 396
Visualisierungen als Bilder eines spezifischen urbanen Alltags 397
Sichtbar und unsichtbar machen 397
15.3 Medial relevante Bildrepräsentationen urbaner Öffentlichkeiten 400
15.4 Populärkulturell relevante Bildrepräsentationen urbaner Öffentlichkeiten 403
16 „Das Forschungsfeld“: Kontext und Kontextualität 406
16.1 Ethnographische Forschungsfelder: Ausschnitte aktueller Präsenz 408
16.2 Urbane Kontexte, Orte und Nicht-Orte der Gegenwart 409
Augé: „Man ist dort zuhause, wo man sich in der Rhetorik auskennt“ – Kontextbedingungen von Identitätspolitik 410
16.3 Habitus- und Identitätspolitik: Verhaltensdispositionen zwischen urbanen und virtuellen Öffentlichkeiten 410
17 Ethnographische Forschungsfelder als Elemente einer Theorie des Situativen 412
17.1 Polykontextualität und situative Ordnung des Wissens 413
17.2 Stadtethnographie: Präsenz und Wahrnehmung des situativen Kontextes 418
Die Beobachtung von Alltagsausschnitten 419
Alltagsausschnitte und ihr situativ relevantes soziokulturelles Umfeld 422
Situativ relevante Bedeutungsaushandlung im Kontext der Populärkultur 423
17.3 Dynamik und Prozesshaftigkeit der situativen Bedeutungsaushandlung 424
Ethnographische Forschungsfelder als Elemente einer Theorie des Situativen 425
Urbanität und Öffentlichkeit zwischen diskursiver Strategie und Praxis der Differenz 425
Raum- und zeittheoretische Einordnung individueller Präsenz 426
Raum-Zeit-Wege in urbanen Öffentlichkeiten: Kopräsenz, Positionierung, Regionalisierung oder Polykontextualität ? 427
17.4 Zur Problematik der Raum-Zeit-Ausdehnung urbaner Forschungsfelder 428
17.5 Synthese und Ausblick 431
Bibliographie 435
| Erscheint lt. Verlag | 17.12.2015 |
|---|---|
| Zusatzinfo | XI, 454 S. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Kunst / Musik / Theater ► Malerei / Plastik |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie | |
| Technik ► Architektur | |
| Schlagworte | Raumtheorie • Situationsnanalyse • Stadtethnografie • Stadtforschung • Urbane Alltagspraxis • Zeittheorie |
| ISBN-10 | 3-658-07562-7 / 3658075627 |
| ISBN-13 | 978-3-658-07562-0 / 9783658075620 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich