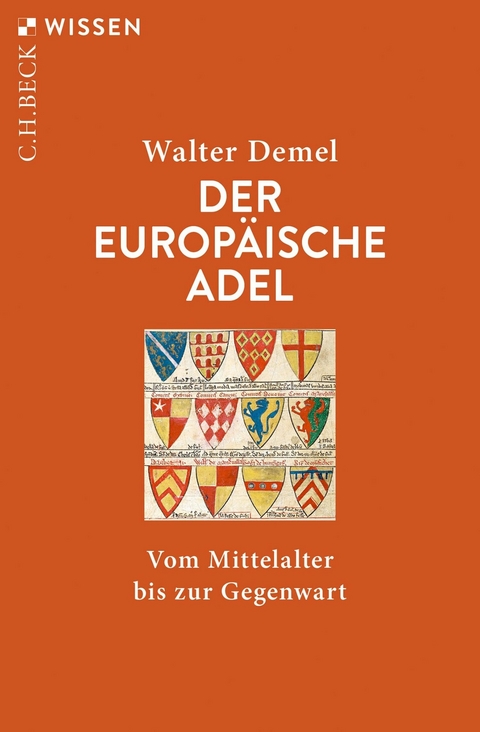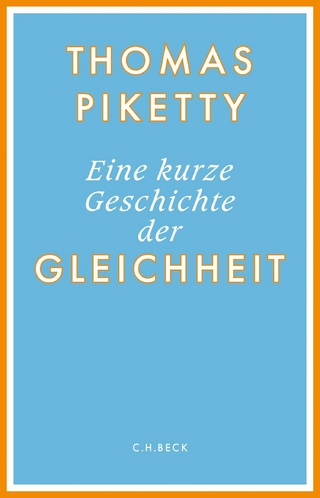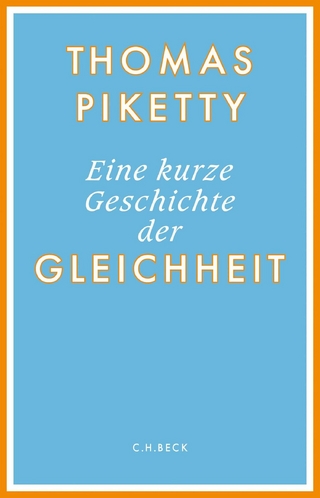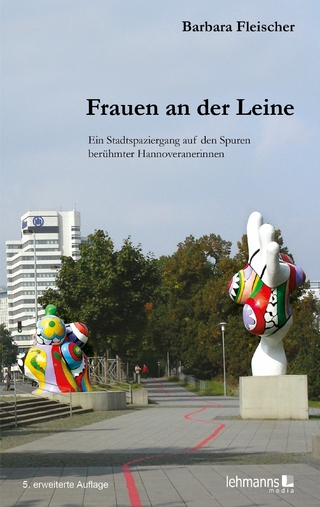Der europäische Adel (eBook)
128 Seiten
Verlag C.H.Beck
978-3-406-81322-1 (ISBN)
Walter Demel war von 1989 bis 2018 Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität der Bundeswehr München.<br>
II. Der Adel im Mittelalter
Macht, gesellschaftlich wichtige Funktionen, Reichtum, Ansehen und/oder Vorbildwirkung kennzeichnen Eliten, wobei Ansehen Einfluss verleiht und insofern auch eine Art (potenzieller) Macht darstellt. Im europäischen Mittelalter und teilweise noch länger spielte der Adel sogar die Rolle einer multifunktionalen Elite. Denn er dominierte durch seine Ämter und seine Macht politisch und militärisch, durch seinen Herrschaftsbesitz ökonomisch, durch sein überlegenes Prestige sozial und durch das Vorbild seiner Lebensweise und sein Mäzenatentum auch kulturell. Um aber zu einem «Adelsstand» zu werden, muss sich eine Elite bzw. Oberschicht auch rechtlich von der übrigen Bevölkerung absetzen, also «institutionalisieren», durch bestimmte erbliche Vorrechte wie z.B. ein Monopol auf gewisse Ämter. Da sich für das Frühe Mittelalter allenfalls ererbtes Ansehen und konkrete Macht, nicht aber eine erbliche gehobene Rechtsstellung sicher nachweisen lassen, möchten manche Historiker für diese Zeit sogar ganz auf den Begriff «Adel» verzichten.
1. Grundlagen des europäischen Adels im Frankenreich
Das Vorbild aller späteren «europäischen» Adelsbildungen dürfte – so jedenfalls die These von K. F. Werner – der christianisierte römische Senatorenadel gewesen sein. Dessen Angehörige hatten ursprünglich sozusagen eine angeborene Anlage dazu besessen, vom Kaiser in hohe Ämter (honores) berufen zu werden. Seit Kaiser Konstantin (†337) kehrte sich dieses Verhältnis zeitweise um: Wer in ein hohes Amt berufen wurde, trat in den «Kaiserdienst» in Verwaltung, Heer oder Episkopat ein. Ein persönlicher Treueeid verpflichtete ihn zum Gehorsam, band ihn geradezu an den Herrscher – bestand das Zeichen seines Amtes doch in einem Gürtel. Erst dadurch gehörte er zu den «Adeligen» (nobiles), und die in der Ämterlaufbahn erreichte Stellung bestimmte seinen Rang. Hier war also ein meritokratisches Element angelegt. Wie die späteren Kaiser und Könige, aber auch kleinere selbstständige Fürsten und Herren sich am Vorbild des autokratischen, nunmehr christlichen Kaisers orientiert hätten, habe sich der Adel – so Werner – seitdem als Repräsentant der «öffentlichen Gewalt» als auch der Kirche gefühlt, mit einer mehr oder minder ausgeprägten Treue gegenüber dem «ersten Mann» im «Staat».
Tatsächlich dominierten im Gebiet des heutigen Frankreich zu spätrömischer Zeit die Mitglieder einer gallorömischen, vorrangig aus dem Senatorenadel gebildeten Oberschicht. Sie verfügten über große Ländereien, eine zahlreiche, auch militärisch einsetzbare Klientel und besetzten die höheren Verwaltungspositionen und die Bischofsstühle. Dabei förderten die meist adeligen Bischöfe den Kult eines oder mehrerer Stadtheiliger und gewannen damit eine Legitimation dafür, dass sie sich zunehmend zu den eigentlichen Herren der alten Römerstädte in Gallien (und Norditalien) aufschwangen. Denn je mehr die Zentralgewalt an Einfluss verlor und deren Vertreter nicht, wie auf der Iberischen Halbinsel häufig, ihre Stellung einigermaßen zu halten vermochten, sondern emigrierten, aufs Land zogen bzw. sozial absanken, desto mehr wuchsen dem Episkopat auch weltliche Führungsaufgaben zu. Ähnlich wie im Falle des Petrusgrabs in Rom verlieh etwa in Tours, Trier, Köln oder Reims nicht zuletzt die Aufsicht über Heiligengräber bzw. -reliquien den dortigen Bischöfen sogar eine überregionale Bedeutung. So konnten sie zu Partnern der Merowinger werden.
Spätestens im 5./6. Jahrhundert hatten Germanen (wie auch Slawen und andere Indoeuropäer) ebenfalls ihre vornehmen Familien: Diese zeichneten sich durch ihr Ansehen qua Geburt, ihren Ahnenkult, umfangreichen, vererbbaren Besitz und die Bildung eigener Heiratskreise aus. Sie trugen lange Haare, lebten auf großen Herrenhöfen und konnten sich – für eine Mangelgesellschaft ungewöhnlich – regelmäßig reichhaltiges und gutes Essen leisten. Ebenso verfügten sie über eine bessere Kleidung mit besonderem, etwa aus Edelmetall bestehendem Schmuck. Zum Teil importierte Luxuswaren wie orientalische Gewürze symbolisierten ihren gehobenen Status. Dieser wurde selbst nach ihrem Tod – durch entsprechende Grabbeigaben – dokumentiert.
Im Jahre 498 hatte sich der (wie bereits sein Vater) als römischer Provinzkommandant und -verwalter (dux) agierende Frankenkönig Chlodwig I. vom Bischof von Reims, ebenfalls einem Generalssohn, taufen lassen – was ihn übrigens nicht daran hinderte, weiterhin selbst innerfamiliäre Gegner mit der Streitaxt aus der Welt zu schaffen. Ihm folgten die Großen seines Reiches, womit auch deren Untertanen und damit formal alle Franken römische Christen wurden. Chlodwigs besondere Stellung wurde formell anerkannt, als ihn 508 der (ost-)römische Kaiser als «ruhmreichsten König» und, auch im Verhältnis zu den fränkischen Bischöfen, als «frommen Ersten» (pius princeps) bezeichnete. Gerade von Seiten dieser Bischöfe wurden daraufhin Chlodwigs Nachfolger sogar mit Titeln angesprochen, die bis dahin dem Kaiser selbst vorbehalten gewesen waren. Das spätere fränkische Königtum bzw. Kaisertum wuchs also sowohl aus germanischen Wurzeln (Sakral-, Heereskönigtum) hervor wie auch aus dem Anspruch auf die Nachfolge der (west-)römischen Kaiserherrschaft, die bekanntlich seit dem 4. Jahrhundert christlich geprägt war. Es gewann dabei Einkünfte aus den Städten und erlangte Einfluss auf die Besetzung von Bistümern und auf die Entwicklung der Herzogtümer östlich des Rheins. Wie ihre Könige bzw. Herzöge begannen sich aber auch fränkische, alemannische und bayerische Herren von der übrigen Bevölkerung durch die Gründung christlicher Kirchen und Klöster sowie separate Grablegen abzusetzen – vielleicht eine Art «Selbstsakralisierung» von Königtum und entstehendem Adel: Herrschaftsausbau und Mission standen in engem Zusammenhang. Auch die Herrscher germanischer Herkunft tendierten jedoch schon seit Chlodwig I. dahin, als «adelig» (nobiles) nur diejenigen Vornehmen zu bezeichnen, die in ihren Dienst traten. Erblich wurde dieser Status der Amtsinhaber erst langsam seit dem 7. Jahrhundert.
Im Frankenreich gewannen nun Gruppen dieser «Größeren von Geburt» (maiores natu) mit der Ausweitung des Reiches auf Kosten der übrigen gallischen Königreiche (z.B. 534 Unterwerfung Burgunds) und den Konflikten innerhalb der Herrscherdynastie der Merowinger seit dem späten 6. Jahrhundert offiziell politische Mitspracherechte auf regionaler Ebene. So gestand ihnen König Chlothar II. im Jahre 614 zu, dass Grafen als Vertreter der königlichen Macht und Gerichtsgewalt ausschließlich aus den Grundherren der jeweiligen Region ausgewählt werden sollten. Das förderte die Tendenz zur Erblichkeit dieses Amtes. «Graf» (comes) war aber ursprünglich ebenso ein römischer Titel wie «Herzog» (dux), mit dem er bisweilen wechselte, wenngleich sich größere «Herzogtümer» eher in den Rand- als in den Kernregionen des Frankenreiches voll auszubilden und wenigstens zeitweise weitgehend zu verselbstständigen vermochten.
Kein Zufall jedenfalls, dass im 7. Jahrhundert in den Bischofslisten des Frankenreichs germanische Namen stark hervortreten. Die fränkische Oberschicht entwickelte nämlich ein neues, christlich-adeliges Selbstverständnis und verschmolz immer mehr mit ihrem gallorömischen Pendant zu einer fränkischen «Reichsaristokratie», die auf regionaler Ebene die Grafen, Bischöfe und Äbte stellte. Diese Kombination von Bischofsmacht und regionaler Herrschaft gefährdete zeitweise sogar den Zusammenhalt des Reiches. So gelang es den Karolingern, gestützt auf weitere mächtige Familienverbände, sich in ihrem Amt als Hausmeier aus der Abhängigkeit von den Merowingerkönigen zu befreien und eine selbstständige, konkurrierende Machtstellung aufzubauen. Nachdem sie aber die Merowinger im Jahre 751 mit päpstlichem Segen als Könige beerbt hatten, war es vor allem Karl der Große, der das Reich konsolidierte. Er setzte Grafen mit erweiterten Rechten in gefährdeten Marken = Grenzgebieten ein, unterwarf und christianisierte endgültig die Sachsen und brach die Macht der weitgehend unabhängig gewordenen Herzöge von Bayern und Aquitanien. Dabei stützte er sich auf neue Einrichtungen: 1. einen glänzenden, stilbildenden Hof in der Aachener Pfalz als kulturelles Zentrum, 2. besondere Vertraute, die er als eine Art frühe Vasallen durch Eid an sich band und zur Kontrolle der Grafen in die Provinzen entsandte, 3. eine reiche, mächtige und im Dienste des riesigen Imperiums hoch mobile, freilich fluktuierende «Reichsaristokratie», die sich überwiegend aus traditionellen Gefolgsleuten der Karolinger, aber auch aus Angehörigen regionaler...
| Erscheint lt. Verlag | 15.2.2024 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Beck'sche Reihe |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Literatur ► Historische Romane | |
| Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Allgemeines / Lexika | |
| Reisen ► Reiseführer ► Europa | |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Regional- / Ländergeschichte | |
| Schlagworte | Adel • Adelsgeschlecht • Bevölkerung • Edelmann • Entmachtung • Erziehung • Europäische Geschichte • Familie • Franken • Frankenreich • Französische Revolution • Geschichte • Heirat • Hierarchie • Kultur • Mittelalter • Neuzeit • Niedergang • Privilegien • Ritter • Wirtschaft |
| ISBN-10 | 3-406-81322-4 / 3406813224 |
| ISBN-13 | 978-3-406-81322-1 / 9783406813221 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 475 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich