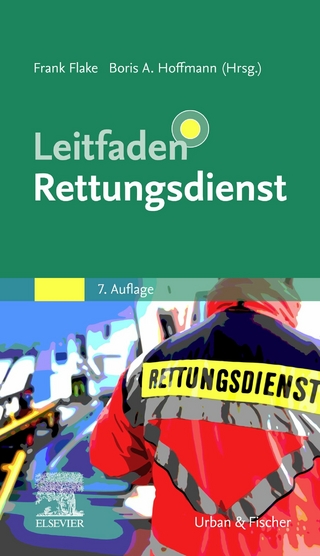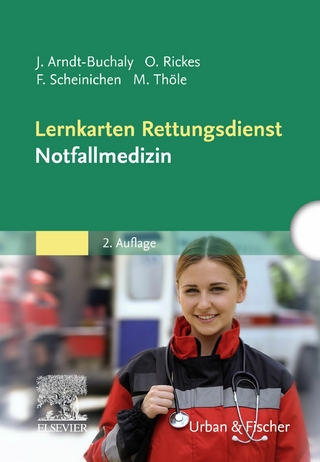Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen II (eBook)
XIV, 362 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden (Verlag)
978-3-658-12393-2 (ISBN)
Mario A. Pfannstiel, M.Sc., M.A., ist Fakultätsreferent an der Fakultät Gesundheitsmanagement und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum „Vernetzte Gesundheit“ an der Hochschule in Neu-Ulm.Prof. Dr. Patrick Da-Cruz ist Professor für Gesundheitsmanagement an der Hochschule Neu-Ulm, wo er auch als Mitglied des Kompetenzzentrums „Vernetzte Gesundheit“ und Leiter des MBA-Programms für Ärztinnen und Ärzte tätig ist. Prof. Dr. Harald Mehlich ist Dekan der Fakultät Gesundheitsmanagement an der Hochschule Neu-Ulm und Mitglied im Kompetenzzentrum „Vernetzte Gesundheit“.
Vorwort 5
Inhaltsverzeichnis 8
Herausgeberverzeichnis 11
1 Grad der Digitalisierung im Gesundheitswesen im Branchenvergleich – Hinderungsgründe und Chancen 13
Zusammenfassung 13
1.1Einleitung 14
1.2Das Gesundheitswesen im Branchenvergleich 15
1.3Warum ist das Gesundheitswesen gering digitalisiert? 18
1.4Entwicklungsmöglichkeiten und Ansätze für eine höhere Digitalisierung 19
1.5Schlussbetrachtung 21
Literatur 22
2 Design Thinking Based Digital Transformation in Healthcare 24
Zusammenfassung 24
2.1Einleitung 25
2.2Qualität als wettbewerbsentscheidendes Element im Gesundheitswesen 25
2.3Von (Teil-)Prozessen zur holistischen Betrachtung von Gesundheitsdienstleistungen 25
2.4Durch Design Thinking zum Human-Centered Design 26
2.5Digitale (Mehrwert-)Transformation 29
2.6Schlussbetrachtung 31
Literatur 31
3 Leadership Agility und Digitalisierung in der Krankenversicherung – Steigende Komplexität und wachsende Dynamik der Digitalisierung erfordern zunehmend agile Organisationen und agile Führungskräfte 34
Zusammenfassung 34
3.1Einleitung 35
3.2Digitalisierung in der Krankenversicherung heute 37
3.2.1Wirkung der Digitalisierung auf die Wertschöpfungskette 39
3.2.1.1 Leistungs- und Versorgungsmanagement 39
3.2.1.2 Produktentwicklung-management 40
3.2.1.3 Mehrere Schritte die Wertschöpfungskette betreffende und generelle Trends 41
3.2.1.4 Zwischenfazit 43
3.3Warum klassische Führungs- und Organisations-Modelle im Kontext der Digitalisierung an ihre Grenzen stoßen 44
3.3.1Was Komplexität von Kompliziertheit unterscheidet 46
3.3.2Organisation und Führung im Kontext hoher Dynamik 47
3.4Agile Organisation und Führung 48
3.4.1Wie es Unternehmen gelingt, agiler zu werden 49
3.4.2Agile Organisation in der Krankenversicherung – Beispiele aus der Praxis 52
3.4.3Leadership Agility als Führungskompetenz 53
3.4.4Grenzbereiche der Agilität in der Krankenversicherung 57
3.5Schlussbetrachtung 57
Literatur 58
4 Preissetzung bei mehrseitigen Plattformen: Theoretische Überlegungen und empirische Befunde am Beispiel einer Seniorenplattform 62
Zusammenfassung 62
4.1Einleitung 63
4.2Mehrseitige Plattformen 64
4.3Preissetzung für mehrseitige Plattformen 66
4.4Empirische Untersuchung 68
4.4.1Empirische Untersuchung der Nutzerseite 68
4.4.2Empirische Untersuchung der Anbieterseite 71
4.5Ableitung von preispolitischen Empfehlungen 74
4.6Schlussbetrachtung 75
Literatur 76
5 Die Radiologie im Krankenhaus – Welchen Nutzen haben Digitalisierung und technische Innovation in der Praxis? 78
Zusammenfassung 78
5.1Einleitung 79
5.2Leistungsbereiche und Prozesse in Krankenhäusern 79
5.3Einführung in die Fallbeispiele 81
5.3.1Fallbeispiel I: High-End-Computertomografie 82
5.3.2Fallbeispiel II: Assistenzsoftware 84
5.4Schlussbetrachtung 84
Literatur 86
6 Reinigungsprozesse im OP – Eine Analyse am Beispiel der Zentral-OPs der Universitätsmedizin Greifswald 87
Zusammenfassung 87
6.1Einleitung 88
6.2Hintergrund 89
6.3Methodik 89
6.4Ergebnisse, Reinigungen, Prozessbeschreibung 90
6.5Prozessdauer 91
6.6Reinigungskräfte und Art der Reinigung 93
6.7Bodentrocknung 94
6.8Diskussion 94
6.9Schlussbetrachtung 96
Literatur 96
7 Verbesserung der Prozessqualität bei Traumapatienten durch digitale Bild- und Dokumentenübermittlung 99
Zusammenfassung 99
7.1Ursprünge des Traumanetzwerkgedankens 100
7.1.1Anfänge der präklinischen und klinischen Vernetzung in Ostbayern 101
7.1.2Das Weißbuch der DGU 102
7.1.3Die Entstehung der Initiative TraumaNetzwerk DGU® 104
7.2Teleradiologische Vernetzung 105
7.2.1Anforderungen an die teleradiologische Bildübertragung 105
7.2.2Innovatives Projekt Telekooperation TNW® bzw. TKmed® 106
7.3Verbesserung der Prozessqualität bei Traumapatienten durch elektronische Bild- und Dokumentenübermittlung 108
7.3.1Die Notfallverlegung: Jede Sekunde zählt 110
7.3.2Die ZweitmeinungSecond Opinion 111
7.3.3Optimierung von Arbeitsabläufen: Vor- und Nachbehandler 113
7.4Schlussbetrachtung 114
Literatur 115
8 Content-Marketing als Strategie der Zukunft im Krankenhaus 117
Zusammenfassung 117
8.1Verschärfter Wettbewerb und ein verändertes Patientenverhalten machen Klinikmarketing notwendig 118
8.1.1Der Patient entscheidet (mit) 119
8.1.2Die Klinik als Marke 121
8.1.3Klinikmarketing heute 122
8.2Content-Marketing 123
8.2.1Begriffserklärung 124
8.2.2Chancen und Möglichkeiten durch Content-Engagement 126
8.3Webseitenanalyse der Internetauftritte deutscher Kliniken 127
8.3.1Studiendesign 127
8.3.2Ergebnisse 128
8.4Schlussbetrachtung 133
Literatur 133
9 Klinik-Patientenservice Online – Eine Analyse der Patientenorientierung am Beispiel des Awards „Deutschlands Beste Klinik-Website“ 138
Zusammenfassung 138
9.1Einleitung 139
9.2Der Award Deutschlands beste Klinikwebsite 139
9.2.1Ablauf und Bewertung 139
9.2.2Die patientenfreundliche Webseite nach imedON 140
9.2.3Die Auswertungen beim Award 140
9.3Die Trends 145
9.3.1Trend 1: Dialog mit Usern 146
9.3.2Trend 2: Mobile Anwendungen 147
9.4Schlussbetrachtung 147
Literatur 148
10 Semantische Analyse klinischer Dokumentation 149
Zusammenfassung 149
10.1Einleitung 150
10.2Datenschatz: Klinische Dokumentation 150
10.3Semantische Analyse von OP-Berichten 153
10.4Anwendungsszenarien 154
10.4.1Anwendung zur Entlassungscodierung 155
10.4.2Anwendung zur Codierqualität und im MDK-Management 155
10.4.3Anwendung zur Qualitätssicherung 156
10.5Schlussbetrachtung 157
Literatur 158
11 Digitales Entscheidungsmanagement in der Medizin: Modellierung von Behandlungsempfehlungen in der Onkologie 160
Zusammenfassung 160
11.1Einleitung und Problemstellung 161
11.2Material und Methoden 162
11.2.1Stand der Forschung 162
11.2.2Analyse der Prozesse und der Entscheidungen 163
11.2.3Entscheidungsgrundlage beim Mammakarzinom 163
11.2.4Modellierungsgrundlagen 164
11.3Ergebnisse 166
11.3.1Präoperative Tumorkonferenz 166
11.3.2Postoperative Tumorkonferenz 168
11.4Schlussbetrachtung 169
Literatur 171
12 Innovative Dienstleistungen und Lösungen zu elektronischen Patientenakten und digitalen Signaturen – Aktueller Stand und Perspektiven für das deutsche Gesundheitswesen 174
Zusammenfassung 174
12.1Vorteile von digitaler Archivierung und Langzeitsicherung 175
12.2Einrichtungsübergreifende Patientenakten 176
12.3Einrichtungsübergreifende Informationsverarbeitung 177
12.4Digitale Signaturen und Langzeitsicherung 178
12.4.1Ersetzendes Scannen und Signieren von Dokumenten 179
12.4.2Langzeitmanagement signierter Daten im Archiv 180
12.4.3Signaturrelevante (digitale) Dokumente 180
12.4.4Integration von digitalen Signaturen in klinische Systeme 181
12.5Schlussbetrachtung 182
Literatur 183
13 IT-gestütztes leitliniengerechtes Versorgungsmanagement onkologischer Patientinnen und Patienten intersektoral und interprofessionell 185
Zusammenfassung 185
13.1Einleitung 186
13.2Grundlagen 187
13.2.1Sektorübergreifendes Versorgungsmanagement 187
13.2.2Versorgungsmanagementplattform 189
13.2.3Formalisierung von Leitlinien 190
13.2.4Die elektronische Fallakte (EFA) 191
13.3AnnahmenVoraussetzungen 192
13.3.1Auswahl onkologischer Indikationen 192
13.3.2Der Aktenmoderator – Rolle im Kontext des Datenschutzes 193
13.3.3Einsatz der EFA 195
13.3.4Datenmodell 196
13.4Datenschutzkonzept 198
13.5Lösungsarchitektur 199
13.5.1Formalisierte Leitlinien 200
13.5.2Elektronische Fallakte 200
13.5.3VM-Plattform 202
13.6Fallbeispiel 203
13.7Bewertung 207
13.8Schlussbetrachtung 208
Literatur 208
14 Individualisierung durch Digitalisierung am Beispiel der stationären Pflegeversorgung – Organisations- und informationsökonomische Aspekte 211
Zusammenfassung 211
14.1Herausforderungen an die (stationäre) Pflege 212
14.2Digitalisierung in der (stationären) Pflege: Status quo 213
14.3Ökonomie der stationären Pflege 215
14.3.1Stationäre Pflege als soziale Dienstleistung im organisationsökonomischen Kontext 215
14.3.2Wertschöpfung in der stationären Pflege 216
14.4Wertschöpfungsorientierte Digitalisierung 220
14.4.1Individualisierung vs. Standardisierung von Dienstleistungen 220
14.4.2Ansatzpunkte der Digitalisierung in der stationären Pflege 222
14.4.2.1 Standardisierte Prozessinformation: Informationsmonitoring und anlassgebundene Pflege 223
14.4.2.2 Erweiterte Informationsbereitstellung: Individualisierte Pflegeplanung und Ausblick auf Big Data 225
14.5Digitalisierung in der stationären Pflege: Praxisbeispiele 226
14.6Digitalisierung der stationären Pflege: Herausforderungen 227
14.7Schlussbetrachtung 228
Literatur 229
15 Hilfe, die Silver Surfer kommen!? Die Generation 60+ und ihr verändertes Kommunikationsverhalten im Web 233
Zusammenfassung 233
15.1Einleitung 234
15.2Mediennutzung im Alter – etwas Zahlenmaterial 234
15.2.1Altersentwicklung 235
15.2.2Computer- und Internetnutzung im Alter 235
15.2.3Mobiladoption unter Senioren 236
15.2.4Social Media-Nutzung im Alter 237
15.2.5Beurteilung von Chancen und Risiken 238
15.2.6Nutzung von online und digitalen Gesundheitsangeboten 238
15.3„Alt sein“ im 21. Jahrhundert – ein Bruch mit Stereotypen 239
15.4Gesundheitskommunikation und Healthcare Marketing für Senioren 240
15.4.1Die Anforderungen der Offliner: E-Inklusion, Prescribe Design und Unterstützung der Care Giver 241
15.4.2Die Anforderungen der Silver Surfer: Kommunikation, Partizipation und Transparenz 243
15.5Schlussbetrachtung 243
Literatur 244
16 Digitalisierung in der Pharmaindustrie 247
Zusammenfassung 247
16.1Einleitung 248
16.2Von Pharma 1.0 zu Pharma 3.0 250
16.3Big Data in Pharma 252
16.4eHealth 253
16.5mHealth 254
16.6Telemedizin 254
16.7Digitalisierung in Pharma F& E
16.8Fallbeispiel: 3-D-Druck in Pharma 256
16.9Risiken der Digitalisierung von Pharma 258
16.10Schlussbetrachtung 259
Literatur 260
17 Entwicklung und Design einer Mobile-Learning-Applikation für die Schulung afrikanischer Krankenhausmitarbeiter 262
Zusammenfassung 262
17.1Einleitung 263
17.2Eingrenzung M-Learning zu E-Learning und Blended Learning 263
17.3Kontextspezifisches Beispielprojekt aus dem Bereich M-Learning 265
17.4Design und Entwicklung der Applikation HMHP Mobile 265
17.4.1Ausgangssituation für die mobile Applikation 266
17.4.2Entwicklung der Applikation 268
17.4.3Design der Applikation 269
17.4.4Einsatz der Applikation 272
17.5Ausblick 273
17.6Schlussbetrachtung 273
Literatur 274
18 Cross Market Innovation: Erschließung neuer Dienstleistungsmärkte am Beispiel von mHealth 275
Zusammenfassung 275
18.1Disruptiver Wandel in der Gesundheitswirtschaft 276
18.2Cross Market Innovation 278
18.2.1Bestimmungsgründe und inhaltliche Abgrenzung des Konzepts 279
18.2.2Neue Marktperspektiven eröffnen Handlungsfelder 281
18.2.3Gestaltungsoptionen zur Erschließung neuer Handlungsfelder 290
18.3Fallstudie zur Erschließung eines neuen Markts 294
18.3.1Versorgungssituation als Marktproblem 295
18.3.2Betroffene als Manager der Depression 296
18.3.3ARYA als Stakeholder induzierte Marktinnovation 299
18.4Schlussbetrachtung 300
Literatur 302
19 Digitales Diagnose-Unterstützungssystem ATLAS OPHTHALMOLOGY hilft Augenärzten im Praxisalltag 304
Zusammenfassung 304
19.1Einleitung 305
19.2Absicht 305
19.3Methode 306
19.3.1Bilderdatenbank 306
19.3.2Submission und Review neuer Fälle 311
19.3.3Registrierung, Zugangsrechte und Kostenpflichtigkeit bestimmter Funktionen 312
19.3.4Suchfunktion 313
19.3.5Download von Bildern 313
19.3.6Zertifizierte augenärztliche Online-Fortbildung in Kooperation mit der Bayerischen Landesärztekammer 314
19.3.7Hauptzugang und weitere Zugänge zur Referenzbilderdatenbank 314
19.4Ergebnisse 315
19.5Diskussion 318
19.6Schlussbetrachtung 319
Literatur 319
20 Die Digitalisierung des gesprochenen Wortes 321
Zusammenfassung 321
20.1Einleitung 322
20.2Positionsbestimmung: Umwandlung von Sprache in Text 322
20.3Ort der Erkennung und individuelle Anpassung 324
20.4Veränderung der Arbeitsabläufe 326
20.5Front-end und Back-end Spracherkennung 328
20.6Touch and Talk, Spracherkennung am Point of Care 328
20.7Urheber der Information: Arzt, Schreibkraft oder Computer? Die Verantwortlichkeit im Umgang mit Fehlern 329
20.8Die Verfügbarkeit des Erkennungsergebnisses, Cursor, KIS oder Box 330
20.9Interoperabilität und Analyse klinischer Informationen 331
20.10Kriterien für erfolgreiche Anwendung und Auswahl von Spracherkennungssoftware in der Klinik 331
20.11Kosten-Nutzen-Betrachtung 333
20.12Schlussbetrachtung 334
Literatur 335
21 Mobile Health und das Internet der Dinge – Von Consumer Gadgets zu professionellen Gesundheitsangeboten 337
Zusammenfassung 337
21.1Das Internet der Dinge: Eine sprudelnde Quelle für Gesundheitsdaten 338
21.2Consumer Devices als Wegbereiter 339
21.3Professionalisierung durch das Internet der Dinge 340
21.4Vier Voraussetzungen für die routinemäßige Nutzung von M-Health im Versorgungsalltag 341
21.4.1Datenschutz und -sicherheit gewährleisten 341
21.4.2Regulatorischen Rahmen schaffen 342
21.4.3Komplexe Anbieterlandschaft managen 343
21.4.4Skepsis bei traditionellen Leistungserbringern überwinden 343
21.5Schlussbetrachtung 344
Literatur 345
22 Ein Wohn- und Versorgungskonzept für die Zukunft 347
Zusammenfassung 347
22.1Einleitung 348
22.1.1Lösungen für ältere Menschen 348
22.1.2Leichter wohnen 349
22.1.3Dienstleistungen aus dem Quartier 349
22.2Projektbeschreibung „Wohnen im Quartier in Hamburg“ 349
22.3Planung des Projekts „Wohnen im Quartier“ 350
22.4Praktische Realisierung des Projekts „Wohnen im Quartier“ 351
22.4.1Benutzeroberfläche 352
22.4.2Technische Realisierung 353
22.5Validierungsaktivitäten 356
22.6Schlussbetrachtung 357
Literatur 357
Stichwortverzeichnis 359
| Erscheint lt. Verlag | 12.12.2016 |
|---|---|
| Zusatzinfo | XIV, 362 S. 82 Abb. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Gesundheitswesen |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre | |
| Schlagworte | Dienstleistungen • Digitale Innovationen • Digitalisierung • E-Health • Geschäftsmodelle • Gesundheitswesen • Telemedizin |
| ISBN-10 | 3-658-12393-1 / 3658123931 |
| ISBN-13 | 978-3-658-12393-2 / 9783658123932 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 9,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich