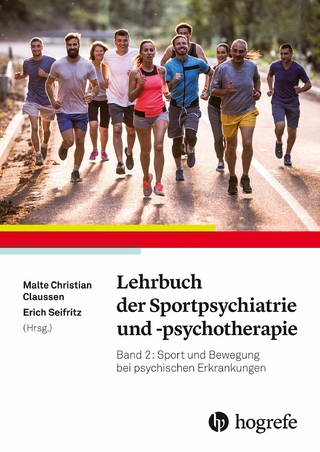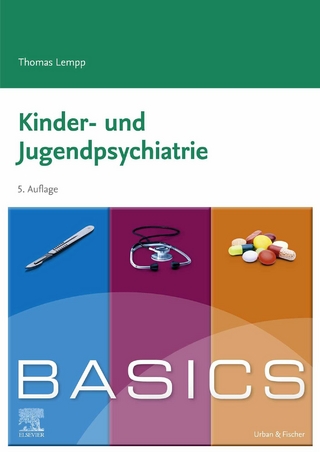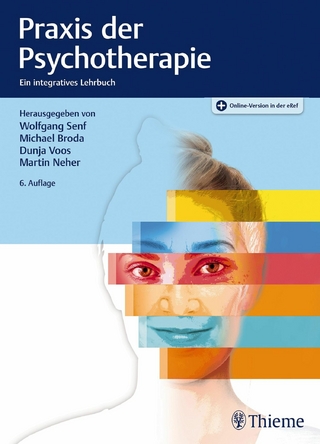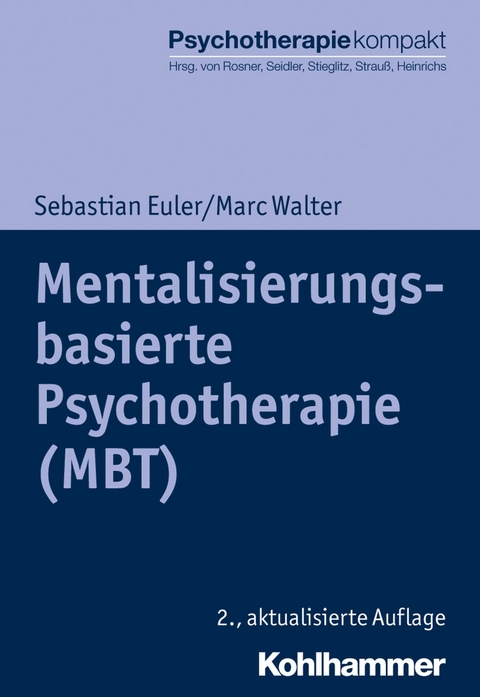
Mentalisierungsbasierte Psychotherapie (MBT) (eBook)
184 Seiten
Kohlhammer Verlag
978-3-17-038697-6 (ISBN)
Dr. med. Sebastian Euler ist Ärztlicher Leiter der Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie in der Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik am Universitätsspital Zürich. Er ist zertifizierter MBT-Supervisor und als Dozent für MBT im gesamten deutschsprachigen Raum tätig. Prof. Dr. med. Marc Walter ist Chefarzt und stv. Direktor der Klinik für Erwachsene an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Er ist Autor zahlreicher Publikationen über Persönlichkeitsstörungen und Psychotherapie.
Dr. med. Sebastian Euler ist Ärztlicher Leiter der Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie in der Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik am Universitätsspital Zürich. Er ist zertifizierter MBT-Supervisor und als Dozent für MBT im gesamten deutschsprachigen Raum tätig. Prof. Dr. med. Marc Walter ist Chefarzt und stv. Direktor der Klinik für Erwachsene an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Er ist Autor zahlreicher Publikationen über Persönlichkeitsstörungen und Psychotherapie.
1 Ursprung und Entwicklung des Verfahrens
1.1 Mentalisieren
Der Begriff Mentalisierung (»mentalization«) wurde in seiner aktuellen Verwendung 1991 zuerst von Peter Fonagy verwendet (Fonagy, 1991). Die Begriffe Mentalisierung und Mentalisieren (»mentalizing«) werden synonym gebraucht, wobei Mentalisieren den prozeduralen Charakter besser beschreibt. Fonagy bezog sich bei der Begriffsdefinition einerseits auf den Begriff der »Mentalisation« von Pierre Marty, einem französischen Psychoanalytiker, der den Begriff in den 1960er Jahren eingeführt hatte, um psychosomatische Störungen zu beschreiben. Bei Patienten mit somatoformen Störungen fiel klinisch ein besonders konkretistischer Denkstil (»la pensée opératoire«) auf, der mit einer Schwierigkeit zur Mentalisierung in Verbindung gebracht wurde (Marty, 1990, 1991). Marty beschrieb die Fähigkeit zur Mentalisierung als eine vorbewusste Ich-Funktion, die es ermögliche, basale, triebhafte affektive Erfahrungen in höher organisierte innerpsychische Erscheinungen und Strukturen zu transformieren und zu elaborieren. Damit meint »Mentalisation« also zunächst die Fähigkeit, körpernahes, affektives Erleben als etwas Mentales zu erfassen. Später gingen Theoretiker der französischen Psychosomatik davon aus, dass bei psychosomatischen Patienten auch eine veränderte Form der Kommunikation erforderlich sein könnte, bei der der Arzt1 mit dem Patienten gemeinsam denken, ihn in den Prozess einbeziehen sowie ihm zur Seite stehen muss, damit er die Freude an der Entwicklung einer Sprache für emotionale Erfahrungen entdecken kann (Aisenstein, Smadja und Noll, 2011).
Zum anderen basierte Fonagys Konzept der Mentalisierung auf der kognitiven »Theorie des Geistes«, der sog. »Theory of Mind (ToM)« (Baron-Cohen, 1997; Fonagy, 1991). Dieser Theorie zufolge sind Kinder erst in einem Alter von vier bis fünf Jahren in der Lage, ihre eigene Wahrnehmung von derjenigen anderer zu unterscheiden bzw. eine Vorstellung davon zu entwickeln, dass ihr geistiger Zustand (»mind«) sich von dem anderer unterscheidet. In diesem Alter begreifen Kinder der Theorie zufolge, dass es sich bei der eigenen Wahrnehmung um ein repräsentationales Abbild der Realität handelt.
Peter Fonagy verknüpfte nun den erwähnten psychodynamischen Ansatz von Marty aus der Psychosomatik mit der kognitionspsychologischen Theory of Mind zu dem Begriff der Mentalisierung. Zudem integrierte er die Bindungstheorie in das Konzept, und hier insbesondere die Erkenntnis, dass Bindungsmuster transgenerational weitergegeben werden und dass die reflexive Kompetenz von Eltern zusammen mit ihrem Bindungsmuster die Bindungssicherheit von Kindern vorhersagen können (Fonagy, Steele, Steele, Moran und Higgitt, 1991). Die reflexive Kompetenz bezeichnet dabei die Fähigkeit, sich auf eigene – insbesondere auch auf affektive – Selbstzustände zu beziehen und diese metapsychologisch zu erfassen. Das Selbst wird hier als Repräsentanz internalisierter früher Bindungserfahrungen verstanden. Mentalisierung bzw. mentalisieren ist damit eine Entwicklungserrungenschaft, die aufgrund einer andauernden Fehlabstimmung in den Interaktionen mit den frühen Bezugspersonen generell oder spezifisch beeinträchtigt sein kann.
Insgesamt wurden für das Konzept des Mentalisierens also vor allem Elemente aus den Kognitionswissenschaften, der Psychoanalyse und der Entwicklungspsychologie miteinander verbunden (Fonagy, Gergely und Jurist, 2004; Übersichten bei Dornes, 2004 und Brockmann und Kirsch, 2010). Neurobiologische Untersuchungen und klinische Erkenntnisse wurden später hinzugezogen, um das theoretische Modell empirisch abzustützen (Fonagy und Luyten, 2016; Herpertz, 2011; Schultz-Venrath, 2011; Schultz-Venrath et al., 2012).
Mentalisierung bzw. Mentalisieren bedeutet, sich auf die inneren, ›mentalen‹ Zustände (Gedanken, Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse, Überzeugungen etc.) von sich selbst und anderen zu beziehen, diese als dem Verhalten zugrundeliegend zu begreifen und darüber nachdenken zu können – und zwar auch in Situationen mit eigener affektiver Beteiligung (Volkert und Euler, 2018).
Zwei weitere Begrifflichkeiten sind für das Grundverständnis des Mentalisierens unverzichtbar. Menschen ist evolutionsbiologisch intentionales Denken inhärent. Wir schreiben beobachteten Handlungen bzw. Verhalten im allgemeinen automatisch intentionale, d. h. absichtsvolle Motive zu. Dabei ist die Art der Zuschreibung von der intrapersonellen Disposition (Temperament, Erfahrungen, Selbst-, Objekt- und Beziehungsrepräsentanzen, situative Befindlichkeit etc.) und vom interpersonellen Kontext abhängig und kann mehr oder weniger zutreffend sein. Wir machen diese Zuschreibung nicht nur gegenüber Erwachsenen, sondern beispielsweise auch gegenüber Säuglingen (»Gell, das schmeckt dir gut, drum nimmst du es so gerne in den Mund«) und Tieren (»Oscar, wie du herumspringst, gell, weil du mich so vermisst hast«). Dies verdeutlicht den Charakter der »Unterstellung« von Motiven.
Daran anknüpfend ist bedeutsam, dass mentale Zustände »opak« sind. Opak bedeutet, dass das Mentale von Selbst oder anderen nie wirklich und letztendlich »korrekt« erfasst werden kann. Es bleibt eine (milchglasartige) Undurchsichtigkeit bestehen, so dass wir die Wünsche, Gefühle, Gedanken etc. von anderen immer nur erahnen, aber niemals wirklich präzise und in letzter Konsequenz zutreffend erfassen bzw. wissen können. Genauso gilt das für unser eigenes mentales Erleben. Auch bei hoher Selbstreflexion und einem gesunden psychischen Binnenraum und unter Einbezug unbewusster mentaler Anteile gelingt das Erfassen unserer eigenen Wünsche, Motive und Gedanken nie in letzter Konsequenz »zutreffend«. Das Erfassen mentaler Prozesse behält immer eine gewisse Unschärfe, nicht zuletzt, weil sie sich schon während ihrer Wahrnehmung verändern bzw. durch die Fokussierung darauf beeinflusst werden können. So ist der Mensch nach der Mentalisierungstheorie tatsächlich nie ganz »Herr im eigenen Hause« (Freud, 1917). Noch viel weniger ist der Therapeut allerdings »Herr im Hause« seiner Patienten.
Menschen denken intentional. Sie schreiben anderen (und sich selbst) automatisch Handlungsmotive zu, die – da das mentale Selbst letztendlich opak ist – nie in letzter Konsequenz korrekt erfasst werden können. Dieses Grundverständnis ist von großer Bedeutung für die Praxis der MBT und begründet ihre nicht-wissende Grundhaltung mit einer kollaborativen, fragenden Technik mit dem Ziel einer intersubjektiven Näherungsbewegung hin zur (äußeren und inneren) Realität.
1.2 Mentalisierungsbasierte Therapie
»A simple set of principles … maximizing benefit while minimizing harm« (Fonagy, Luyten und Allison, 2015, S. 599).
Zusammen mit Anthony Bateman erfolgte im Lauf der 1990er Jahre der verstärkte Praxisbezug der Mentalisierungstheorie auf der Basis eines psychodynamischen Behandlungskonzepts in einer Londoner Tagesklinik, in der primär Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung behandelt wurden (Bateman und Fonagy, 1999). Auf dieser Grundlage wurde die Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) als manualisiertes Therapieverfahren entwickelt, für das rasch vielversprechende Daten zur Wirksamkeit unter Berücksichtigung gesundheitsökonomischer und psychosozialer Aspekte vorgelegt wurden (ebd.). Diese wegweisenden Studienergebnisse konnten später dann im Langzeitverlauf und für die ambulante Behandlung repliziert werden (Bateman und Fonagy, 2008, 2009). Auf dieser Grundlage hat sich die MBT vor allem in Europa und den USA rasch verbreitet und stetig weiter differenziert (Bateman und Fonagy, 2012a; Euler und Schultz-Venrath, 2014b; Schultz-Venrath, 2013a).
Wirksamkeit der MBT bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung (Bateman und Fonagy, 2008, 2009):
• Verringerung der Suizidalität
• Verringerung von selbstverletzendem Verhalten
• Verbesserung des interpersonellen und sozialen Funktionsniveaus
• Verringerung der Inanspruchnahme des Gesundheitssystems
• Verringerung der Polypharmazie
Obwohl Fonagy und seine Arbeitsgruppe wesentliche theoretische Vorarbeiten geleistet haben, zeichnet sich die MBT damit durch ihre konsequente Orientierung an der klinischen Praxis und den Leitgedanken einer steten Weiterentwicklung im Sinne eines »work in progress« aus (Schultz-Venrath et al., 2012), die in...
| Erscheint lt. Verlag | 19.2.2020 |
|---|---|
| Mitarbeit |
Herausgeber (Serie): Harald J. Freyberger, Nina Heinrichs, Rita Rosner, Günter H. Seidler, Rolf-Dieter Stieglitz, Bernhard Strauß |
| Zusatzinfo | 5 Abb., 4 Tab. |
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Psychiatrie / Psychotherapie |
| Schlagworte | Entwicklungspsychologie • Mentalisierung • Persönlichkeitsstörung • Psychotherapeutische Behandlungstechnik • Psychotherapeutische Verfahren |
| ISBN-10 | 3-17-038697-2 / 3170386972 |
| ISBN-13 | 978-3-17-038697-6 / 9783170386976 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich