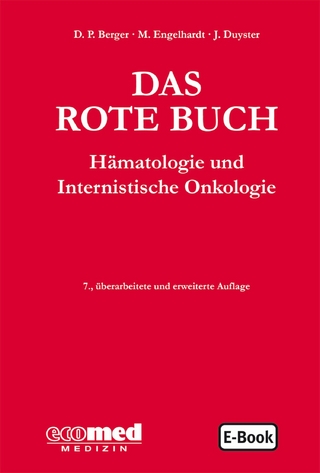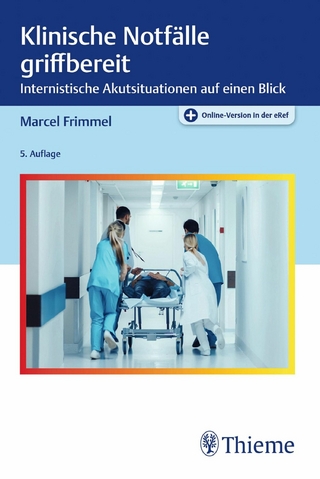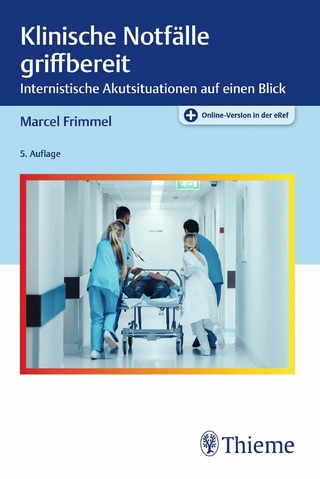Psychopathologie (eBook)
208 Seiten
Georg Thieme Verlag KG
978-3-13-245354-8 (ISBN)
1 Psychopathologisches Gespräch
1.1 Begleiteter selbstreflexiver Prozess
Die innere Welt einer Person ist ihr selbst am besten bekannt (vgl. ▶ [75], S. 483). Nur sie selbst empfindet sich auf ihre individuelle Weise, nur ihr sind die Beweggründe des eigenen Tuns zugänglich. Der Betrachtung durch andere Personen sind nur jene wenigen psychischen Aspekte zugänglich, die sich von selbst präsentieren oder an denen die Person andere teilhaben lassen möchte. Durch die Wahrnehmungs- und Auffassungsprozesse der beobachtenden Person werden die Inhalte wiederum gefiltert oder transformiert. So bleibt jede Betrachtung von außen immer bruchstückhaft und muss immer als Interpretation erkannt werden.
Manchmal – besonders in Zeiten psychischer Belastung – ist es förderlich, die eigenen psychischen Anteile und deren Auswirkungen für helfende Personen möglichst transparent darzustellen, um entweder gemeinsam bestimmte psychische Aspekte zu reflektieren oder Unterstützung zu erhalten.
Im Erkennen der eigenen Anteile oder der eigenen Reaktionen können verbesserte Möglichkeiten wahrgenommen werden, den Erfordernissen der Welt selbstbestimmt und verantwortungsbewusst zu begegnen. Vielleicht liegt der zu findende Weg aus der psychischen Belastung in eigenen Handlungsmöglichkeiten; vielleicht im Erkennen psychotherapeutische oder soziale Hilfe zu benötigen; oder vielleicht in der Erkenntnis, dass psychopharmakologische Unterstützung hilfreich sein kann.
Das psychopathologische Gespräch kann als Interaktion zwischen einer hilfesuchenden Person und einer prozessbegleitenden Person gesehen werden. Die prozessbegleitende Person stellt ihre Expertise sowohl im Ablauf des Prozesses als auch im Erkennen und Benennen psychischer Phänomene zur Verfügung.
1.2 Eine Begegnung auf Augenhöhe
Spätestens seit der Entwicklung humanistischer Zugänge zum Menschen sollte ein hierarchisch einseitig wissender Zugang zur hilfesuchenden Person obsolet sein (vgl. ▶ [13], ▶ [15], ▶ [76], ▶ [88]). In humanistischer Sichtweise begegnen sich gleichwertige Personen, ohne dass eine Person die Deutungshoheit über psychische Vorgänge der anderen besitzt.
Das psychopathologische Gespräch ist keine einseitige Tätigkeit, sondern ein gemeinsames Vortasten, wobei der Expertise des Wissens über ihre eigenen psychischen Zustände der zu untersuchenden Person mindestens ebenso viel Beachtung zukommt wie dem fachlichen Wissen der untersuchenden (prozessbegleitenden) Person. Im besten Fall gelingt es, die Untersuchungssituation in einer Stimmung gemeinsamen Interesses an den psychischen Abläufen der hilfesuchenden Person zu gestalten – als eine Suche, in der die Beteiligten sich gemeinsam bemühen etwas besser zu verstehen.
1.3 Begleitung des Prozesses
Über manche Strecken wird es ausreichen, den Prozess ohne aktiv lenkende Interventionen zu begleiten. Schon die aufmerksame und wertschätzende Anwesenheit der prozessbegleitenden Person alleine ermöglicht es meist der zu untersuchenden Person, sich darauf zu konzentrieren, ihre Probleme und ihr Leiden zu formulieren. Der Wunsch, sich einer anderen (fremden) Person in verständlicher Weise mitzuteilen, motiviert dazu, die vielleicht zuvor nicht versprachlichten Empfindungen in Worte zu fassen. Dies fördert nicht nur das Verständnis durch andere, sondern stellt gleichzeitig einen selbstreflexiven Prozess dar.
Durch die Beantwortung der Fragen der prozessbegleitenden Person, die um Verständnis ringt, werden vielleicht neue Sichtweisen auf die Problematik offenbar. Manche möglicherweise bedeutsame Aspekte, die in eigenen Gedanken schnell übergangen werden, können im Gespräch die Bedeutung finden, die sie verdienen.
1.4 Leitung des Prozesses
Die gemeinsame Suche bedarf manchmal einer Lenkung, um sicherzustellen, dass im Gespräch alle untersuchbaren Aspekte der psychischen Äußerungen Beachtung finden. Verständlicherweise besteht bei hilfesuchenden Personen oft die Tendenz, vermehrt oder ausschließlich die offensichtlich belastenden Faktoren zu thematisieren. Dabei könnten andere, weniger auffällige psychopathologische Besonderheiten übersehen werden. Aufgabe der prozessbegleitenden Person ist es, den Gesprächsverlauf so zu lenken, dass alle beobachtbaren psychischen Qualitäten wenigstens kurz im Aufmerksamkeitsfokus stehen dürfen.
Die prozessbegleitende Person wird mit der suchenden Person auch über jene psychischen Bereiche sprechen, die für die hilfesuchende Person bisher nicht im Fokus ihrer Beachtung gelegen sind – für das Verstehen des Gesamtbildes jedoch von Bedeutung sein können. Die Begleitung im Suchprozess einer Person beschreibt Carl Rogers: „Dabei bleibe ich gelegentlich einen Schritt zurück, und gelegentlich gehe ich einen Schritt voran, wenn ich den Weg deutlicher sehe, auf dem wir uns befinden.“ (1991, S. 254) ▶ [78]
1.5 Psychopathologische Expertise
Die mit der Psychopathologie vertraute, prozessbegleitende Person ist befähigt, psychische Erscheinungen zu benennen und zu differenzieren. Dadurch können Phänomene hervorgehoben werden, die vielleicht zuvor nur undeutlich erahnbar waren. Manche Phänomene sind erst durch explizite Benennung für die Beteiligten beobachtbar und besprechbar. Es entsteht vermehrte Klarheit und Übersichtlichkeit der zuvor vielleicht verwirrenden psychischen Wahrnehmungen.
Die von der prozessbegleitenden Person eingebrachte Expertise in der feinen Unterscheidung der einzelnen Phänomene ermöglicht es der hilfesuchenden Person, sich selbst besser und differenzierter zu verstehen. Die (ausgebildete) prozessbegleitende Person ist befähigt, die Diagnose zu schärfen. Eine präzise Diagnose kommt der hilfesuchenden Person zugute, da sich nur aus einer korrekten Diagnose zielführende Therapievorschläge bilden können.
1.6 Wenig förderliche helfende Person
Meist wird es nicht als förderlich wahrgenommen, wenn eine Person, an die man sich hilfesuchend wendet, vorschnell ein Urteil fällt oder einen Ratschlag gibt. Oft entsteht dann das Gefühl, nicht wirklich wahrgenommen worden zu sein – mit all der einzigartigen persönlichen Individualität und mit der individuellen Besonderheit der aktuellen Belastung.
Schnell wertende Personen werden vielleicht für weise und wissend gehalten – der Effekt der genial wirkenden Urteile verblasst aber oft ohne eine nachhaltige Auswirkung. Zu bedenken ist auch, dass schnell gefasste Beurteilungen vor allem auf den Konzepten der bewertenden Person beruhen. Solche Äußerungen sagen oft mehr über jene Person aus, die das Urteil äußert als über jene, die beurteilt wird.
1.7 Förderliche prozessbegleitende Person
Nachhaltiger hilfreich wird ein Gegenüber wahrgenommen, das die hilfesuchende Person in deren Prozess, sich selbst besser zu verstehen, unterstützt anstatt eigene oder erlernte Erklärungsmodelle anzubieten. Beobachtungen, die nicht nur von außen beurteilt werden, sondern die auch die zu untersuchende Person erkennt, können von ihr später besser nachempfunden und für die eigene psychische Gesundheit genutzt werden.
Beispiel
„Ich wache in letzter Zeit oft in der Nacht auf und komme ins Grübeln. Ich weiß, dass sich so meine depressiven Episoden anbahnen. Ich muss mich jetzt um die mir bekannte Unterstützung kümmern, damit die Krankheit nicht wieder ausbricht.“ (Hier konnte die Person im Gespräch ihre individuellen Frühsymptome erkennen und nützt das Wissen, um eine Verschlechterung der Krankheit zu vermeiden.)
1.8 Auswirkungen auf die prozessbegleitende Person
Nicht nur die als zu untersuchend definierte Person kann vom Untersuchungsprozess profitieren. Auch die prozessbegleitende Person kann am Gespräch wachsen. Weil sich der Erfahrungshorizont und die Weltsicht durch das Kennenlernen der zu untersuchenden Person erweitert haben oder weil sie durch die Wahrnehmung der anderen Person sich selbst besser verstehen lernt.
Sich im Kontakt mit einer anderen Person selbst zu entwickeln, setzt voraus, mit jener Offenheit das Gespräch zu führen, sich selbst und die eigenen Annahmen und Sichtweisen in Frage zu stellen und in Bezug zu dem neu Erfahrenen neu zu bewerten. Man könnte sich fragen: „Wie hätte ich in dieser oder jener Situation reagiert?“ oder man gleicht die erhobenen Befunde mit dem eigenen Erleben oder Empfinden ab. Für die Einschätzung mancher psychischer Funktionsbereiche ist der Abgleich mit der eigenen Einschätzung ein wesentlicher Anhaltspunkt (z.B.: Ist dieser oder jener Affekt in der jeweils geschilderten Situation adäquat?).
Doch die Einschätzung ist nicht nur simple Bewertung, sondern kann auch ein Hinterfragen eigener Sicht- und Handlungsweisen sein. Vielleicht lernt man im Gespräch neue Möglichkeiten kennen, die man in sein eigenes Denken oder Verhalten integriert. Dies alles sind keine Besonderheiten eines psychopathologischen Gesprächs, sondern treffen auf alle menschlichen...
| Erscheint lt. Verlag | 17.5.2023 |
|---|---|
| Co-Autor | David Oberreiter |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete |
| Schlagworte | Differentialdiagnose • Fallbeispiele • formale Denkstörungen • Gesprächsstrategien • ICD-11 • Psychische Kategorien • Psychische Krankheiten • Psychopathologisches Gespräch • Psychopathologische Untersuchung • Therapeutische Beziehung • Untersuchungsprozess |
| ISBN-10 | 3-13-245354-4 / 3132453544 |
| ISBN-13 | 978-3-13-245354-8 / 9783132453548 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich