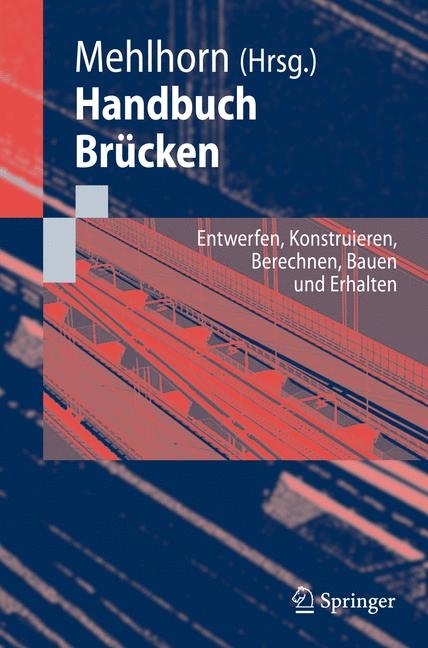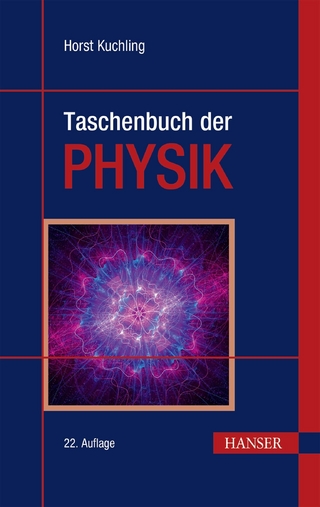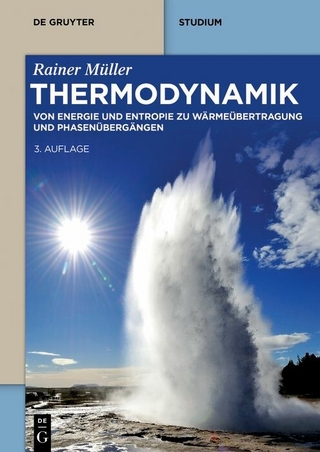Handbuch Brücken (eBook)
XVI, 1084 Seiten
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-29661-4 (ISBN)
Das umfassende Handbuch stellt das Grund- und Fachwissen für den Entwurf, die Konstruktion, die Berechnung, die Bauausführung und die Erhaltung von Brückenbauwerken vor. Hervorragende Fachautoren aus Praxis und Wissenschaft beschreiben ihre Erfahrungen zu Tragwerkstypen, Berechnungs-, Herstellungs- und Bauausführungsverfahren sowie Bauüberwachungsmethoden. Dabei ist die Verwendung der üblichen verschiedenen Baustoffe berücksichtigt. Ein Einführungskapitel zeigt die Entwicklung des Brückenbaus vom Altertum bis heute, in einem weiteren Kapitel werden die Bauingenieuraufgaben im Brückenbau erläutert. Nicht nur für Bauingenieure und Studierende des Bauingenieurwesens, sondern auch für alle, die am Brückenbau und seiner Entwicklung interessiert sind, ist dieses Buch ein unverzichtbarer Begleiter.
Professor Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Gerhard Mehlhorn, Jahrgang 1932, studierte bis 1959 Bauingenieurwesen an der TH Dresden. Nach Tätigkeit in der Ingenieurpraxis, zunächst im Entwurfsbüro für Straßenwesen in Potsdam-Babelsberg und danach bei Dyckerhoff & Widmann in Wiesbaden, promovierte er 1970 an der TH Darmstadt, wo er von 1972 bis 1983 eine Professur für Massivbau innehatte. Von 1983 bis 1997 war er Professor für Massivbau an der Universität Kassel.
Professor Mehlhorn ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen in deutschen und internationalen Fachzeitschriften zu Themen des Brückenbaus, des Spannbetons, der Stabilitätstheorie von vorgespannten und nicht vorgespannten Stahlbetontragwerken sowie zum nichtlinearen Verhalten gerissener Stahlbeton-Flächentragwerke.
Professor Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Gerhard Mehlhorn, Jahrgang 1932, studierte bis 1959 Bauingenieurwesen an der TH Dresden. Nach Tätigkeit in der Ingenieurpraxis, zunächst im Entwurfsbüro für Straßenwesen in Potsdam-Babelsberg und danach bei Dyckerhoff & Widmann in Wiesbaden, promovierte er 1970 an der TH Darmstadt, wo er von 1972 bis 1983 eine Professur für Massivbau innehatte. Von 1983 bis 1997 war er Professor für Massivbau an der Universität Kassel. Professor Mehlhorn ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen in deutschen und internationalen Fachzeitschriften zu Themen des Brückenbaus, des Spannbetons, der Stabilitätstheorie von vorgespannten und nicht vorgespannten Stahlbetontragwerken sowie zum nichtlinearen Verhalten gerissener Stahlbeton-Flächentragwerke.
Vorwort 6
Inhaltsverzeichnis 10
Autorenverzeichnis 16
1 Brückenbau auf dem Weg vom Altertum zum modernen Brückenbau 18
1.1 Einführung 18
1.2 Brücken im Altertum 19
1.2.1 Brücken in China 19
1.2.2 Brücken in Griechenland, in den persischen Großreichen und in Mesopotamien 26
1.2.3 Römische Brückenbaukunst 31
1.3 Brücken im Mittelalter 40
1.4 Brücken von der Renaissance bis zur Gegenwart 48
1.4.1 Steinbrücken 48
1.4.2 Holzbrücken 54
1.4.3 Eisen- und Stahlbrücken 58
1.4.4 Bogen-, Balken- und Rahmenbrücken aus Beton 88
1.4.5 Moderne Schrägkabelbrücken 104
1.5 Bemerkungen zur Gestaltung von Brücken und zu schicksalhaften und symbolischen Bedeutungen 109
2 Ingenieuraufgaben im Brückenbau 120
2.0 Vorbemerkung 120
2.1 Genereller Entwurf 121
2.1.1 Vorplanung 121
2.1.2 Entwurfsfindung im offenen oder eingeladenen Realisierungswettbewerb 123
2.2 Entwurfsplanung 124
2.2.1 Vorschriften 124
2.2.2 Randbedingungen 126
2.2.3 Baubetrieb und Baustellen einrichtung 128
2.2.4 Entwurfselemente, Hilfsmittel und statische Vorberechnung 128
2.2.5 Hinweise zur Bauwerksgründung 129
2.2.6 Hinweise zu den Unterbauten 129
2.2.7 Hinweise zu Lagerung und Beweglichkeit 130
2.2.8 Hinweise zu Brückenentwässerung und Abdichtung 131
2.2.9 Hinweise zu Bau- und Herstellungsverfahren 131
2.3 Genehmigungsplanung 133
2.4 Ausschreibung 133
2.4.1 Ausschreibung mit Mengenermittlung 133
2.4.2 Randbedingungen für Sonderentwürfe 135
2.4.3 Funktionale Ausschreibung 135
2.4.4 Verpflichtung zur Eindeutigkeit 135
2.5 Angebotsbearbeitung 136
2.6 Submission 137
2.7 Vergabe 137
2.8 Ausführungsplanung 138
2.9 Prüfung 138
2.10 Bauausführung, Bauüberwachung, Abrechnung 139
2.10.1 Bauausführung 139
2.10.2 Örtliche Bauüberwachung 140
2.10.3 Bauoberleitung 140
2.10.4 Bauüberwachung bei funktional ausgeschriebenen Brückenbauwerken 142
2.10.5 Abrechnung 142
2.10.6 Nachträge 143
2.11 Objektbetreuung und Dokumentation 143
2.12 Ingenieuraufgaben im Brückenbestand 144
2.12.1 Überwachen, Bewerten und Beurteilen von Brücken 144
2.12.2 Instandsetzung und Ertüchtigung von Brücken 145
2.12.3 Verstärkung von Brückenbauwerken 146
2.12.4 Austausch oder Verbreiterung von Tragwerksteilen oder von ganzen Tragwerken 147
2.12.5 Abbruch von Brückenbauwerken 148
3 Entwurf 150
3.1 Entwurfsgrundlagen 150
3.2 Bauwerkspezifische, verkehrstechnische Vorgaben 151
3.3 Ortspezifische Randbedingungen 152
3.4 Funktionelle Anforderungen 152
3.4.1 Tragsicherheit 152
3.4.2 Gebrauchstauglichkeit 153
3.4.3 Dauerhaftigkeit 156
3.5 Kulturelle Anforderungen 157
3.5.1 Kosten 157
3.5.2 Ästhetik 160
3.6 Ziel der Entwurfsarbeit 164
3.7 Überlegungen beim konzeptionellen Entwurf 165
3.8 Ausgewählte Brücken 171
3.8.1 Sunnibergbrücke, Schweiz 171
3.8.2 Fußgängerbrücke Kelheim, Deutschland 173
3.8.3 Osormort Viaduct, Spanien 175
3.8.4 Sacramento river trail pedestrian bridge, USA 177
3.8.5 Puente de la Barqueta, Spanien 179
3.8.6 Falkensteinbrücke, Österreich 181
3.8.7 Le Pont de Brotonne, Frankreich 183
3.8.8 Donaukanalbrücke in Wien, Österreich 185
3.8.9 Mangfallbrücke, Deutschland 187
3.8.10 The Normandie Bridge, Frankreich 189
3.8.11 Rheinbrücke Bendorf, Deutschland 191
3.8.12 Schrägseilbrücke Dubrovnik, Kroatien 193
4 Querschnittsgestaltung 196
4.1 Querschnittsgestaltung in Abhängigkeit von System und Funktion 196
4.1.1 Allgemeines 196
4.1.2 Allgemeine Erläuterungen zu den Hauptquerschnittstypen 199
4.1.3 Querschnitte für Straßenbrücken 201
4.1.4 Querschnitte für Bahnbrücken 202
4.1.5 Querschnitte für Fußgängerund Radwegbrücken 203
4.1.6 Sonderquerschnitte 204
4.2 Querschnittsgestaltung in Abhängigkeit vom verwendeten Werkstoff 204
4.2.1 Betonbrücken 204
4.2.2 Stahlbrücken 216
4.2.3 Verbundbrücken 226
4.2.4 Holzbrücken 236
5 Haupttragwerke der Überbauten 246
5.1 Beton-Plattenbrücken 246
5.2 Balkenbrücken 257
5.2.1 Beton-Balkenbrücken 257
5.2.2 Stählerne Balkenbrücken 290
5.2.3 Balkenbrücken als Verbundbrücken oder Mischkonstruktionen 295
5.3 Rahmenbrücken 304
5.3.1 Rahmenbrücken aus Beton 304
5.3.2 Rahmenbrücken aus Stahl 313
5.3.3 Rahmenbrücken als Verbundund Mischkonstruktionen 314
5.4 Bogen- und Stabbogenbrücken 317
5.4.1 Steinbrücken 317
5.4.2 Betonbogenbrücken 329
5.4.3 Stahlbrücken 339
5.4.4 Verbund- und Mischkonstruktionen 350
5.5 Schrägkabelbrücken 364
5.5.1 Konstruktionsgrundsätze 364
5.5.2 Konstruktionselemente 368
5.5.3 Lagerbedingungen 375
5.5.4 Aerodynamisches Verhalten 377
5.5.5 Konstruktive Gestaltung der Konstruktionselemente 378
5.5.6 Ergänzungen zu Verbundund Mischkonstruktionen 397
5.6 Hängebrücken 405
5.7 Spannbandbrücken 411
5.7.1 Einleitung 411
5.7.2 Tragwirkung 412
5.7.3 Bauverfahren 414
5.7.4 Beanspruchungen 415
5.7.5 Wirtschaftlichkeit 415
6 Lagerung 418
6.1 Überblick 418
6.2 Aufgaben und Beurteilung der Lagerung 422
6.3 Wahl der Lagerung und Anordnung der Lager 425
6.4 Ermittlung der Kräfte und Bewegungen 431
6.5 Lagerwiderstände 433
6.6 Planungsunterlagen 433
6.7 Messungen von Kräften und Bewegungen an Lagern 434
6.8 Inspektion und Instandhaltung der Lager und Lagerungen 438
7 Unterbauten 442
7.1 Überblick 442
7.2 Widerlager 442
7.2.1 Definition, Aufgaben und Konstruktionsprinzip 442
7.2.2 Anordnung von Widerlagerwand und Flügeln – Widerlagerarten 444
7.2.3 Konstruktion der Bauteile 447
7.2.4 Entwurf von Widerlagern 451
7.3 Stützen und Pfeiler 454
7.3.1 Definition, Aufgaben und Konstruktionsprinzip 454
7.3.2 Anordnung und Querschnittsgestaltung von Pfeilern 455
7.3.3 Anordnung und Querschnittsgestaltung von Stützen 457
7.3.4 Pfeiler- oder Stützenkopf 458
7.3.5 Herstellung 460
7.3.6 Pylone 460
7.4 Gründungen 461
7.4.1 Aufgaben und Überblick 461
7.4.2 Flachgründungen 461
7.4.3 Pfahlgründungen 464
7.4.4 Auswahlkriterien und Entwurf der Gründung 466
8 Berechnung 468
8.1 Einwirkungen auf Brücken 468
8.1.1 Allgemeines 468
8.1.2 Grundlagen 472
8.1.3 Einwirkungen aus dem Bauwerk 474
8.1.4 Einwirkungen aus der Bauwerks nutzung 475
8.1.5 Einwirkungen aus der Bauwerksumgebung 481
8.1.6 Bauzustände 482
8.2 Systeme, Tragverhalten, Schnittgrößen 483
8.2.1 Grundlagen 483
8.2.2 Überbauten 487
8.2.3 Unterbauten 501
8.2.4 Gesamtsysteme 506
8.3 Berechnung von Stahlbrücken 507
8.3.1 Grundlagen 507
8.3.2 Berechnung von Stahlbrücken: Ausgewählte Probleme 511
8.4 Ausgewählte Nachweise bei einer Verbundbrücke 537
8.4.1 Allgemeines 537
8.4.2 Steifigkeit der Fahrbahnplatte 538
8.4.3 Verbundtragwirkung 540
8.4.4 Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit 542
8.4.5 Ermüdungsnachweis 549
8.4.6 Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 552
8.5 Betonbrücken 553
8.5.1 Vorspannung von Betonbrücken 553
8.5.2 Schnittgrößen infolge Vorspannung 556
8.5.3 Einleitung konzentrierter Kräfte 570
8.5.4 Vorspannkraftverluste infolge des Kriechens und Schwindens des Betons und der Relaxation des Spannstahls 575
8.5.5 Schnittgrößenumlagerungen bei Systemänderungen und abschnittsweisem Bauen 582
8.5.6 Bemessungsgrundlagen 586
8.5.7 Berechnungsbeispiel, über drei Felder durchlaufende, vorgespannte Plattenbrücke 605
8.6 Berechnung von Unterbauten 637
8.6.1 Einführung 637
8.6.2 Berechnung von Widerlagern 637
8.6.3 Berechnung von Pfeilern und Stützen 655
8.6.4 Berechnung von Gründungen 664
8.7 Spezielle Probleme 676
8.7.1 Temperaturbeanspruchung 676
8.7.2 Schwingungsprobleme 699
8.7.3 Erdbebenbeanspruchung 723
9 Herstellung und Ausführungsmethoden 740
9.1 Betonbrücken 740
9.1.1 Herstellung auf Lehrgerüst 740
9.1.2 Herstellung auf Vorschubrüstung 758
9.1.3 Freivorbau 770
9.1.4 Taktschieben 784
9.1.5 Segmentbauweise 794
9.1.6 Schrägkabelbrücken 823
9.2 Stahlbrücken 845
9.2.1 Werkstattfertigung 845
9.2.2 Montage vorgefertigter Einheiten 849
9.2.3 Freivorbau 855
9.2.4 Längseinschub (Lancieren) 860
9.2.5 Spezielle Verfahren 863
9.3 Brücken in Verbund- und Mischbauweise 880
9.3.1 Fertigung und Montage Stahlüberbau 880
9.3.2 Schalung und Fertigung Betonfahrbahnplatte 883
9.3.3 Einfluss des Bauablaufs 891
9.3.4 Systemabhängige Bauabläufe 897
10 Brückenausrüstung 904
10.1 Fahrbahnausbildung und Dichtungen 904
10.1.1 Fahrbahnen von Straßenbrücken 904
10.1.2 Oberbau von Eisenbahnbrücken 907
10.2 Lager 911
10.2.1 Übersicht 911
10.2.2 Verformungslager 911
10.2.3 Stahllager 918
10.2.4 Topflager 919
10.2.5 Kalottenlager 922
10.2.6 Horizontalkraftlager 923
10.2.7 Sonderlager 923
10.2.8 Einbau und Austausch der Lager 923
10.3 Fahrbahnübergänge 924
10.3.1 Allgemeines 924
10.3.2 Fahrbahnübergänge für Straßenbrücken 925
10.3.3 Schienenauszugsvorrichtungen 934
10.4 Schrammborde, Leiteinrichtungen, Kappen und Geländer 935
10.4.1 Kappen von Straßenbrücken 935
10.4.2 Kappen auf Eisenbahnbrücken 936
10.4.3 Geländer und Leiteinrichtungen 937
10.5 Brückenentwässerungen 939
10.6 Beleuchtung 941
10.7 Versorgungsleitungen 944
10.8 Lärmschutzanlagen 944
10.8.1 Überblick 944
10.8.2 Lärmschutzanlagen auf Brücken 945
11 Überwachung, Prüfung, Bewertung und Beurteilung von Brücken 950
11.1 Einleitung 950
11.2 Ursachen für Schäden an Betonbrücken 950
11.2.1 Allgemeines 950
11.2.2 Schäden am Beton 951
11.2.3 Schäden am Bewehrungsstahl 956
11.2.4 Schäden an den Fugen und Lagern 962
11.2.5 Schäden am Oberbau 963
11.3 Überwachung und Prüfung von Brückenbauwerken 964
11.3.1 Grundlagen zur Überwachung von Brückenbauwerken 964
11.3.2 Prüfung von Betonbrücken 965
11.3.3 Prüfung von Stahlund Verbundbrücken 974
11.3.4 Prüfung der Brückenausstattung 981
11.3.5 Prüfung der Brückenausrüstung 982
11.4 Zustandsbewertung und -beurteilung von Brücken 984
11.4.1 Allgemeines 984
11.4.2 Verfahren zur Zustandsbewertung von Brücken 984
11.5 Brückenmanagement 989
11.5.1 Allgemeines 989
11.5.2 Brückenmanagementsysteme 990
12 Brückeninstandsetzung und Sanierung 992
12.1 Einleitung 992
12.2 Betonbrücken 992
12.2.1 Planung von Instandsetzungsund Sanierungsmaßnahmen 992
12.2.2 Vorbereitende Maßnahmen 994
12.2.3 Durchführung der Instandsetzungsund Sanierungsmaßnahmen 998
12.3 Stahlbrücken 1006
12.3.1 Korrosionsschutz 1006
12.3.2 Niete und Schrauben 1006
12.3.3 Instandsetzung von Abrostungen 1007
12.4 Fahrbahnbeläge 1007
13 Brückenverstärkung 1010
13.1 Einleitung 1010
13.2 Betonbrücken 1010
13.2.1 Geklebte Kohlenstofffaserverbundwerkstoffe 1010
13.2.2 Externe Vorspannung 1019
13.2.3 Querschnittsergänzung 1023
13.3 Stahl- und Verbundbrücken 1027
13.3.1 Fahrbahnverstärkung 1029
13.3.2 Systemverstärkung 1030
13.3.3 Systemänderung 1035
Literatur 1038
Brückenverzeichnis 1076
Personen- und Firmenverzeichnis 1084
Sachverzeichnis 1088
4 Querschnittsgestaltung (S. 179-180)
4.1 Querschnittsgestaltung in Abhängigkeit von System und Funktion
Francesco Aigner und Thomas Petraschek
4.1.1 Allgemeines
In diesem Abschnitt werden nur Querschnitte der Fahrbahntragwerke betrachtet. Tragkabel, Hänger, Pylon-, Bogen- und Pfeilerquerschnitte bleiben unberücksichtigt.
Allgemein lassen sich vom Baustoff losgelöst drei unterschiedliche Typen von Querschnitten angeben: Die Platte, der Plattenbalken und der Kastenquerschnitt. Durch schubfeste Kopplung längs der Verbindungskanten wirken die Einzelelemente zu Gesamtquerschnitten zusammen. Durch Plattenwirkung, oder bei durchlaufenden Plattensystemen auch durch Gewölbewirkung, werden konzentrierte Lasten verteilt. Bei aufgelösten Querschnitten wie beim Plattenbalken oder beim Kastenquerschnitt wirken diese Elemente gleichzeitig als Druck- bzw. als Zugscheiben des Gesamtquerschnitts.
Durch konsequente Ausnutzung der Vorteile der Grundformen lassen sich für Sonderfälle entsprechende Kombinationen und Sonderquerschnitte entwickeln. Querschnitte der Fahrbahntragwerke moderner Brücken erfüllen in der Regel mehrere Aufgaben: Sie bilden den Raumabschluss, enthalten die eigentliche Verkehrsfläche, die in der Regel durch eine Platte konstanter oder veränderlicher Dicke gebildet wird (Fahrbahn bei Straßenbrücken, Geh- und Radweg bei Fußgänger- und Radwegbrücken, Begrenzung des Schottertrogs oder Tragelement für eine feste Fahrbahn bei Eisenbahnbrücken) und sind Bestandteil der Haupttragkonstruktion oder diese selbst. Besonders ausgeprägt ist die mehrfache Bedeutung des „Tragwerks" bei Brücken für besondere Verwendung, z. B. Rohrbrücken.
Hier bildet das Tragwerk gleichzeitig den Verkehrsweg, den Raumabschluss und das Haupttragwerk. Somit kann der Tragwerksquerschnitt nur im Zusammenhang mit der übergeordneten Tragwerkskonstruktion gesehen werden. Es spielen bei der Wahl und Festlegung des Querschnitts die Stützweiten, die Tragwerksschlankheit h/l, die Tragwerksbreite, die Krümmungsverhältnisse im Grundriss, die Größe der Nutzlast und das Montagesystem eine entscheidende Rolle.
Da der gewählte Querschnitt nicht nur die Kosten für den Überbau, sondern auch das gesamte Erscheinungsbild einer Brücke maßgeblich beeinfl usst, sind bei der Querschnittswahl außer technischen, betrieblichen und wirtschaft lichen auch gestalterische Überlegungen anzustellen. Durch Ausnutzung von Hell-Dunkel- und Licht- Schatten-Eff ekten, durch gezielte Farbgebung bei Stahlbrücken bzw. Oberflächengestaltung bei Betonoberfl ächen sowie durch entsprechende Ausbildung der Kappen lassen sich die Tragwerke optisch auflockern und strecken.
Im Rahmen der Projektierung ist aus der Bandbreite grundsätzlich in Frage kommender Querschnitte jener auszuwählen, der die Randbedingungen (hinsichtlich Gestaltung, Kosten, Tragwirkung, Dauerhaftigkeit, eventuell Flexibilität) objektiv und subjektiv insgesamt am Besten erfüllt. Die Wahl der Querschnittsart und -geometrie ist an bestimmte Vorgaben gebunden. Durch die Nutzung ist die Querschnittsgeometrie teilweise vorgegeben, z. B. Lichtraumprofi le bei Eisenbahnbrücken oder Regelquerschnitte bei Straßenbrücken. Die Nutzlasten von Eisenbahnbrücken sind in der Regel um ein Vielfaches größer als jene von Straßenbrücken. Wegen der kleinen einzuhaltenden Verformungen (Durchbiegungen, Endtangentenverdrehungen) ergeben sich vor allem bei Bahnbrücken steife Tragwerke. Hingegen sind die Steifi gkeitsanforderungen der Straßenbrücken und – vor allem – der Fußgängerbrücken geringer. Bei letzteren ist wegen der Möglichkeit, weiche Tragwerke mit geringer Masse auszubilden, das Schwingungsverhalten zu berücksichtigen. Versteifungsträger weit gespannter Schrägkabel- oder Hängebrücken erfordern – schon mit Rücksicht auf die Bauzustände – aerodynamisch stabile Querschnitte.
Auch besondere Anforderungen bezüglich des Temperaturverlaufs in der Fahrbahnplatte können Einfl uss auf den Baustoff und die Querschnittsausbildung haben. Soll sich z. B. aus Gründen der Verkehrssicherheit die Tragwerksplatte einer Straßenbrücke bei Sonneneinstrahlung möglichst gleichmäßig erwärmen, wird man eine Betonplatte gegenüber einer Stahlplatte bevorzugen und weit ausladende Konsolen vermeiden. Auch die Unterbringung von Versorgungsleitungen oder der Brückenentwässerung kann für die Querschnittsgestaltung von Bedeutung sein (siehe Kapitel 10.5).
| Erscheint lt. Verlag | 7.3.2007 |
|---|---|
| Vorwort | NN NN |
| Zusatzinfo | XVI, 1084 S. 977 Abb., 96 Abb. in Farbe. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Naturwissenschaften ► Physik / Astronomie |
| Technik ► Architektur | |
| Technik ► Bauwesen | |
| Schlagworte | Ausführungsmethoden • Bewertung • Brücke • Brückenausrüstung • Brückenbau • Brückeninstandsetzung • Brückensymposium • Brückenverstärkung • Entwurf • Haupttragwerke • Herstellung • Ingenieuraufgaben • Lagerung • Moderner Brückenbau • Querschnittsgestaltung • Überbauten • Überwachung • Unterbauten |
| ISBN-10 | 3-540-29661-1 / 3540296611 |
| ISBN-13 | 978-3-540-29661-4 / 9783540296614 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 32,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich