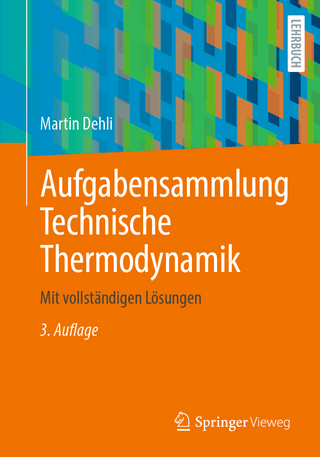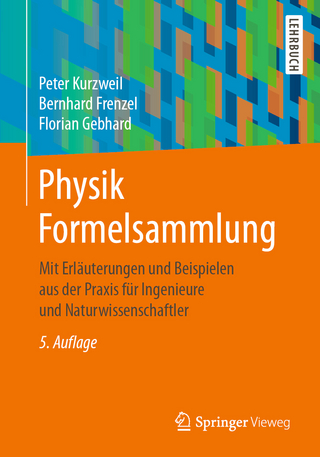Pulstechnik
Springer Berlin (Verlag)
978-3-642-88010-0 (ISBN)
1. Einleitung.- 2. Impulsformung und -erzeugung.- 2.1. Impulsformung.- 2.1.1. Frequenzfilter.- 2.1.1.1. Differenzierende Netzwerke.- 2.1.1.2. Integrierende Netzwerke.- 2.1.1.3. Lineare impulsformende Netzwerke.- 2.1.2. Amplitudenfilter.- 2.1.2.1. Amplituden-Hochpässe, -Tiefpässe, -Bandpässe und -Bandsperren.- 2.1.2.2. Impulsformung mit nichtlinearen Elementen.- 2.1.2.3. Potentialverschiebung und -fixierung.- 2.1.2.4. Schwellwert-Entscheider.- 2.1.2.5. Komparatoren.- 2.1.3. Zeitfilter.- 2.1.4. Abtastfilter.- 2.2. Impulserzeugung.- 2.2.1. Erzeugung von Rechteckschwingungen.- 2.2.1.1. Bistabile Kippschaltungen.- 2.2.1.2. Monostabile Kippschaltungen.- 2.2.1.3. Astabile Kippschaltungen.- 2.2.2. Erzeugung von sägezahnförmjgen Schwingungen.- 2.2.2.1. Fremdgesteuerte Sägezahngeneratoren.- 2.2.2.2. Selbstschwingende Sägezahngeneratoren.- 2.2.3. Erzeugung von treppenförmigen Schwingungen.- 3. Digitale Grundschaltungen.- 3.1. Grundlagen der Schaltungsalgebra.- 3.1.1. Elemente der Schaltungsalgebra, elementare Verknüpfungen.- 3.1.2. Kombinierte Verknüpfungen, Rechenregeln.- 3.1.3. Vereinfachte Darstellung der Schaltzeichen.- 3.1.4. Ersetzbarkeit von Verknüpfungen.- 3.1.5. Verknüpfungen mehrerer Ausgangsvariabler mit mehreren Eingangsvariablen.- 3.1.6. Verknüpfungen mit speichernder Wirkung.- 3.1.6.1. Die D-Kippstufe.- 3.1.6.2. Die T-Kippstufe.- 3.1.6.3. Die RS-Kippstufe.- 3.1.6.4. Die JK-Kippstufe.- 3.1.6.5. Schaltzeichen.- 3.2. Anwendungsbeispiele.- 3.2.1. Verknüpfungen von Zustandsfolgen mit sich selbst.- 3.2.2. Das Rechnen mit logischen Verknüpfungen.- 3.2.2.1. Die Addition.- 3.2.2.2. Die Subtraktion.- 3.2.2.3. Die Multiplikation und Division.- 3.2.3. Kombination logischer und algebraischer Verknüpfungen.- 3.2.4. Höherwertige Algebra.- 3.2.5. Das Schieberegister und seine Anwendungen.- 3.2.6. Codeumsetzung.- 3.2.7. Dualzähler und Frequenzteiler.- 3.2.8. Anordnung zum Synchronisieren einer Empfangseinrichtung von digitalen Zeitmultiplexsignalen.- 3.3. Schlußbemerkungen zur Theorie der Schaltungsalgebra.- 4. Schalteinrichtungen.- 4.1. Prinzipien.- 4.1.1. Grundbegriffe und Abgrenzung.- 4.1.2. Nutzdaten und Steuerdaten.- 4.1.3. Die Verknüpfung von Daten.- 4.1.4. Die Bedeutung des zeitlichen Ablaufs in Schalteinrichtungen.- 4.1.5. Die Grundfunktionen von technischen Schalteinrichtungen.- 4.2. Verfahren der Ablaufsteuerung.- 4.2.1. Aufgabenstellung.- 4.2.2. Das Herstellen von zeitlichen Folgen.- 4.2.3. Das Herstellen logischer Zusammenhänge mit verdrahtetem Programm.- 4.2.4. Das Herstellen logischer Zusammenhänge mit gespeichertem Programm.- 4.2.5. Programmstrukturen.- 4.3. Einsatzfälle und Anforderungen.- 4.3.1. Die Leistungsfähigkeit von Schalteinrichtungen.- 4.3.2. System-Verfügbarkeit.- 4.4. Trends.- 5. Bausteine.- 5.1. Bauelemente.- 5.1.1. Halbleiterbauelemente.- 5.1.1.1. Bipolare Elemente.- 5.1.1.2. Feldeffektelemente.- 5.1.1.3. Passive Halbleiterelemente.- 5.1.2. Magnetbauelemente.- 5.1.3. Optische Bauelemente.- 5.1.3.1. Lichtsender.- 5.1.3.2. Lichtempfänger.- 5.1.3.3. Passive optische Bauelemente.- 5.2. Logik-Bausteine.- 5.2.1. Bipolare integrierte Schaltungen.- 5.2.1.1. Transistor-Transistor-Logik, TTL.- 5.2.1.2. Emitter Coupled Logic, ECL.- 5.2.1.3. Integrierte Injektions-Logik, PL.- 5.2.2. Unipolare integrierte Schaltungen.- 5.2.2.1. Einkanal-Technologie.- 5.2.2.2. Komplementärtechnologie.- 5.2.3. Kundenspezifische Schaltungen.- 5.2.3.1. Individuelle Bausteinentwicklung.- 5.2.3.2. Gate-Arrays.- 5.2.3.3. Zellen-Design.- 5.3. Speicherbausteine.- 5.3.1. Magnetische Speicherelemente.- 5.3.1.1. Ferritkern-Matrizen.- 5.3.1.2. Magnetische Domänen.- 5.3.2. Halbleiter-Speicherelemente.- 5.3.2.1. Bipolare Speicherelemente.- 5.3.2.2. MOS-Speicherelemente.- 5.3.3. Passive Festspeicherelemente.- 6. Speichersysteme und Mikroprozessorsysteme.- 6.1. Speichersysteme; Überblick.- 6.2. Lese-Schreib-Speichersysteme mit wahlfreiem Zugriff.- 6.2.1. Kernspeichersysteme.- 6.2.2. Halbleiterspeichersysteme.- 6.2.2.1. Bipolare Halbleiterspeichersysteme.- 6.2.2.2. MOS-Halbleiterspeichersysteme.- 6.3. Festspeichersysteme mit wahlfreiem Zugriff.- 6.4. Lese-Schreib-Speichersysteme mit seriellem Zugriff.- 6.5. Zuverlässigkeit von Speichersystemen.- 6.5.1. Überwachung von Speichersystemen.- 6.5.2. Fehlerkorrektur in Speichersystemen.- 6.6. Mikroprozessoren und Mikrocomputer.- 6.6.1. Mikroprozessoren.- 6.6.1.1. Rechenwerk.- 6.6.1.2. Ablaufsteuerung.- 6.6.1.3. Internes Bussystem.- 6.6.1.4. Ein-/Ausgabe.- 6.6.2. Mikroprozessor-Klassifizierung.- 6.6.2.1. 4-bit-Mikroprozessoren.- 6.6.2.2. 8-bit-Mikroprozessoren.- 6.6.2.3. 16-bit-Mikroprozessoren.- 6.6.2.4. 32-bit-Mikroprozessoren.- 6.6.3. Ein-/Ausgabe-Bausteine.- 6.6.4. Mikrocomputer.- 6.6.4.1. 4-bit-Mikrocomputer.- 6.6.4.2. 8-bit-Mikrocomputer.- 6.6.4.3. 16-bit-Mikrocomputer.- 6.6.5. Einsatz in der Vermittlungstechnik.- 7. Nachrichten-Vermittlungstechnik.- 7.1. Die Grundaufgaben der Vermittlungstechnik.- 7.1.1. Koppeln.- 7.1.2. Signalisierung.- 7.1.2.1. Signalisierung zwischen Teilnehmer und Vermittlungsstelle.- 7.1.2.2. Signalisierung zwischen Vermittlungsstellen.- 7.1.3. Administrative Funktionen.- 7.2. Grundbegriffe der Verkehrstheorie.- 7.2.1. Verkehrsgrößen.- 7.2.2. Verluste und Wartemöglichkeiten.- 7.2.3. Aufteilung der Verkehrsverluste, Eigenschaften der Koppelanordnung.- 7.2.4. Ergebnisse.- 7.3. Steuerungsprinzipien.- 7.3.1. Direkt und indirekt gesteuerte Vermittlungssysteme.- 7.3.2. Speicherprogrammierte Vermittlungssysteme.- 7.3.3. Zentralisierungsgrad der Steuerung.- 7.4. Netzstrukturen.- 7.4.1. Grundsätzliche Strukturformen von Nachrichtennetzen.- 7.4.2. Struktur großer Fernsprech-Ortsnetze.- 7.4.3. Struktur des deutschen Landesfernwahlnetzes.- 7.5. Schlußbemerkung.- 8. Nachrichten-Übertragungstechnik.- 8.1. Der Weg zur Digital-Übertragung.- 8.2. Prinzipieller Aufbau eines Digital-Übertragungssystems.- 8.2.1. Grundsätzliches über Endeinrichtungen zur Modulation und Bündelung.- 8.2.1.1. Prinzipielle Anordnung.- 8.2.1.2. Aufgabe und Wirkungsweise der Taktzentrale, Synchronisierung.- 8.2.2. Grundsätzliches über Streckeneinrichtungen.- 8.3. Endeinrichtungen für digitale Signale.- 8.3.1. Signalarten.- 8.3.1.1. Sprachsignale.- 8.3.1.2. Datensignale.- 8.3.1.3. Tonsignale.- 8.3.1.4. Bildsignale.- 8.3.1.5. Trägerfrequenzsignale.- 8.3.2. Synchronisier- und Bündelungsverfahren.- 8.3.3. Modulations- und Multiplexgeräte.- 8.3.3.1. Das Grundsystem PCM 30.- 8.3.3.2. Ein Digitalsignal-Multiplexgerät zur Bündelung von vier 2048-kbit/s-Signalen.- 8.3.3.3. Digitalsignal-Multiplexgeräte zur Bündelung von vier 8448-kbit/s- und vier 34368-kbit/s-Signalen.- 8.4. Übertragungsmedien für Digitalsignale.- 8.4.1. Grundsätzliches.- 8.4.2. Symmetrische Leitungen.- 8.4.2.1. Übertragungstechnische Eigenschaften symmetrischer Leitungen für Digitalsignale.- 8.4.2.2. Streckeneinrichtungen für 2048 kbit/s.- 8.4.3. Koaxialkabellinien.- 8.4.4. Funkverbindungen.- 8.4.4.1. Mobilfunk.- 8.4.4.2 Terrestrische Richtfunkverbindungen.- 8.4.4.3. Satelliten-Funkverbindungen.- 8.4.5. Lichtwellenleiter-Übertragungstechnik.- 8.5. Hierarchie der Digital-Übertragungssysteme.- 9. Digitalvermittlungen und integrierte Nachrichtennetze.- 9.1. Überblick.- 9.2. Digitale Koppeleinrichtungen.- 9.2.1. Die räumliche Durchschaltung digitaler Signale.- 9.2.2. Die zeitliche Verschiebung digitaler Signale.- 9.2.3. Koppelanordnungen.- 9.2.3.1. Vermittlung mit einer Zeitstufe (ohne Raumstufen).- 9.2.3.2. Vermittlung mit mehreren Zeitstufen (ohne Raumstufen).- 9.2.3.3. Vermittlung mit Zeit- und Raumstufen.- 9.2.3.4. Vierdraht-Durchschaltung.- 9.3. Signalisierung.- 9.3.1. Kanalgebundene Signalisierung zwischen Vermittlungsstellen.- 9.3.2. Signalisierung auf zentralem Zeichenkanal zwischen Vermittlungsstellen.- 9.3.2.1. Der Nachrichtenübertragungsteil der Signalisierungsnachricht.- 9.3.2.2. Der Telephon-Benutzerteil der Signalisierungsnachricht.- 9.3.3. Signalisierung zwischen Teilnehmer und Vermittlungsstelle im voll digitalen Netz (ISDN).- 9.4. Synchronisierung.- 9.4.1. Taktsynchronisierung.- 9.4.1.1. Das "plesiochrone" Netz.- 9.4.1.2. Gerichtete Synchronisierung.- 9.4.1.3. Gegenseitige Synchronisierung.- 9.4.2. Rahmen- und Kanalerkennung.- 9.5. Digitale Nachrichtennetze.- 9.5.1. Dienstintegration in digitalen Universalnetzen.- 9.5.2. Integrated Services Digital Network (ISDN) für 64-kbit/s-Ströme.- 9.5.2.1. Veranlassung.- 9.5.2.2. Allgemeine Eigenschaften des ISDN.- 9.5.2.3. Der Teilnehmeranschluß.- 9.5.2.4. Höhere Bitraten im ISDN.- 9.5.3. Die Einführung neuer Netze.- 10. Ortungstechnik.- 10.1. Bedeutung und Abgrenzung der Pulstechnik in der Funkortung.- 10.2. Die Entfernungsmessung mit Impulsen.- 10.2.1. Entfernungsauflösung und Entfernungs-Meßgenauigkeit.- 10.2.2. Entdeckungswahrscheinlichkeit und Falschalarmrate.- 10.2.2.1. Störungseinflüsse.- 10.2.2.2. Die Radargleichung.- 10.2.2.3. Die Entdeckung als statistische Aussage.- 10.2.3. Pulskompression.- 10.2.4. Festzeichenunterdrückung.- 10.2.4.1. Das Grundproblem beim Puls-Doppler-Radar.- 10.2.4.2. Dopplerfilterung bei konstanter Pulsfrequenz.- 10.2.4.3. Digitale Dopplerfilterung mit variabler Pulsfrequenz.- 10.2.5. Die Bedeutung der Ambiguity-Funktion.- 10.3. Prinzip-Blockschaltbilder am Beispiel zweier Anlagen.- 10.3.1. Rundsicht-Radaranlage ohne Festzeichenunterdrückung.- 10.3.2. Rundsicht-Radaranlage mit Festzeichenunterdrückung.- 10.4. Sekundärradartechnik.- 10.4.1. Die Impulsübertragung.- 10.4.2. Codierung und Decodierung.- 10.4.3. Systemeigene Störungen.- 10.4.4. Prinzip-Blockschaltbilder einer Abfrage- und einer Ant wortstation.- 10.4.5. Vorausschau auf zukünftige Entwicklungen.
| Erscheint lt. Verlag | 12.6.2012 |
|---|---|
| Überarbeitung | K. Euler, P. Gerke, R. Kersten, H. Leysieffer, H. Stegmeier |
| Zusatzinfo | XVIII, 496 S. 46 Abb. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 155 x 235 mm |
| Gewicht | 773 g |
| Themenwelt | Naturwissenschaften ► Physik / Astronomie ► Angewandte Physik |
| Technik ► Elektrotechnik / Energietechnik | |
| Technik ► Nachrichtentechnik | |
| Schlagworte | Impulstechnik • Lichtwellenleitertechnik • Mikroprozessor • Prozessor • Symbol • Wellenleiter |
| ISBN-10 | 3-642-88010-X / 364288010X |
| ISBN-13 | 978-3-642-88010-0 / 9783642880100 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich