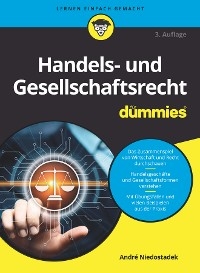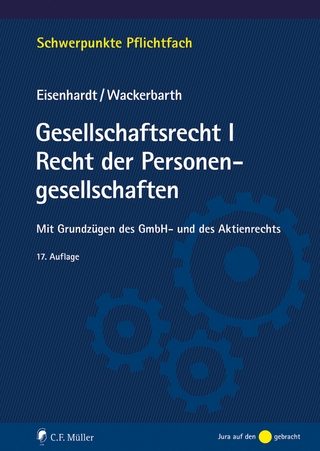Die faktisch abhängige GmbH im konzernweiten Cash Pooling (eBook)
438 Seiten
Nomos Verlag
978-3-8452-8855-0 (ISBN)
Cover 1
§ 1 Einführung 21
A. Gegenstand der Untersuchung 21
B. Gang der Darstellung 27
§ 2 Grundlagen des cash pooling 30
A. Cash pooling als Element des cash management 30
B. Funktionsweise des cash pooling 31
I. Physisches pooling 31
II. Virtuelles pooling 35
C. Rechtsbeziehungen der Beteiligten untereinander 36
I. Rahmenvertrag zwischen den beteiligten Gesellschaften 36
1. Regelung der konzerninternen Finanzströme 37
a) Liquiditätsausgleich 37
b) Rechtsnatur der konzerninternen Finanzströme 37
c) »Sternförmige Organisation« als Regelfall 40
d) Kontokorrentabrede 40
2. Kündigungsrechte 46
3. Informationsrechte und -pflichten 47
4. Weitere typische Regelungen 50
5. Form 50
6. Der cash pool als Gesellschaft bürgerlichen Rechts 51
II. Durchführungsvereinbarung mit der poolführenden Bank 52
D. Chancen und Risiken des pooling 53
I. Chancen und Vorteile 53
1. Zins- und Liquiditätsvorteile 53
2. Geringere Liquiditätsreserve 54
3. Volumeneffekte, Zugang zu Finanzinstrumenten 54
4. Rating 55
5. Indirekte Vorteile 56
II. Risiken und Nachteile 57
1. Bonitäts- bzw. Ausfallrisiko 57
2. Klumpenrisiko 58
3. Dominoeffekt 58
4. Erfordernis unbequemer Entscheidungen 59
5. Abfluss benötigter Liquidität 60
6. Besicherung 60
7. Unvorteilhafte Konditionen 61
8. Sonstige Risiken 61
E. Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen 63
I. Ökonomische Würdigung der Vor- und Nachteile 63
II. Rechtliche Zweifel an der Zulässigkeit 65
III. Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen 65
§ 3 Aufsteigende Darlehen und Kapitalerhaltung 67
A. Einleitung 67
B. Überblick über Tatbestand und Rechtsfolgen des § 30 GmbHG 71
I. Tatbestand 71
1. Unterbilanz 72
2. Auszahlung 74
a) Grundsatz: Bilanzielle Betrachtung 74
b) Schutz des »realen Vermögens« in der Unterbilanz 74
c) Rückausnahme – Drittvergleich 75
3. Maßgeblicher Zeitpunkt 76
4. Auszahlungsempfänger 77
II. Rechtsfolgen bei Verstoß 77
C. Entwicklung des Meinungsstands zu aufsteigenden Darlehen 79
I. Die Rechtslage bis zum Erlass des November-Urteils 79
II. Die Rechtslage unter dem November-Urteil des BGH 81
III. Auswirkungen der Entscheidung 82
IV. Die Reaktion des Gesetzgebers 84
V. Würdigung der Rückkehr zur bilanziellen Betrachtung 85
D. Die Vereinbarkeit aufsteigender Darlehen mit § 30 GmbHG 91
I. (Unveränderter) Anwendungsbereich 91
II. Vollwertigkeit des Rückgewähranspruchs 93
1. Bilanzielle Vollwertigkeit vs. weitergehende Anforderungen 93
a) Ausgangspunkt: Handelsrechtliche Bilanzierung 93
aa) Allgemeine Grundsätze 93
bb) Einzelwertberichtigungen 94
cc) Pauschalwertberichtigungen 96
dd) Abwertung bei Wertberichtigungsbedarf 97
b) Konkretisierung durch Gesetzgeber, BGH und h.L. 97
c) Die Gegenansicht: Berücksichtigung sämtlicher Risiken 99
d) Stellungnahme 100
2. Die Vollwertigkeitsprüfung beim cash pooling 101
a) Maßgeblichkeit jeder einzelnen Zahlung 102
b) Maßgeblichkeit der Bonität des Gesamtkonzerns 103
c) Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt 105
3. Einzelfragen 109
a) Besicherung und Versicherung 109
b) Einfluss von Ratings 110
c) Berücksichtigung allgemeiner Vorteile des pooling 114
d) Berücksichtigung von Klumpenrisiken 117
aa) Analogie zu Spezialvorschriften 118
bb) Pauschalwertberichtigung 119
cc) Zwischenergebnis – »Privilegierung« des Klumpenrisikos 121
e) Abschlag bei Holding-Konzernen? 122
f) Jederzeitiges Kündigungsrecht erforderlich? 124
g) Die Behandlung der teilweisen Vollwertigkeit 127
aa) Problem und Meinungsstand 127
bb) Stellungnahme 128
cc) Ergebnis zur »teilweisen Vollwertigkeit« 131
4. Beweislast für die Vollwertigkeit 132
III. Notwendigkeit einer angemessenen Verzinsung 133
1. Grundsätzliche Notwendigkeit einer Verzinsung 134
a) Meinungsstand 134
b) Stellungnahme 137
aa) »Regelungslücke« bzgl. der Verzinsung 138
bb) »Übergeordnete« Erwägungen 140
cc) Verortung der Verzinsungspflicht 143
c) Zwischenergebnis 145
2. Höhe der Verzinsung 145
a) Grundsatz: Marktübliche Soll-Zinsen 145
b) Höhere Verzinsung aufgrund cash-poolingspezifischer Risiken 147
c) Kompensation durch anderweitige Vorteile 148
3. Rechtsfolgen zu niedriger Verzinsung 150
4. Ergebnis zur Verzinsung 151
IV. Nachträgliche Bonitätsverschlechterungen 152
1. Abgrenzung: »Stehenlassen« vs. »Neuvergabe« 153
2. »Echtes Stehenlassen« 154
a) Meinungsstand 154
b) Stellungnahme zum Frühwarnsystem als Teil der Vollwertigkeit 156
c) Stellungnahme zum Stehenlassen als Auszahlung 159
aa) Entgegenstehender Wille des Gesetzgebers und Systematik 159
bb) Konsequenzen bei Anwendbarkeit des § 30 Abs. 1 GmbHG 163
cc) Konsequenzen bei Unanwendbarkeit 164
d) Ergebnis: Stehenlassen ist keine Auszahlung 167
V. Wesentliche Ergebnisse zu § 30 GmbHG 167
§ 4 Haftungsfragen 170
A. Einleitung 170
B. Haftung des Gesellschafters nach § 31 GmbHG 171
I. Tatbestand 171
II. Inhalt und Höhe des Anspruchs 172
III. Anspruchsverpflichtete 174
IV. Ergebnis und Praktischer Nutzen 175
C. Haftung der Geschäftsführung aus § 43 GmbHG 176
I. Allgemeine Grundsätze 176
II. Bedeutung für aufsteigende Darlehen 178
III. Haftung für die Vergabe aufsteigender Darlehen 178
1. Sorgfaltspflichtverletzung 179
a) Außerhalb des § 30 Abs. 1 GmbHG 179
aa) Sorgfaltspflicht bei der Darlehensvergabe 179
bb) Anforderungen an die Bonitätsprüfung 180
cc) Keine tägliche Prüfung erforderlich 187
dd) Zwischenergebnis 188
b) Pflichtverletzung im Bereich des § 30 GmbHG 189
aa) Ermessens- bzw. Beurteilungsspielraum 190
bb) Exkurs: Kein Beurteilungsspielraum gegenüber den Gesellschaftern 193
cc) Konsequenzen für die Einhaltung der Sorgfaltspflichten 195
2. Verschulden 197
3. Kausalität und Schaden 199
4. Ergebnis zur Haftung bei anfänglich fehlender Vollwertigkeit 200
IV. Haftung bei nachträglichen Bonitätsverschlechterungen 201
1. Pflicht zur Überwachung und ggf. Rückforderung 202
2. Anforderungen an ein Frühwarnsystem 203
a) Informationsrechte 204
b) Prüfungspflichten 208
c) Reaktionsmöglichkeiten 209
d) Dokumentation und Umsetzung 213
e) Zulässigkeit der Auslagerung der Bonitätskontrolle? 214
aa) Grundsätzliche Befugnis zur Delegation 215
bb) Zulässigkeit der Delegation im Konzern 216
cc) Delegation der Bonitätskontrolle 219
dd) Zwischenergebnis 220
3. Das Problem der Weisungsgebundenheit 220
4. Verschulden 225
5. Kausalität und Schaden 225
V. Wesentliche Ergebnisse zur Haftung aus § 43 GmbHG 226
D. Haftung wegen existenzvernichtenden Eingriffs 229
I. Einleitung 229
II. Voraussetzungen und Rechtsfolgen 236
1. Eingriff in das Gesellschaftsvermögen 236
a) Betriebsfremder Entzug von Vermögen 236
b) Keine Kompensation oder Rechtfertigung 238
c) Durch den Gesellschafter 239
2. Insolvenzverursachung oder -vertiefung 240
3. Sittenwidrigkeit des Gesellschafterverhaltens 240
4. Vorsatz 241
5. Keine Subsidiarität gegenüber §§ 30, 31 GmbHG 241
6. Darlegungs- und Beweislast 242
7. Rechtsfolge: Schadensersatz 242
III. Grundsätzliche Anwendbarkeit auf aufsteigende Darlehen 243
IV. Anwendungsfälle – Haftung des Gesellschafters 247
1. Beitritt in der Krise 247
2. Verweigerung der Rückzahlung 248
3. Ausschluss einer Konzerngesellschaft 249
4. Bonitätsverschlechterung bei der Konzernmutter 249
a) Haftung bei Fehlen eines Frühwarnsystems 250
aa) Beitritt zum pooling als Anknüpfungspunkt 250
bb) Abzug der zuletzt eingebrachten Mittel als Anknüpfungspunkt 252
cc) Haftung wegen unterlassener Warnung 253
(1.) Existenzvernichtung durch Unterlassen? 253
(2.) Tatbestand des existenzvernichtenden Eingriffs 254
b) Haftung bei Bestehen eines Frühwarnsystems 258
c) Dogmatische Stimmigkeit des Konzepts 259
aa) Konsequente Fortführung der Bremer- Vulkan-Grundsätze 259
bb) Keine Erfolgshaftung 260
cc) Kein Widerspruch zur Kapitalerhaltung, Vergleich mit der AG 260
d) Zwischenergebnis 262
V. Mithaftung der Geschäftsleiter der Obergesellschaft 262
1. Kein Ausschluss wegen Sonderdeliktscharakter 263
2. Außenhaftung als Ausnahme 264
3. Deliktisches Verhalten in pooling-Konstellationen 266
4. Kein Ausschluss aus grundsätzlichen Erwägungen 268
5. Fehlende Schutzwürdigkeit 273
6. Gleichlauf mit der strafrechtlichen Sichtweise 274
7. Ergebnis zur Haftung der Geschäftsleiter der Mutter 275
VI. Teilnehmerhaftung der Geschäftsführung der Tochter 276
VII. Besonderheiten bei der Abwicklung über eine Betreibergesellschaft 278
VIII. Wesentliche Ergebnisse zur Existenzvernichtungshaftung 279
E. Haftung aus § 64 Satz 3 GmbHG 281
I. Einleitung 281
II. Anwendungsbereich und Tatbestand 283
1. Geschäftsführer als alleiniger Haftungsadressat 284
2. Zahlung 284
3. Gesellschafter als Zahlungsempfänger 286
4. Auslösung der Zahlungsunfähigkeit 286
a) Zahlungsunfähigkeit 286
b) Auslösung der Zahlungsunfähigkeit 288
5. Kausalzusammenhang 291
6. Verschulden 291
7. Rechtsfolgen 292
8. Beweislast 293
9. Konkurrenzen 293
III. Anwendungsfälle im cash pool 294
1. Anwendungsbereich bei Darlehensvergaben 294
2. Berücksichtigung von Ansprüchen gegen den pool 295
3. Konsequenzen für § 64 Satz 3 GmbHG 297
a) Kein Risiko bei gesicherter Zahlungsfähigkeit auf stand alone Basis 297
b) Kein Risiko bei werthaltigen Ansprüchen gegen den pool 297
c) Überwachung der Zahlungsfähigkeit des pools 300
d) Maßnahmen bei Verschlechterung der Situation des pools 302
4. Verschulden 304
5. Inhalt der Erstattungspflicht (§ 64 Satz 1 und 3) 305
a) Kompensation durch ausgleichende Zuflüsse 306
b) Würdigung und Bedeutung für cash pooling 308
c) Kompensation durch Zuflüsse im cash pooling 310
aa) Maßgebliche »Gegenleistung« 311
bb) Zufluss trotz Zahlung auf ein debitorisches Konto 313
cc) Unmittelbarer Zusammenhang 316
dd) Anforderungen an den zeitlichen Zusammenhang 319
d) Ergebnis 320
IV. Wesentliche Ergebnisse zu § 64 Satz 3 GmbHG 321
§ 5 Insolvenzrechtliche Aspekte 323
A. Einleitung und Fragestellung 323
B. Insolvenzfestigkeit der Rückzahlung des cash-pool-Guthabens 325
I. Vorüberlegungen 325
1. Keine Bereichsausnahme für das cash pooling 325
2. Kein Zahlungsverbot für die Konzernmutter 326
3. Anfechtung allenfalls im Zwei-Personen-Verhältnis 327
II. Insolvenzfestigkeit des Kündigungsrechts 329
1. Wirksamkeit des Kündigungsrechts 329
2. Unanfechtbarkeit des Kündigungsrechts 331
3. Ergebnis 333
III. Anfechtbarkeit der Kündigung oder der Rückzahlung 333
1. Allgemeine Anfechtungsvoraussetzungen 333
2. Anfechtbarkeit nach § 130 InsO oder § 131 InsO 337
a) Kongruenz trotz vorheriger Kündigung 337
b) Anfechtbarkeit der Rückzahlung nach § 130 InsO 339
c) Ergebnis zu § 130 und § 131 InsO 342
3. Anfechtbarkeit nach § 134 InsO 342
4. Anfechtbarkeit wegen vorsätzlicher Benachteiligung 345
a) Bisherige Grundsätze 345
b) »Modifizierung« durch die jüngste InsO-Reform 348
c) Anwendung auf die Rückforderung des cash-pool-Guthabens 349
d) (Keine) Vermutung nach § 133 Abs. 4 InsO 355
IV. Schicksal der Verrechnungen bei Fortführung trotz Insolvenzreife 356
V. Ergebnis 357
C. Insolvenzfestigkeit der nachträglichen Besicherung 358
D. Anfechtbarkeit der Rückzahlung absteigender Darlehen 360
I. Die Kontokorrentproblematik i.R.d. § 135 InsO 360
II. Bewertung – Notwendigkeit einer Korrektur 363
III. Lösungsansätze 363
1. Zehn-Jahres-Frist vs. Ein-Jahres-Frist 364
a) Das Verhältnis von § 135 Abs. 1 Nr. 2 zu Nr. 1 364
b) Die Aufrechnungslage im Kontokorrent als Sicherung i.S.d. Abs. 1 368
2. Einzelbetrachtung vs. Gesamtbetrachtung 371
a) Neuere Rechtsprechung des BGH 372
aa) Urteil vom 7. März 2013 372
bb) Urteil vom 4. Juli 2013 373
cc) Beschluss vom 16. Januar 2014 374
b) Auswirkungen auf cash-pooling-Fälle 375
c) Höhe des Anspruchs 381
IV. Ergebnis zur Anfechtbarkeit nach § 135 InsO 384
E. Besonderheiten bei der Abwicklung über eine Betreibergesellschaft 385
F. Bewertung – Rechtspolitischer Handlungsbedarf? 388
G. Wesentliche Ergebnisse 391
§ 6 Zusammenfassung und Gesamtwürdigung 393
A. Wesentliche Ergebnisse 393
I. Anforderungen an die Vergabe aufsteigender Darlehen 393
II. Nachgelagerte Kontrollpflichten 394
III. Verzinsung 396
IV. Haftungsrisiken 396
B. Gesamtbild und verbleibende Spielräume 399
C. Würdigung 401
Literaturverzeichnis 407
| Erscheint lt. Verlag | 3.12.2017 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Studien zum Gesellschaftsrecht |
| Verlagsort | Baden-Baden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht ► Gesellschaftsrecht |
| Schlagworte | absteigende Darlehen • aufsteigende Darlehen • Cash Pool • Cash Pooling • downstream loans • GmbH • Konzern • Konzernfinanzierung • upstream loans |
| ISBN-10 | 3-8452-8855-8 / 3845288558 |
| ISBN-13 | 978-3-8452-8855-0 / 9783845288550 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich