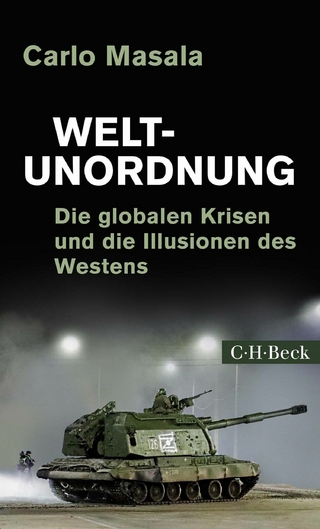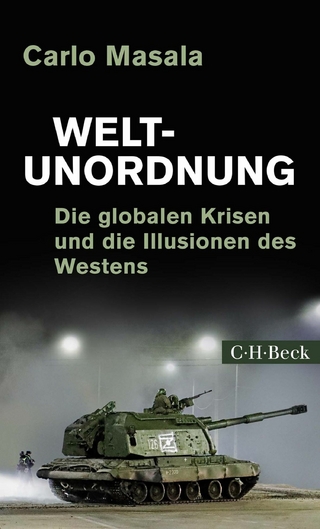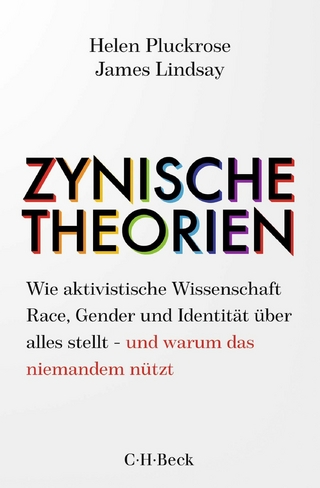Tatort Krankenhaus (eBook)
256 Seiten
Verlagsgruppe Droemer Knaur
978-3-426-43965-4 (ISBN)
Professor em. Dr. med. Karl H. Beine, geboren 1951, war bis 2020 Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Witten/Herdecke und Chefarzt am St. Marien-Hospital Hamm. Er forscht seit vielen Jahren zu Tötungsserien in Kliniken und Heimen. In der überarbeiteten Taschenbuchausgabe des Titels 'Tatort Krankenhaus' untersucht er deutsche Fälle. In einer aktuellen Studie zum Dunkelfeld hat er mehr als 5000 Ärzte und Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern zu ihrer Praxis bei Lebensverkürzungen befragt.
Professor em. Dr. med. Karl H. Beine, geboren 1951, war bis 2020 Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Witten/Herdecke und Chefarzt am St. Marien-Hospital Hamm. Er forscht seit vielen Jahren zu Tötungsserien in Kliniken und Heimen. In der überarbeiteten Taschenbuchausgabe des Titels "Tatort Krankenhaus" untersucht er deutsche Fälle. In einer aktuellen Studie zum Dunkelfeld hat er mehr als 5000 Ärzte und Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern zu ihrer Praxis bei Lebensverkürzungen befragt.
Pflege am Limit
Ein Kollege, nennen wir ihn Thomas, ist Mitte fünfzig. Seit vielen Jahren arbeitet er als Stellvertretender Pflegedienstleiter auf einer großen kardiologischen Intensivstation. Er sagte: »Noch bevor schwerwiegende Fehler passieren, merkt man, dass etwas nicht stimmt.«
Sein Beispiel: Ein Patient bekommt mit mehr als einer Stunde Verspätung sein Mittagessen. Er braucht Hilfe, kann sich nicht allein versorgen. Aber weil andere Dinge wichtiger sind, bleibt die Mahlzeit erst einmal stehen. Das ist für sich genommen noch kein Fehler, »aber meinen Kindern würde ich das nicht zumuten.« Im Krankenhaus, fügte er bitter hinzu, wären zuerst die Patienten die Leidtragenden, dann würden die Pflegekräfte missbraucht. »Wir sind es, die mit unserem Gewissen klarkommen müssen.« Manchmal würde er gerne kündigen, aber als Familienvater sei das nicht so leicht.
Auch Sabine, die seit dreißig Jahren in der Pflege arbeitet, würde am liebsten etwas anderes machen. Mit vier Kolleg*innen ist sie zuständig für 45 Betten – in den letzten Monaten waren sie sogar oft nur zu dritt.
Sabine brach vor einem Jahr mitten im Dienst zusammen. Kollaps, totale Überlastung. Das war ihr schon einmal passiert, einige Jahre zuvor, auf einer anderen Station. An ihrer derzeitigen Arbeitsstelle wären die Arbeitsbedingungen lange ganz in Ordnung gewesen, doch die Situation hätte sich kontinuierlich verschärft. Sie liebte ihr Team, machte ihre Arbeit mit Leidenschaft. Und jetzt fürchtete sie, dass genau das ihr Problem sein könnte. »Ich bin Perfektionistin«, sagte sie. »Und ich sehe, wenn ich die Arbeit nicht machen kann, die eigentlich gemacht werden müsste. Weil zu wenig Personal da ist. Das macht mich fertig.« Sie hätte schon lange keine Zeit mehr, um Patienten gründlich zu waschen. Und das wäre noch das geringste Problem.
Das ganze System wäre nur noch für eine Minimalversorgung ausgelegt. »Eigentlich dürften wir nur in das Zimmer reingehen, Blutdruck messen, Tabletten hinstellen, Pflaster wechseln, rausgehen. Mehr ist nicht drin. Wir haben aber viele alte, schwer kranke Leute auf Station, die man komplett versorgen muss. Das können wir nicht leisten, deshalb sind wir froh, wenn uns Angehörige einen Teil der Arbeit abnehmen.« Auf die Frage, ob das denn dann nur Arbeiten wie Hilfe beim Essen oder Waschen beträfe, blieb ihre Antwort zunächst aus. Sabine starrte eine Zeit lang ins Leere. »So sollte es sein. Natürlich.«
Zwischen den Zeilen konnte man deutlich heraushören, dass es auch für andere Dinge nicht mehr reicht. Die Situation verschärft sich zusätzlich zur Urlaubszeit oder wenn Kollegen krank sind. Dann muss unter Umständen ein Pfleger 15 zusätzliche Patienten mit übernehmen. Sogar offiziell heißt es dann, jetzt könne schon mal »von den Standards abgewichen werden«.
Sabines Geschichte ist eine von vielen, an der sich aufzeigen lässt, wie Personalknappheit und Arbeitslast zuerst Auswirkungen auf die Kranken haben und dann auf die Mitarbeitenden. Patient*innen können nur unzureichend versorgt werden. Pfleger*innen werden aufgrund der Überlastung krank, können und/oder wollen zu diesen Bedingungen nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten.
Was könnten die Mitarbeiter aus den Krankenhäusern tun, um die Situation zu verbessern? Das Arbeitsrecht sieht die Möglichkeit vor, dass ein Arbeitnehmer bei Vorgesetzten eine Überlastungsanzeige machen kann. Wer seinen Arbeitgeber über eine akute Belastung in Kenntnis setzt, kann für etwaige Fehler in dieser Zeit schwerlich verantwortlich gemacht werden.
Konkret hilft das dem Überlasteten allerdings nur wenig weiter. Verfasst man eine solche Überlastungsanzeige, ändert sich zunächst einmal nichts. Man muss im Alltag trotzdem irgendwie klarkommen.
Wie eine Pflegerin einmal resigniert zu diesem Thema bemerkte: »Nach so einer Anzeige wird ja niemand Neues hergezaubert. Das Team muss das irgendwie schaffen. Und wenn dann einer wegen einer Belastungsanzeige vielleicht eine zusätzliche Pause bekommt, muss der Rest das wuppen. Da überlegt man sich schon, ob man so was macht. Zumal man nie weiß, was das langfristig für Konsequenzen nach sich zieht und ob es einen nicht den Job kosten kann.«
Trotzdem würden sich die Überlastungsanzeigen auf ihrer Station häufen. Klinikleitung, Ärzte und Mitarbeiter sollten in der steigenden Anzahl der Anzeigen ein Zeichen sehen. Ebenso in den typischen Angaben von Patient*innen in Bewertungsbögen über ihren Aufenthalt. Hektisches Personal und fehlende Erklärungen werden häufig beklagt. Für die Mitarbeiter wäre dieses Feedback zwar frustrierend, aber unvermeidbar, weil es die Realität wiedergäbe.
Im Grunde müsste es einen großen Aufstand geben. Doch resigniert erklärte die Krankenschwester: »Wir sind alle zu gutmütig.« Man übte den Beruf aus, weil man eben irgendwie sozial eingestellt wäre – und weil man sich die Situation schönredete.
Für Pflegekräfte wie auch für viele Ärzt*innen ist klar: Das finanzielle Betriebsergebnis ist das Maß der Dinge im Krankenhausalltag. Die Verwaltung hat aber nur wenig Einblick in die medizinischen Abläufe, gleichwohl wird dort bestimmt, wie es im Krankenhaus zu laufen habe.
Sabine, jene Krankenschwester, die die Überbelastung mit einem Kollaps büßen musste, sagte dazu: »Da fühle ich mich absolut vernachlässigt und verarscht, wenn mir dann einer sagt, ihr müsst noch schneller machen.«
Der Pflegedienstleiter einer Intensivstation pflichtete ihr bei. Wenige Betriebswirte wüssten, wie ein Krankenhaus funktioniere. Trotzdem wäre das Einzige, was zählte, die Fallzahl. Die Pflege hinge immer vom Etat des jeweiligen medizinischen Bereichs ab und litte an dem Problem, zu teuer zu sein – allein aufgrund des notwendigen Personals. Er bedauerte, dass der Berufsstand der Pflege sich in seinem Unternehmen, wie er die Klinik nannte, nicht positionieren könnte. Gegen die fortschreitende Ökonomisierung hätte es keine Widerstände gegeben, keine Gegenargumente. Im Gespräch mit ihm fielen auch die Worte »Opferrolle« und »Abwärtsspirale.« Der Ökonomisierungsprozess hätte vor allem eines mit sich gebracht: »Wir dünnen die Qualität in der Fläche aus, um punktuell leisten zu können, was gefordert ist.«
Sebastian ist Ende vierzig und Pfleger auf einer Herzstation. Er bedauerte, dass man »mehr die medizinischen Dinge und die organisatorischen und logistischen Abläufe verwaltet, als dass man sich wirklich ganzheitlich um den Patienten kümmern kann.« Seiner Meinung nach ordneten die Krankenhäuser sich zu sehr dem von der Politik und den Kassen auferlegten Fallpauschalensystem unter. Alles, was diese Unterordnung nach sich zog, hielt er für eine falsche Entwicklung: erzwungene Fallzahlsteigerungen, kürzere Liegezeiten, vor allem auf der Intensivstation. Dem Diktat der Ökonomie folgend müsste man Patienten schneller auf die Normalstation verlegen. »Früher haben wir Patienten noch aufgepäppelt, das ist heutzutage nicht mehr drin.«
Besonders zu kämpfen hätten seiner Meinung nach kardiologische Stationen, die frisch operierte Herzpatienten aufnehmen müssen. »Diese Kranken sind pflegerisch aufwendig!« Wenn er mitbekäme, dass von 35 Patienten nur fünf selbstständig auf die Toilette gehen können, dann würde er auf der kardiologischen Station aushelfen, sagte er. Eine Dauerlösung wäre das wegen der hohen eigenen Arbeitsbelastung aber nicht.
Eine Kollegin von der Kardiologie konnte ihm nur zustimmen. Sie sagte, der Stress hätte in den letzten zwei Jahren deutlich zugenommen. »Wir haben einfach viele Patienten, die direkt von den Wachstationen kommen.« Beispielsweise nach Eingriffen an den Herzklappen. Die Frischoperierten, so schilderte sie, blieben einen Tag auf der Intensivstation, dann würden sie bereits verlegt. »Diese Patienten können nicht viel, manche sind verwirrt, und alle muss man mobilisieren.« Das kostet Zeit. Ihr Fazit: »Eigentlich ist es unmenschlich, was gefordert wird. Das ist nicht zu schaffen.«
Eine pflegerische Stationsleitung beschrieb den ganz normalen Arbeitsalltag so: »Ich arbeite immer unter Druck. Auf der Station gibt es 45 Betten, das Telefon klingelt nonstop. Patient A muss zum Röntgen, Patient B bekommt einen Herzkatheter, muss vorher aber noch ein Langzeit-EKG machen. Wenn ich jemanden zum Röntgen begleiten muss, dauert das, und ich bin weg von der Station, kann mich also nicht um andere Patienten kümmern. Permanent prasseln Informationen auf einen ein, nichts darf vergessen werden.« Das alles sei »schon sehr dicht«. Es klang, als würde sie sich selbst Mut zusprechen, wenn sie sagte: »Es gelingt mir in der Regel, ruhig zu bleiben.« Man müsste nach Kräften versuchen, alles irgendwie am Laufen zu halten. Dass da auch einiges durch das Raster fiele, wäre logisch. »Ich führe oft keine korrekte Reinigung bei den Patienten durch, säubere höchstens Gesicht, Zähne und vielleicht den Genitalbereich.«
Viel schlimmer als diese Katzenwäsche fand sie, dass ihr keine Zeit mehr für Gespräche bliebe. Die meisten Patienten hätten einen großen Redebedarf, müssten schließlich ja auch aufgeklärt werden. »Manche fragen mir regelrecht Löcher in den Bauch«, sagte sie, und fast klang es wie ein Vorwurf. Hinzu kämen die besorgten Angehörigen, die sich vor Ort oder über das Telefon ein Bild vom Krankheitszustand des Patienten verschaffen wollten.
Angehörige mit ihrem berechtigten Bedürfnis nach Aufklärung oder auch nur einem anteilnehmenden Gespräch schienen für viele Pflegekräfte ein echtes Problem zu sein. Nicht wenige klangen genervt, als sie darüber sprachen. Natürlich könnte man das Bedürfnis nach Aufklärung verstehen, aber die Zeit,...
| Erscheint lt. Verlag | 3.4.2017 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Altenbetreuung • Altenpflege • Altenpflege Bücher • Altenpflege Deutschland • Altenpflege heute • Altersheim • Erfahrungsberichte • Erfahrungsberichte wahre Geschichten • Gesundheit • Gesundheitsindustrie • Gesundheitssektor • Gesundheitssystem • Gesundheitssystem Deutschland • Hilfsbedürftige • Krankenhaus • Krankenhaus Buch • Krankenschwester • Medizinische Ethik • Medizinische Versorgung • Pflegeeinrichtungen • Pflege in Deutschland • Pflegekräfte • Pflegemissbrauch • Pflegemord • Pflegenotstand • Pflegepersonal • Pfleger • schlecht bezahlte Pflege • Sterbehilfe • Wahre GEschichte |
| ISBN-10 | 3-426-43965-4 / 3426439654 |
| ISBN-13 | 978-3-426-43965-4 / 9783426439654 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich