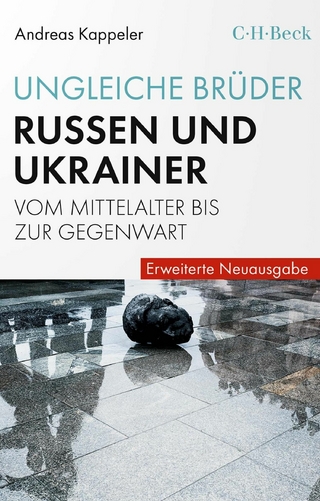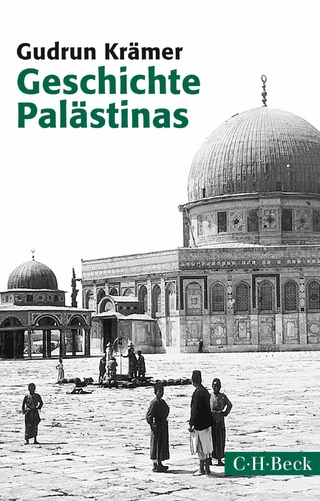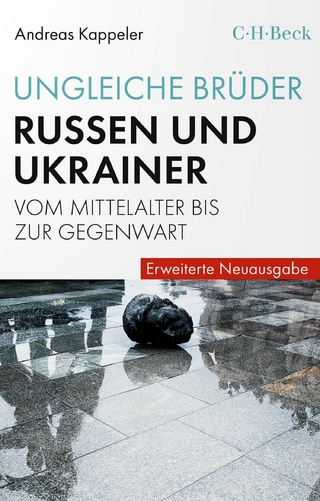Großmachtträume. Die Türkei zwischen Demokratie und Diktatur (eBook)
189 Seiten
Reclam Verlag
978-3-15-961672-8 (ISBN)
Die Journalistin Luise Sammann, geb. 1985, arbeitete zwischen 2009 und 2018 in Istanbul als freie Korrespondentin u. a. für den Deutschlandfunk. Heute lebt sie in Berlin.
Die Journalistin Luise Sammann, geb. 1985, arbeitete zwischen 2009 und 2018 in Istanbul als freie Korrespondentin u. a. für den Deutschlandfunk. Heute lebt sie in Berlin.
Vorwort
Was gehen uns die Türken an?
Erdoğan – Diktator oder nicht?
Erdoğan-Bashing und erhobener Zeigefinger sind zwecklos
Wo ein "Führer", da ein Volk
Von wegen dumme Bauern: Die Erdoğan-Anhänger
Von wegen alles Vorzeigedemokraten: Die Erdoğan-Gegner
Von Vätern und "Führern"
Woher kommt die türkische Führerliebe?
Erdoğan ist nicht das (einzige) Problem!
Gesucht: Langfristige Strategien im Umgang mit der Türkei
Europa und die Türkei – eine Hassliebe
Jetzt erst recht! Ein Plädoyer für Bildung, Dialog und Austausch
Schlusswort: Mit Erdoğan reden?
Anmerkungen
Erdoğan – Diktator oder nicht?
Wer dieser Tage über die Türkei spricht, der spricht automatisch über ihren seit 2003 regierenden Präsidenten: Recep Tayyip Erdoğan (* 1954). Dabei existiert dort sehr wohl noch ein türkisches Parlament. Obwohl es unerschrockene Oppositionspolitiker, einige wenige kritische Journalisten und eine kleine, aber beeindruckend aktive Zivilgesellschaft gibt, beginnt und endet längst jeder Gedanke über die türkische Republik mit ihrem immer mächtiger werdenden Präsidenten. Auch mir selbst, die ich das kritisiere, geht es viel zu häufig so. Dass man Erdoğan und seinem Geltungsdrang damit in die Hände spielt, wird dabei schnell vergessen, wohl auch, weil es nur wenige Themen oder Personen gibt, über die sich die deutsche Öffentlichkeit in den letzten Jahren so einig war wie über Recep Tayyip Erdoğan.
Während Dieselfahrverbote, Bundeswehrauslandseinsätze oder der Umgang mit der AfD tagtäglich für hitzige Debatten in Parlamenten wie an Stammtischen sorgen, ist man sich bei der Bewertung des türkischen Präsidenten meist sehr schnell einig: Erdoğan gilt in Deutschland – zumindest innerhalb der nicht türkischstämmigen Mehrheitsgesellschaft – von links bis rechts als Hassobjekt. Als Inbegriff von Unterdrückung. Als Antidemokrat. Fast schon wohltuend wirkt diese Einigkeit, mit der sich die ansonsten zunehmend zerstrittene deutsche Öffentlichkeit über den türkischen Präsidenten empören kann.
So war die Aufregung zum Beispiel groß, als er den Deutschen und ihrer Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2017 gleich mehrfach Nazimethoden vorwarf. Dazu gebracht hatten ihn Verbote gegenüber ihm selbst und seinen Ministern, in Deutschland Wahlkampf zu betreiben bzw. für das auf ihn zugeschnittene Präsidialsystem zu werben. »Deutschland, du hast in keiner Weise ein Verhältnis zur Demokratie und du solltest wissen, dass deine derzeitigen Praktiken keinen Unterschied machen zu den Praktiken in der Nazi-Zeit«, wütete Erdoğan bei einer Veranstaltung in Istanbul. »Wir werden über Deutschlands Verhalten auf der internationalen Bühne sprechen und die Deutschen vor den Augen der Welt beschämen. Wir wollen die Nazi-Welt nicht mehr sehen. Nicht ihre faschistischen Taten. Wir dachten, dass diese Ära vorbei wäre, aber offenbar ist sie es nicht«, betonte der Präsident damals. Kein Wunder, dass verbale Ausfälle wie dieser bei den angesprochenen Deutschen vor allem drei Dinge hervorriefen: Unverständnis, Empörung und Wut gegenüber diesem Politiker – einem »Präsidenten ohne Maß«, wie der Berliner Tagesspiegel am 5. März 2017 titelte.
Dementsprechend melden sich nur erklärte Erdoğan-Anhänger in Deutschland überhaupt noch zu Wort – womit sie sich allerdings im öffentlichen Diskurs mehr oder weniger automatisch disqualifizieren –, wenn große europäische Medien den türkischen Präsidenten gleich in der Überschrift als »Diktator« bezeichnen. Beispiele dafür finden sich in schöner Regelmäßigkeit sowohl links als auch rechts im politischen Spektrum. In anderen europäischen Ländern verläuft die Debatte ähnlich. Als das französische Politmagazin Le Point im Mai 2018 ein ganzes Heft mit Erdoğans Foto und dem Titel »Der Diktator« betitelte, waren es ausschließlich bekennende AKP-Fans, die Einspruch erhoben und forderten, dass die Werbeplakate der Heftausgabe von Kiosken entfernt werden. Teilweise schritten sie gleich selbst zur Tat. Präsident Emmanuel Macron sah sich daraufhin genötigt, auf Twitter die Pressefreiheit zu verteidigen. Die Frage aber, ob Erdoğan nun tatsächlich ein Diktator ist oder nicht, blieb hier wie dort ungeklärt. Seit bald zwanzig Jahren schon feiern seine Anhänger ihn explizit als den größten Demokraten aller Zeiten, während seine Gegner ihn nicht selten in eine Reihe mit Faschisten wie Adolf Hitler und Benito Mussolini stellen. Wie kann das sein?
Tatsächlich sah es ja bis zum Jahr 2011 so aus, als ob ausgerechnet Erdoğan die türkische Republik nicht auto-, sondern demokratischer machen würde. Es war Erdoğan, der die jahrzehntealte Macht des Militärs beschnitt, den Dialog mit den Minderheiten im Land förderte, das Kopftuchverbot aufhob und die Türkei näher an die EU heranführte. Dafür erhielt er am 3. Oktober 2014 den Quadriga- Preis der Werkstatt Deutschland; der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hielt eine Laudatio. Im Publikum saßen Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) und viele andere, die heute zu den größten und lautesten Erdoğan-Kritikern gehören. Schröder betonte damals:
Die Werkstatt Deutschland ehrt mit dem »Quadriga«-Preis heute einen großen Reformpolitiker, der sein Land in die Europäische Union führen will. […]
Ihr Eintreten für mehr Freiheit, einen besseren Schutz der Menschenrechte und weniger staatliche Bevormundung ist für Sie, Herr Ministerpräsident, aber kein Zugeständnis an Europa. Sondern es ist Konsequenz Ihrer politischen Überzeugung – und auch Folge leidvoller persönlicher Erfahrungen mit Unterdrückung und Verfolgung. In der offiziellen Begründung der heutigen Preisverleihung heißt es, dass sich in Ihrer Persönlichkeit demokratische Überzeugung und religiöse Verwurzelung in glaubwürdiger Weise vereinen.
In der Tat: Sie haben bewiesen – auch wenn Ihr politischer Weg nicht frei von »Umwegen« war –, dass beide Aspekte miteinander vereinbar sind.
Viel, unglaublich viel, hat sich verändert, seit Gerhard Schröder diese Worte an Recep Tayyip Erdoğan richtete. Und dennoch müssen wir uns fragen: Kann man einen einstigen Würden- und Hoffnungsträger dieser Art nun also bedenkenlos als Diktator bezeichnen? Ihn, der seit dieser Preisverleihung ein ums andere Mal durch die Wählerstimmen von Millionen Türken im Amt bestätigt wurde, wie er seinen Kritikern gern und häufig entgegenhält? Was, wenn nicht die Wahlergebnisse der letzten Jahre, könnten ein besserer Beweis für Erdoğans Demokratiefähigkeit sein?
Auch der AKP-Chef selbst wehrt sich gegen das Etikett des Diktators. Mehr als 2500 Verfahren strengte er in den letzten Jahren gegen türkische Journalisten, Twitternutzer, Studenten und Hausfrauen an, weil sie ihn als Diktator bezeichnet hatten. Selbst gegen den Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, ging er aus diesem Grunde vor Gericht. In seinem bemerkenswerten Interview mit Giovanni di Lorenzo legte Erdoğan dem Chefredakteur der ZEIT im Juli 2017 nahe: »Sie sollten erst einmal nachschlagen, was das ist, ein Diktator!«
Tun wir also genau das. Laut Duden ist ein Diktator ein »unumschränkter Machthaber in einem Staat« oder auch ein »herrischer, despotischer Mensch«. In der römischen Republik bezeichnete man jemanden, der »in Notzeiten vorübergehend mit der Gesamtleitung des Staates« betraut wurde, als Diktator – also eine Person, die ohne Kontrolle schalten und walten konnte. Zweifellos passt all das gut auf das System, das der türkische Präsident spätestens seit dem Sommer 2016 als Folge von Putschversuch und Ausnahmezustand in der Türkei zu etablieren sucht. Es handelt sich um ein System, in dem die Gewaltenteilung praktisch abgeschafft wurde, seit Judikative, Legislative und Exekutive allesamt direkt oder indirekt von Erdoğan bzw. seinen engsten Vertrauten kontrolliert werden und das Parlament praktisch entmachtet ist. Ein System, in dem laut Reporter ohne Grenzen und anderen kritischen Organisationen mehr Journalisten im Gefängnis sitzen als in irgendeinem anderen Land auf der Welt und in dem zahlreiche Oppositionspolitiker und Aktivisten mit Drohungen, Klagen oder gar Gefängnisstrafen zum Schweigen gebracht wurden. Erdoğan und seine Anhänger rechtfertigen all das mit Terror- und Umsturzvorwürfen – ein Totschlagargument, das inzwischen praktisch jedem zum Verhängnis werden kann, der sich in der Türkei noch kritisch zu äußern wagt.
Tatsächlich landeten Hunderttausende Menschen infolge des Putschversuchs vom 15. Juli 2016 im Gefängnis. Mehr als 150 000 Beamte verloren ihre Jobs. Niemand von uns kann zu 100 Prozent sicher sein, dass sie alle unschuldig sind. Doch stehen Beweise für ihre Vergehen in vielen Fällen bis heute aus. Gerade das – die pauschale Kriminalisierung eines jeden, der sich gegen ihn stellt – macht Erdoğan in den Augen seiner Kritiker zu einem typischen Diktator. Selbst einige türkische Richter schlossen sich dieser Sichtweise an (bewiesen damit allerdings zugleich, dass demokratische Instanzen zumindest teilweise doch noch funktionierten), als sie in einem Gerichtsurteil des Jahres 2015 entschieden, dass die Zeitung Cumhuriyet den mächtigen Präsidenten sehr wohl als »Diktator« bezeichnen darf – was sie und die wenigen anderen verbliebenen regierungskritischen Medien im Land seitdem auch regelmäßig tun.
Allerdings zahlen sie dafür ihren Preis. Die Hälfte der Cumhuriyet-Redaktion ist in den vergangenen Jahren für kurze oder auch lange Zeit im Gefängnis gelandet, weil man ihr Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Verbreitung von Terrorpropaganda vorwarf – seit einigen Jahren eine Art Totschlagargument gegen Regierungskritiker jeder Art in der Türkei. Inzwischen ist die Cumhuriyet dank ihres neu gewählten...
| Erscheint lt. Verlag | 11.3.2020 |
|---|---|
| Verlagsort | Ditzingen |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Regional- / Landesgeschichte |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Naturwissenschaften ► Geowissenschaften ► Geografie / Kartografie | |
| Schlagworte | deutsch-türkische Beziehung • Geschichte Türkei • Recep Tayyip Erdoğan • Türkei |
| ISBN-10 | 3-15-961672-X / 315961672X |
| ISBN-13 | 978-3-15-961672-8 / 9783159616728 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich