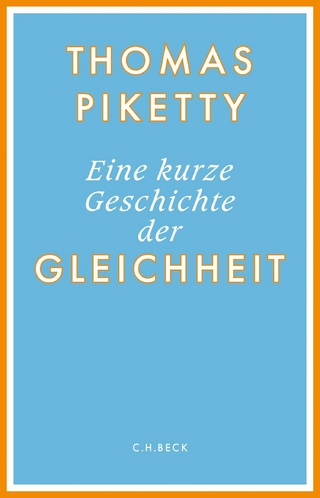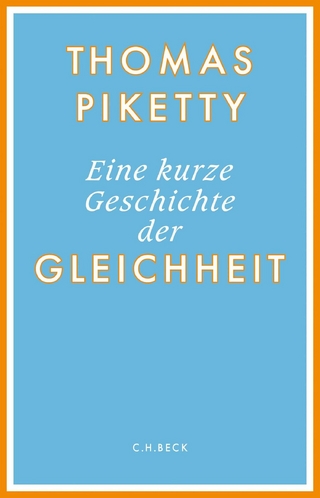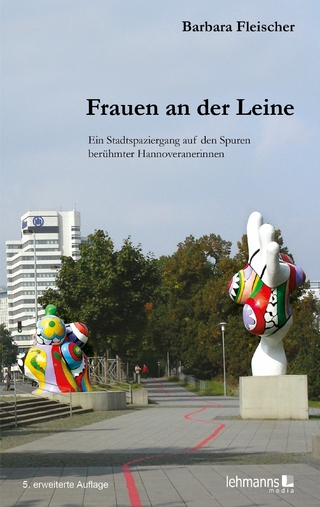Vom Konklave zum Assessment-Center (eBook)
272 Seiten
wbg Academic in der Verlag Herder GmbH
978-3-534-27381-2 (ISBN)
Christoph Cornelißen lehrt als ordentlicher Professor für Neueste Geschichte an der Universität Frankfurt, wo er von 2017 bis 2019 als Dekan tätig war. Von 2011 bis 2017 war er Mitglied im Senat und Hauptausschuss der DFG. Momentan ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Heidelberger Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, der Historischen Kommission für Nassau und der Frankfurter Historischen Kommission. Seit 2021 ist er Mitglied im Beirat des Deutschen Historischen Instituts in Rom.
Andreas Fahrmeir arbeitete nach seiner Promotion in Cambridge zunächst am Deutschen Historischen Institut in London und hatte eine Professur in Köln inne. Seit 2006 ist er Professor für Neuere Geschichte unter besonderer Berücksichtigung des 19. Jahrhunderts an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sein jüngstes Buch "Deutschland. Globalgeschichte einer Nation" war ein großer Erfolg. Christoph Cornelißen lehrt als ordentlicher Professor für Neueste Geschichte an der Universität Frankfurt, wo er von 2017 bis 2019 als Dekan tätig war. Von 2011 bis 2017 war er Mitglied im Senat und Hauptausschuss der DFG. Momentan ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Heidelberger Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, der Historischen Kommission für Nassau und der Frankfurter Historischen Kommission. Seit 2021 ist er Mitglied im Beirat des Deutschen Historischen Instituts in Rom.
Einleitung – Personalentscheidungen und ihr Scheitern
(Andreas Fahrmeir) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Johannes Chrysostomos – Bischof zwischen Scheitern und Heiligung
(Hartmut Leppin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mundo und Smbat Bagratuni –
Meritokratie und Diversitat im romischen Heer des 6. Jahrhunderts
(Dawid Wierzejski). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Von blinden Feldherren und einem bedrangten Kaiser –
Generalsbestellungen unter Isaakios II. Angelos (1185–1195)
(Tristan Schmidt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Episcopus ingratus oder das »Scheitern« eines Reformers
in der Serenissima (1418–1437)
(Daniela Rando) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Eine gescheiterte Wahl auf dem Baseler Konzil –
Juan de Segovia uber die Absetzung Eugens IV. (1439)
(Davide Scotto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Geworden und gestaltet – Reformsemantik des
Papstwahlzeremoniells in Mittelalter und Fruher Neuzeit
(Kevin Hecken und Stefan Schoch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Auf der Suche nach dem Richtigen – Wahrsagerei als Faktor
in der Personalpolitik unter Kurfurst August von Sachsen (1526–1586)
(Ulrike Ludwig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Kritik an der kurialen Personalpolitik im 18. Jahrhundert –
Der Predigerorden an den Schaltstellen romischer Macht oder
wie ein Jesuit sich selbst zensieren musste
(Andreea Badea). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Der unbequeme Philosoph – Hippolyte Taine (1828–1893)
und der Concours d’Agregation von 1851
(Annika Klein). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Das Alter des Surendranath Banerjea – Von der Schwierigkeit
der (Un-)Gleichheit
(Andreas Fahrmeir) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Wer zahlt, schafft an? – Akademische Personalentscheidungen
und wirtschaftliche Interessen
(Werner Plumpe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Ungeeignet – Personlichkeitsprofile nicht beforderter Fuhrungskrafte
im Spiegel von Eignungsuntersuchungen (ca. 1965–1990)
(Jorg Lesczenski). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Gerard Depardieu und der Prafekt (Muriel Favre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Eignungserwartung und Scheitern
(Christoph Cornelisen, Birgit Emich, Hartmut Leppin, Jorg Lesczenski,
Daniela
Rando, Davide Scotto und Camilla Tenaglia). . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Meritokratie und Diversitat
(Andreea Badea, Muriel Favre und Annika Klein). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Struktur und Ereignis
(Andreas Fahrmeir, Kevin Hecken, Werner Plumpe,
Stefan Schoch und Tristan Schmidt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Danksagung und Autor:innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Einleitung – Personalentscheidungen und ihr Scheitern
Andreas Fahrmeir
Personalentscheidungen, das klingt nach einem abstrakten, etwas trockenen Thema. Die Bilder, die einem zunächst in den Sinn kommen, haben in erster Linie mit Personalabteilungen, Aktenstapeln oder »[F]ace-to-screen-Interaktion mit den eingegangenen Lebensläufen«1 zu tun. Sie lassen an eigene Bewerbungsgespräche, Aushandlungen mit zuständigen Gremien und an eine spezialisierte Forschungsrichtung denken, die sich mit der Optimierung (vorwiegend betrieblicher) Personalentscheidungen beschäftigt und die in Foren wie der Zeitschrift für Personalforschung, dem International Journal of Selection & Assessment und zahlreichen weiteren Periodika verhandelt wird. Vornehmlich beschäftigen diese sich mit Arbeits- und Organisationspsychologie. Ohne Zweifel, Personalentscheidungen sind wichtig. Dazu passt das Klischee, dass »Mitarbeiter« das »wichtigste« oder »wertvollste« Kapital eines Unternehmens sind – zumindest wies Google am 16. April 2021 mehrere Tausend Seiten auf, auf denen sich große und kleine Unternehmen diese »Lebenslüge vieler Chefs« zu eigen machten.2 Gleichzeitig klingen derartige Texte sehr technisch, sodass Gesprächspartner beim Stichwort rasch einen etwas abwesenden Blick bekommen.
Das steht im Gegensatz zur Bedeutung, die immer wieder einzelnen Personalentscheidungen zugeschrieben wird: So schienen sich die Probleme der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die 2020/21 in den Insolvenzfällen Wirecard und Greensill Bank deutlich wurden, im Kern durch eine Neubesetzung des Leitungspostens beheben zu lassen, also mit dem Ersatz einer im Rückblick offenbar nicht richtigen Personalentscheidung durch eine bessere. Darin liegt gewiss ein Element der rhetorischen Personalisierung von strukturellen Entwicklungen, das leicht zu dekonstruieren ist: Je größer eine Organisation wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass eine einzige Person an Fehlentwicklungen alleine schuld sein kann – schon deshalb, weil sie gar nicht die Möglichkeit hätte, einen Überblick über alle Vorgänge zu haben.
Es steht aber auch im Gegensatz zu der Bedeutung, die Personalentscheidungen dann gewinnen, wenn sie im Widerspruch zu gesellschaftlichen Erwartungen stehen, etwa durch die Bevorzugung bestimmter Gruppen gegenüber anderen, die diese Diskriminierung nicht mehr hinzunehmen gewillt sind. Ein Beispiel ist die Diskussion darüber, wie man in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen (in der Wirtschaft, im Wissenschaftssystem, in der Verwaltung oder in der Politik) Geschlechtergerechtigkeit oder eine gerechte Verteilung von begehrten Positionen zwischen Gruppen, die durch ethnische Identitäten oder Zuschreibungen oder durch soziale Ungleichheiten definiert sind, erreichen kann. Eine Spannung, die in diesen Debatten oft, nicht zuletzt vor den zuständigen Gerichten, verhandelt wird, ist die zwischen einem System von Personalentscheidungen, das statistisch beschreibbare Ergebnisse hat, die Auffälligkeiten aufweisen und der Anforderung an jede einzelne Personalentscheidung, ausschließlich anhand klar definierter Stellenprofile und Leistungs- oder Qualifikationsnachweisen potenzielle Bewerberinnen und Bewerber zu identifizieren, um aus diesem Kreis den oder die Beste auszuwählen, ohne dass dabei unbedingt schon klar ist, wie sich diese Entscheidung statistisch auswirken wird. Auf den ersten Blick scheint es sich dabei um ein sehr modernes Problem zu handeln, das die Verfügbarkeit von Statistiken, allgemeine Gleichheitsvorstellungen und eine starke Verrechtlichung von Personalentscheidungen zur Voraussetzung hat.
Die Beobachtung konkreter Beispiele bringt aber ein ganz anderes Ergebnis zum Vorschein, und es zeigt sich, dass das Nachdenken über Personalentscheidungen und ihre Risiken keineswegs neu ist. Im Gegenteil: Wenn es um Posten geht, die von anerkannt großer Wichtigkeit sind, muss die Art und Weise, wie sie vergeben werden, Gegenstand von Reflexionen und Regeln sein. Die US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen zeigen das eindringlich, gehören sie doch zweifellos zu den zentralen politischen Personalentscheidungen; als sie eingeführt wurden, lösten sie eine andere, für weniger erfolgreich befundene Methode der Personalentscheidung, nämlich die monarchische Erbfolge, ab. Dabei soll ein recht komplexes Verfahren Fehlentscheidungen vermeiden. Mögliche Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich zunächst innerhalb ihrer Partei gegen Konkurrentinnen und Konkurrenten durchsetzen, bevor sie – theoretisch bereits auf Herz und Nieren geprüft und wahlkampfgestählt – gegen die Person oder die Personen antreten, die von der oder den anderen Parteien aufgestellt wurden. Um die unmittelbaren Emotionen der Wählerschaft zu moderieren und die abschließende Personalentscheidung davon zu lösen, wurde noch ein Gremium von Wahlmännern eingesetzt, dessen Bedeutung allerdings im Laufe der Zeit zurückging und das faktisch nur noch die in einzelnen Staaten erzielten Mehrheiten repräsentiert. Das System macht es wahrscheinlich, dass erfolgreiche Bewerberinnen oder Bewerber in aller Regel auf eine längere Karriere zurückblicken können und bereits ein hohes politisches Amt (Gouverneur:in, Senator:in, Bundesabgeordnete:r) innehatten, sodass ein Nachweis ihrer prinzipiellen Befähigung vorliegt.
Um die Folgen einer trotz allem möglichen Fehlentscheidung einzuhegen, sah bereits die Verfassung von 1789 vor, dass Kandidat:innen dank einer Altersschranke von 35 Jahren menschlich gereift und dank der Anforderung, »natural born citizens« zu sein, die seit mindestens 14 Jahren im Territorium der damals gerade erst gegründeten Republik lebten, keinen Loyalitätskonflikten ausgesetzt sein würden. Um das Risiko weiter zu minimieren, war die Gültigkeit der Personalentscheidung auf vier Jahre beschränkt, nach deren Ablauf sie durch eine erneute Wahl bestätigt oder revidiert werden müsste. Sollte es vorher trotzdem zu schweren Verwerfungen kommen, konnte eine Mehrheit der Abgeordneten des Repräsentantenhauses den Präsidenten anklagen, eine Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Senats ihn absetzen und bei Bedarf für die Zukunft von allen politischen Ämtern ausschließen. Man sieht: Die potenzielle Machtfülle des Amtes sollte durch Einschränkungen bei der Dauer und eine mögliche Sanktionierung für Fehlverhalten eingehegt werden. Als durch die vierfache Wiederwahl Franklin Delano Roosevelts deutlich wurde, dass die gewohnheitsrechtliche Beschränkung der Amtszeit auf zwei Wahlperioden nicht mehr ausreichte (und dass damit das Risiko stieg, dass ein alternder Präsident seinem Amt nicht mehr gewachsen sein würde), wurde diese Einschränkung 1951 durch Verfassungszusatz formalisiert. Und als schließlich unter dem Eindruck des Attentats auf John F. Kennedy und unter dem Eindruck des Kalten Kriegs die Frage diskutiert wurde, was geschehen sollte, wenn der Präsident noch am Leben, aber nicht mehr handlungsfähig war, wurde 1967 bestimmt, dass der Vizepräsident und eine Mehrheit des Kabinetts feststellen konnten, dass der Präsident nicht in der Lage war, seinen Aufgaben nachzukommen; um wirksam zu werden, musste diese Erklärung aber von zwei Dritteln des Kongresses bestätigt werden.
Im Jahr 2016 war das Ergebnis des Wahlverfahrens insofern überraschend, als sich am Ende des Prozesses kein erfahrener Politiker durchsetzte, sondern der Unternehmer Donald J. Trump. Dieser war nicht zuletzt aufgrund einer Fernsehserie zu Personalentscheidungen in Unternehmen (The Apprentice) berühmt geworden, hatte aber noch kein politisches Amt innegehabt. Seine teilweise exzentrische Amtsführung gab zu Diskussionen Anlass, ob er nicht ein erster Fall für eine Anwendung des 25. Verfassungszusatzes von 1967 sei. Die Frage, ob er durch diplomatischen Druck die Wahlchancen eines – damals nur möglichen – Gegenkandidaten zu beschädigen suchte, führte um die Jahreswende 2019/20 zu einem ersten Impeachment-Verfahren, das mit einem Freispruch endete.
Vollends ungewöhnlich waren die Ereignisse um die erneute Personalentscheidung über die amerikanische Präsidentschaft 2020. Die Wahl, die offiziell am 3. November abgeschlossen war3, hatte ein klares Ergebnis: Beide Kandidaten, Trump und sein Gegner Joseph R. Biden, hatten historische Rekorde gebrochen und deutlich mehr Stimmen erhalten als die rund 70 Millionen, die 2008 für Barak Obama abgegeben worden waren. Allerdings hatte Biden deutlich mehr: circa 81 Millionen, während auf Trump circa 74 Millionen entfielen.
Anstatt, wie bislang üblich, die Niederlage anzuerkennen, zur Einheit aufzurufen und die Amtsübergabe vorzubereiten, bemühten sich Trump und seine Unterstützer zunächst, das Ergebnis mit über 60 Klagen juristisch anzugreifen – wobei Sidney Powell, eine Anwältin, die einige dieser Klagen einreichte, später angab, kein »vernünftiger Mensch« habe davon ausgehen können, ihre Behauptungen, Wahlbetrug beweisen zu können, seien ernst gemeint gewesen.4 Parallel zu den erfolglosen juristischen Unternehmungen verbreiteten Trump und seine Unterstützer eine bald als »the big lie«, die große...
| Erscheint lt. Verlag | 17.11.2021 |
|---|---|
| Verlagsort | Darmstadt |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Allgemeines / Lexika |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Schlagworte | Andreas Fahrmeir • Assessment Center • Auslosen • Auswahlprozess • Birgit Emich • Bischof • Christoph Cornelißen • Dawid Wierzejski • Demokratische Wahlen • Donald Trump • Franz Peter Tebartz-van Elst • Führungspersonal • Geschichte • Hartmut Leppin • Historische Fallstudie • Historische Fallstudien • LOS • Losverfahren • Markus Braun • Personalentscheidung • Personalentwicklung • Präsident • Recruiting • Rekrutierung • Schlechte Personalentscheidung • Spitzenpersonal • Tristan Schmidt • Wahlen • Wählen • WERNER PLUMPE • Wirecard |
| ISBN-10 | 3-534-27381-8 / 3534273818 |
| ISBN-13 | 978-3-534-27381-2 / 9783534273812 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 13,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich