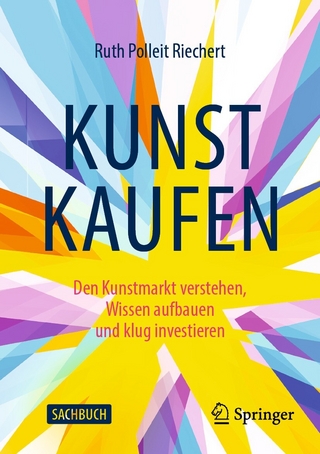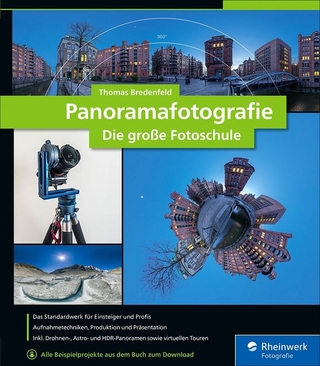30 × Fotogeschichte(n) (eBook)
176 Seiten
dpunkt (Verlag)
978-3-96910-938-0 (ISBN)
Ein Lesebuch für Fotograf*innen, mit und ohne Kamera, zum Schmökern, Mitreden und Verschenken
- vom »Afghan Girl« über Lincolns Kopf bis zu den Shirley Cards
- über berühmte Fotos, die Menschen und Geschichten dahinter
- die besten Episoden aus dem fotomenschen-Podcast nun als Buch
30 Geschichten um berühmte Fotografien und die Menschen dahinter, die unsere Zeit, unser Denken und die Art und Weise geprägt haben, wie wir heute Bilder sehen und machen.
30 Ausschnitte aus bald 200 Jahren Fotografie, mit viel Wissenswertem, oft Erstaunlichem und Inspirierendem und manchmal auch Trivialem, das sich beim Lesen zu einer so umfassenden wie unterhaltsamen Geschichte der Fotografie verdichtet.
30 Anlässe, mit dem Gelesenen selbst abzutauchen in die definierenden Momente der Fotografie unserer Zeit.
Dirk Primbs arbeitet für ein amerikanisches Softwareunternehmen und lebt mit seiner Familie in Frankfurt. Seine erste Kamera kaufte er 1996 im Alter von 20 Jahren. Das war der Beginn einer Leidenschaft, die ihn nicht mehr losließ und außerdem tief in die Geschichte des Mediums eintauchen ließ. Seit 2014 betreibt Dirk Primbs außerdem eine ganze Reihe unterschiedlicher Podcasts. So war es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch ein Podcast über Fotogeschichte(n), der Podcast 'Fotomenschen', dazugesellte und unter anderem dann auch die Inspiration für dieses Buch lieferte. Wenn er nicht podcastet oder fotografiert, ist Dirk Primbs am liebsten auf Reisen oder unterwegs auf einem Fernwanderweg. Erfahren Sie mehr über den Autor auf seiner privaten Webseite (https://dirkprimbs.de/) oder im Fotomenschen-Podcast auf https://fotomenschen.net/.
Dirk Primbs arbeitet für ein amerikanisches Softwareunternehmen und lebt mit seiner Familie in Frankfurt. Seine erste Kamera kaufte er 1996 im Alter von 20 Jahren. Das war der Beginn einer Leidenschaft, die ihn nicht mehr losließ und außerdem tief in die Geschichte des Mediums eintauchen ließ. Seit 2014 betreibt Dirk Primbs außerdem eine ganze Reihe unterschiedlicher Podcasts. So war es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch ein Podcast über Fotogeschichte(n), der Podcast "Fotomenschen", dazugesellte und unter anderem dann auch die Inspiration für dieses Buch lieferte. Wenn er nicht podcastet oder fotografiert, ist Dirk Primbs am liebsten auf Reisen oder unterwegs auf einem Fernwanderweg. Erfahren Sie mehr über den Autor auf seiner privaten Webseite (https://dirkprimbs.de/) oder im Fotomenschen-Podcast auf https://fotomenschen.net/.
FOTOGESCHICHTE(N) 1
Wie alles anfing
Die Geschichte der Fotografie wird gerne folgendermaßen erzählt: Da gab es zwei Franzosen, nämlich Joseph Nicéphore Niépce und Louis Daguerre. Die beiden schlossen sich zusammen, um gemeinsam das erste fotografische Verfahren zu entwickeln. Daguerre stellte ihr Ergebnis dann am 19. August 1839 der französischen Akademie der Wissenschaften vor, woraufhin Frankreich diese bahnbrechende Entdeckung der Welt zum Geschenk machte. Der Rest ist … nun ja … Geschichte.
Weil dieses Buch eine Sammlung von Geschichten über Fotografie ist, darf diese erste Begebenheit nicht unerzählt bleiben. Sie ist auch beinahe so passiert, nur lässt diese allgemein bekannte Version ein paar entscheidende Aspekte aus – und um die soll es nun gehen.
Alles fängt mit einem Erfinder und Bastler an, dem ehemaligen Militäroffizier Joseph Nicéphore Niépce. Er hatte schon einige Jahre nach einer Methode gesucht, das Nachdunkeln von mit Licht erzeugten Bildern aufzuhalten, als er Louis Daguerre kennenlernte.
Schon lange waren in der damaligen Wissenschaft diverse lichtempfindliche Substanzen bekannt, allerdings kein Weg, den Prozess des Nachdunkelns unter Lichteinfluss aufzuhalten. Und dazu der zeitliche Aufwand: Die Belichtungszeiten lagen bei vielen Stunden! Niépce jedoch war davon überzeugt, dass es einen Weg geben musste, den Prozess zu beschleunigen und das Ergebnis zu fixieren, damit es dem Tageslicht ohne nachzudunkeln standhielt. Als analytisch veranlagter Mensch experimentierte er ausdauernd und systematisch.
1826 gelang ihm dann, was als die erste Fotografie der Geschichte gilt: Er zeichnete über acht Stunden hinweg den Blick aus seinem Arbeitszimmerfenster auf eine in einer Camera obscura befestigten Teerplatte auf und fixierte das Bild mithilfe von Lavendel. Das Prinzip der Camera obscura war seit der Antike bekannt: In einem lichtdichten Kasten fällt durch ein kleines Loch in der Mitte der Frontwand ein auf dem Kopf stehendes Abbild der Szene vor dem Kasten auf das Innere der Rückwand. Findige Bastler hatten über die Jahrhunderte dafür diverse Apparaturen konstruiert, etwa um mithilfe einer halbdurchlässigen Rückwand Skizzen zu fertigen. Aber wäre es nicht großartig, wenn man diese Bilder ganz einfach direkt festhalten könnte?
Niépce war sich ganz sicher, kurz vor der Verwirklichung dieses Traums zu stehen. Er hatte entdeckt, dass seine Teermischung nicht überall gleichmäßig härtete, wenn sie dem Licht ausgesetzt wurde – Stellen mit stärkerem Lichteinfall härteten schneller. Der Lavendel wusch die weicheren Teile heraus und mit dem Ergebnis ließ sich dann ein Druck anfertigen. Das Ganze war nicht gerade das, was wir heute unter einem Foto verstehen, aber es bedeutete einen wichtigen Schritt, denn Niépce war es damit als Erstem gelungen, ein Bild zu fixieren, also dauerhaft zu machen.
Blick aus dem Arbeitszimmer in Le Gras (Retuschierte Reproduktion aus dem Jahr 1952) (Quelle: Wikipedia)
Sonderlich praktikabel war die Methode zugegebenermaßen nicht. Es mangelte dem Ergebnis an Schärfe und Kontrast. Ja, nur wenn man wusste, was man vor sich hatte, ließ sich die Szene überhaupt identifizieren. Außerdem waren acht Stunden Belichtungszeit natürlich für die meisten Anwendungsfälle viel zu lang. Aber ein Anfang war gemacht!
Irgendwann im Laufe des Jahres 1829 lernte Niépce den Maler und Unternehmer Louis Daguerre kennen, der seinerseits ebenfalls nach einer Methode suchte, die Bilder einer Camera obscura einzufangen und zu fixieren. Er hatte von Niépces Arbeit erfahren und sich mit ihm in der Hoffnung auf Austausch in Verbindung gesetzt. Daguerre war nicht so methodisch und wissenschaftlich veranlagt wie Niépce. Er war eigentlich Maler und Unternehmer. Er betrieb Dioramen, also große Räume, die innen derart bemalt waren, dass Besucher den Eindruck haben konnten, selbst Teil der gezeigten Szenerie zu sein. Wäre es nicht fantastisch, wenn man diese Bilder nicht malen müsste, sondern gewissermaßen einfangen könnte? Er richtete sein Augenmerk als Erstes auf die Belichtungszeiten. Sie mussten kürzer werden! Vielleicht wenn man ein geschliffenes Glas benutzte, um das einfallende Licht zu bündeln?
Nach und nach tastete er sich an eine praktikable Methode heran und erarbeite schließlich einen Prozess, den er nach sich selbst »Daguerreotypie« nannte. Hierbei belichtete er ein poliertes Silberplättchen in einer Kamera mit Objektiv und entwickelte es anschließend mithilfe von Quecksilberdämpfen. Als er außerdem feststellte, dass die Silberplatten das Bild bereits trugen, bevor es wirklich sichtbar wurde, konnte er die Belichtungszeit noch einmal deutlich verkürzen und aus Stunden wurden Minuten.
Die ersten Menschen, die seine Bilder zu Gesicht bekamen, waren wie vom Donner gerührt. Es mutete geradezu magisch an, ein direktes Abbild der Wirklichkeit, noch dazu in bisher nie gesehener Detailtreue, zu betrachten. Mit geeigneten Scannern lassen sich noch heute aus fachkundig erzeugten Daguerreotypien mehrere Hundert Megapixel an Bilddaten auslesen, und das, obwohl die Plättchen nur wenige Zentimeter breit und hoch waren.
Schnell wurde ein Termin gefunden, um diese bahnbrechende Erfindung der Französischen Akademie der Wissenschaften vorzustellen. Dort zeigte man sich begeistert! Es war sofort klar, dass die Daguerreotypie eine neue Ära der Wissenschaft und der Künste einläuten würde.
Das erste richtige, noch erhaltene Foto aus dieser Zeit zeigt eine Szene, die Daguerre aus dem Fenster seines Arbeitszimmers in Paris heraus fotografiert hatte – einen Straßenzug, der eigentlich belebt gewesen sein muss. Weil die Belichtungszeit aber immer noch über zehn Minuten lag, sieht man keine Fuhrwerke oder Passanten – mit einer Ausnahme. Relativ weit vorne steht ein Mann bei einem Schuhputzer. Er muss wohl einen Großteil der zehn Minuten dort ausgeharrt haben. Damit war diese Aufnahme nicht nur eine der ersten richtigen Fotografien überhaupt, sondern ist auch noch die erste Fotografie eines bzw. zweier Menschen!
Die Wissenschaftler, denen Daguerre sein Verfahren zuerst zeigte, waren nicht nur begeistert, sondern wurden über Nacht selbst zu enthusiastischen Daguerreotypisten. Von einigen wird berichtet, dass sie noch am gleichen Tag begonnen hätten, ähnliche Aufnahmen zu fertigen. Daguerre hatte einen Trend ausgelöst.
Außerdem war klar: Solch eine Entdeckung konnte man nicht für sich behalten! Frankreich würde sie der Welt zum Geschenk machen.
Wirklich der ganzen Welt? Na ja, beinahe. In England hatte Daguerre noch vor seiner Vorstellung in der Akademie der Wissenschaften am 19. August 1839 ein Patent eingereicht, wohl in der Absicht, später durch Lizenzgebühren Einnahmen erzielen zu können.
Boulevard du Temple in Paris, Daguerreotypie von Louis Daguerre, 1839 (Quelle: Wikipedia)
In Frankreich selbst war er nach der Veröffentlichung ein gemachter Mann. Aus Dankbarkeit gewährte Frankreich Daguerre und den Nachkommen des inzwischen verstorbenen Niépce eine lebenslange, großzügig bemessene Rente. Vielleicht hoffte Daguerre, England würde es Frankreich gleichtun und das Verfahren ebenso gegen eine Rente pauschal lizenzieren. Was immer seine Motivation der singulären Patenteinreichung gewesen sein mag: Ergebnis war, dass sein Verfahren überall auf der Welt umsonst angewendet werden durfte – außer eben in Großbritannien.
Aber die Briten brauchten sein Verfahren gar nicht, denn sie hatten ihre eigenen Väter und Mütter der Fotografie. In der Tat hatte dort beinahe zur selben Zeit ein Mann namens William Henry Fox Talbot mit sogenannten Fotogrammen experimentiert. Seine Bilder entstanden auf Papier und nach und nach gelangte er an einen ähnlichen Punkt wie Daguerre und Niépce. Heute lässt sich nicht mehr zweifelsfrei sagen, ob er nicht vielleicht sogar vor den beiden Franzosen Aufnahmen erzeugte, die wir heute als Fotografien bezeichnen würden. Er wusste nichts von den französischen Bemühungen, war aber etwa um dieselbe Zeit, zu der die Daguerreotypie bekannt wurde, darum bemüht, sich seinerseits in Position zu bringen. Denn sein Verfahren hatte gegenüber dem von Daguerre einen entscheidenden Vorteil: Man konnte die Bilder vervielfältigen!
Trotzdem war es zunächst die Daguerreotypie, die sich mit rasender Geschwindigkeit durchsetzte. Über mehrere Jahrzehnte hinweg stellte sie das dominante kommerzielle Verfahren der Fotografie auf der ganzen Welt dar – außer in England. Dort wiederum setzte man auf das Konkurrenzverfahren. Talbot hatte von seiner Regierung allerdings keine großzügige Rente erhalten und versuchte selbst, Geld aus seiner Entwicklung zu machen, indem er Studiolizenzen vergab. Als dann 30 Jahre später das erste wirklich lizenzfrei verfügbare Verfahren herauskam, lief es beiden Methoden den Rang ab: die sogenannte Kollodium-Nassplatte, auf die ich später im Buch noch ein paar Mal...
| Erscheint lt. Verlag | 7.12.2022 |
|---|---|
| Verlagsort | Heidelberg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Freizeit / Hobby ► Fotografieren / Filmen |
| Schlagworte | Anekdoten • Foto-Geschichte • Fotografie • Fotomenschen • Geschichten • Podcast |
| ISBN-10 | 3-96910-938-8 / 3969109388 |
| ISBN-13 | 978-3-96910-938-0 / 9783969109380 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich