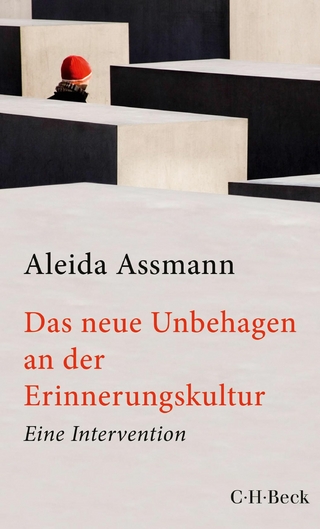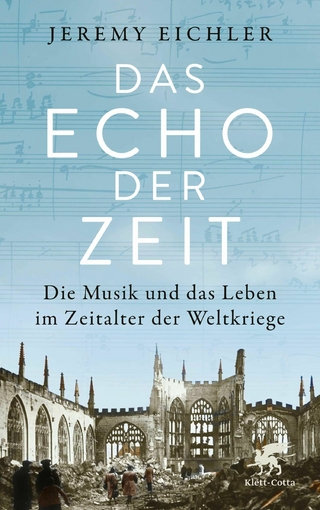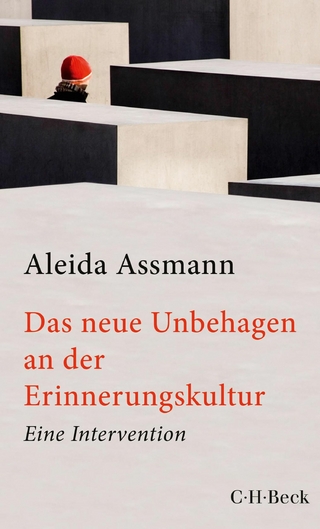Schuld, die nicht vergeht (eBook)
400 Seiten
Heyne (Verlag)
978-3-641-19603-5 (ISBN)
Ohne sie wäre das Vernichtungssystem nicht möglich gewesen: die KZ-Aufseher, Wachleute, Buchhalter, Helfer - die kleinen Rädchen im großen Mordgetriebe.
Ohne ihn wären sie nie zur Verantwortung gezogen worden: Kurt Schrimm, Staatsanwalt und langjähriger Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen. Sein halbes Leben hat er der Aufgabe gewidmet, NS-Verbrecher wie Josef Schwammberger, Alfons Götzfrid oder John Demjanjuk vor Gericht zu bringen.
Jetzt berichtet Schrimm, wie er den Tätern auf die Spur kam, und erzählt von den bewegenden Begegnungen mit KZ-Überlebenden, die er als Zeugen befragt hat. Und es wird unabweislich klar, warum es auch über 70 Jahre nach dem Ende des NS-Staats notwendig ist, jeden einzelnen dieser Täter zur Rechenschaft zu ziehen.
Kurt Schrimm, geboren 1949 in Stuttgart, studierte Rechtswissenschaften und war seit 1979 im Justizdienst des Landes tätig, zunächst als Staatsanwalt in Stuttgart. Ab 1982 war er im Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart für Verfahren wegen Mordes im Zusammenhang mit nationalsozialistischen Gewaltverbrechen zuständig. Ende September 2000 wurde ihm die Leitung der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg übertragen. Kurt Schrimm, inzwischen im Ruhestand, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er wurde mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.
»Wir fliegen ja im Herbst zusammen nach Israel und in die USA, um dort Zeugen zu vernehmen.«
Mit diesen Worten begrüßte mich der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Stuttgart Dr. Neumaier im Sommer 1982 im Flur des Gerichtsgebäudes. Ich war damals Richter an einer Jugendkammer und beabsichtigte, im September zur Staatsanwaltschaft Stuttgart zurückzukehren, wo ich 1979 meine juristische Laufbahn bei der baden-württembergischen Justiz begonnen hatte. Mein Ziel war es, Staatsanwalt auf Lebenszeit zu werden. Unabdingbare Voraussetzung hierfür war es, vor der Ernennung für mindestens ein Jahr als Richter tätig gewesen zu sein.
Von dieser Ankündigung völlig überrascht, erklärte ich Dr. Neumaier, dies müsse ein Irrtum sein, ich wisse nichts von einer solchen Reise, geschweige denn von der angedeuteten Verwendung meiner Person nach der Rückkehr zur Staatsanwaltschaft. Mit einem Lächeln erwiderte der Richter, er selbst habe sich beim Leitenden Oberstaatsanwalt erkundigt und zur Antwort erhalten, ich sei als Nachfolger für den ausscheidenden Staatsanwalt mit der Zuständigkeit für nationalsozialistische Gewaltverbrechen vorgesehen. Dieser habe am Ende seiner Amtszeit noch Anklage gegen einen ehemaligen Aufseher des Konzentrationslagers Auschwitz wegen mehrfachen Mordes erhoben. Der Prozess stehe zur Verhandlung an und es müssten zunächst in den genannten Ländern noch Zeugen vernommen werden, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage seien, vor dem Gericht in Stuttgart zu erscheinen.
So erfuhr ich aus heiterem Himmel von der Entscheidung meiner Vorgesetzten, die meinen beruflichen Werdegang wesentlich, mein Privatleben nicht unerheblich beeinflussen sollte. Ich war zwar von jeher an der Geschichte des 20. Jahrhunderts interessiert, hätte es mir jedoch niemals träumen lassen, dass ich einmal von Berufs wegen an der Erforschung und Aufklärung eines Teilabschnitts dieser Geschichte mitwirken würde.
Noch kurz vor dem Abitur hatte ich noch keine richtige Vorstellung davon gehabt, in welche Richtung sich mein weiterer Werdegang entwickeln sollte. Weniger aus Überzeugung als mangels Alternative folgte ich dem Vorschlag meines Vaters, beim Finanzamt eine dreijährige Ausbildung zum Steuerinspekteur zu absolvieren, um danach vielleicht ein Studium der Volkswirtschaft aufzunehmen, möglicherweise mit dem Ziel, mich später als Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer niederzulassen. Von Anfang an machte mir das angeblich so trockene Steuerrecht großen Spaß, und ich habe meine Entscheidung nicht einen Tag bereut. Allerdings verlor ich nie das Ziel eines an die Ausbildung anschließenden Studiums aus den Augen. Die Freude am Rechtskundeunterricht, der Teil der Ausbildung war, bewog mich jedoch, nicht wie geplant Volkswirtschaft, sondern stattdessen Rechtswissenschaften zu studieren. Mein neues Ziel war nunmehr, nach Abschluss des Studiums in den höheren Finanzdienst einzutreten. Noch während der Studienzeit jedoch entwickelte sich bei mir mehr und mehr eine Neigung zum Strafrecht. Nachdem ich dann als Rechtsreferendar eine viermonatige praktische Ausbildung bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart durchlaufen hatte, war mir klar: Der endgültige Berufswunsch heißt Staatsanwalt. So überraschte ich dann meine Familie mit der Ankündigung, mich nicht für den höheren Finanzdienst, sondern für den höheren Justizdienst bewerben zu wollen.
Meine Freude war daher groß, als ich bei der Einstellung erfuhr, dass ich zunächst der Staatsanwaltschaft Stuttgart und dort der Abteilung 1 zugewiesen werden würde. Die Tätigkeit in dieser Abteilung war allgemein begehrt. Sie galt als spannend, weil sie für Mord, Totschlag und andere Kapitalverbrechen zuständig war. Dort verbrachte ich zwei äußerst interessante Jahre, weshalb ich der Abordnung zum Landgericht Stuttgart für ein Jahr nur ungern gefolgt war.
Die überraschende Neuigkeit von meiner zukünftigen Zuständigkeit für NS-Gewaltverbrechen vernahm ich daher mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Einerseits erfüllte sich mein Wunsch nach Rückkehr zur Staatsanwaltschaft Stuttgart, andererseits konnte ich aufgrund der neuen Zuständigkeit meine frühere Tätigkeit nur eingeschränkt ausüben. Als ich meinen Abteilungsleiter hierauf ansprach, gab er mir eine Antwort, in der sich ein grundlegender Irrtum widerspiegelt, ein Irrtum, der sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Verfolgung von nationalsozialistischen Verbrechen zieht: »Machen Sie diese Arbeit getrost, in drei, vier Jahren redet hierüber sowieso niemand mehr!«
Mit Hochdruck begann ich, mich in die Anklage und damit auch in die für mich bis dahin völlig fremde Materie einzuarbeiten. Diese Art von Verbrechen hatte mit dem, was wir an der Universität gelernt hatten, und mit dem, womit ich bisher als Richter oder Staatsanwalt befasst gewesen war, nichts gemeinsam. Ich wusste aus dem dürftigen Schulunterricht und aus der Presseberichterstattung über frühere Prozesse lediglich, dass Auschwitz ein Massenvernichtungslager gewesen war. Nähere Einzelheiten zur Errichtung der Konzentrationslager im Allgemeinen und des Lagers Auschwitz im Besonderen, zur Organisation, zum Lagerbetrieb und vor allem zu den dort begangenen Massentötungen musste ich mir in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit aneignen. Einerseits erfüllte mich die Tatsache, dass man mir als einem in der Materie völlig unerfahrenen Staatsanwalt diese Aufgabe anvertraute, mit Stolz. Andererseits erschreckte mich diese Aufgabe aber auch, da ich nicht wusste, ob ich in der Lage sein würde, mir das erforderliche Wissen zu erarbeiten.
Dies umso mehr, als der Angeklagte von einem Rechtsanwalt verteidigt wurde, der über große Erfahrung verfügte und als einer der besten in Stuttgart und darüber hinaus galt.
Zu meinem Glück beschäftigte sich die von meinem Vorgänger verfasste Anklageschrift, wie in NS-Verfahren üblich, ausführlich nicht nur mit dem Tatvorwurf als solchem, sondern auch mit der Geschichte der Entrechtung, Verfolgung und Ermordung der Juden während des Naziregimes, mit der Entstehungsgeschichte der Konzentrationslager und der Verantwortlichkeit für das dortige Geschehen. Im Verlauf meiner weiteren Prozessvorbereitung hatte ich auch erstmals Kontakte mit der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, kurz: Zentrale Stelle, mit Sitz in Ludwigsburg. Von meinem Abteilungsleiter erfuhr ich, dass diese Stelle 1958 von den Justizministern der damals elf Bundesländer gegründet worden war. Sie hatte – und hat – die Aufgabe, in all denen Fällen, in denen der Verdacht einer nationalsozialistisch motivierten Straftat bestand, selbstständig zu ermitteln und das Verfahren dann an eine Staatsanwaltschaft abzugeben. Nur diese konnte dann entscheiden, ob Anklage zu erheben oder das Verfahren einzustellen war.
Gleich nach meinem erneuten Dienstantritt bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart suchte ich die Kollegen (Kolleginnen gab es noch nicht) in Ludwigsburg auf, um eine erste Anleitung für die Bearbeitung der einschlägigen Fälle zu bekommen. Als ich das von einer hohen Mauer umgebene Gebäude betrat – es handelte sich um ein ehemaliges Frauengefängnis –, wäre mir niemals der Gedanke gekommen, dass ich diese Dienststelle einmal fünfzehn Jahre lang leiten würde.
Wichtigster Bestandteil der Anklage war natürlich der Tatvorwurf. Bei dem Angeklagten handelte es sich um den damals 66 Jahre alten Karl Wilhelm Pöllmann, der zuletzt als Hausmeister in einer Möbelfabrik tätig gewesen war. Am Tag seiner Versetzung in den Ruhestand wurde er festgenommen und befand sich seither in Untersuchungshaft.
Der Vorwurf lautete auf Mord in drei Fällen. Laut Anklage war Pöllmann von Frühjahr 1943 bis zum 18. Januar 1945 ein sogenannter Kommandoführer in Auschwitz. Auschwitz war zwar das größte Vernichtungslager des Naziregimes, daneben jedoch auch ein riesiges Arbeitslager für diejenigen Häftlinge, die bei der Ankunft noch arbeitsfähig waren. Unter anderem gehörten zum Lager ausgedehnte landwirtschaftliche Versuchsflächen, auf denen Pflanzen gezüchtet wurden, die dem raueren Klima in den eroberten Ostgebieten angepasst sein sollten. Bewirtschaftet wurden die Flächen von Häftlingen, die täglich in Gruppen von jeweils 50–100 Personen am Lagereingang abgeholt, zum Arbeitsplatz geleitet, dort bewacht und schließlich am Abend zurückgebracht wurden, sogenannte Arbeitskommandos. Die Verantwortlichen wurden Kommandoführer genannt, die Bewachung bestand aus drei bis fünf bewaffneten Wachsoldaten. Weder der Kommandoführer noch die Angehörigen der Begleitmannschaft durften das Lager selbst betreten. An einem nicht mehr genau benannten Tag im Februar/März 1944 sollte der Beschuldigte als Führer des »Arbeitskommandos 7«, dem zu diesem Zeitpunkt 30–40 weibliche jüdische Häftlinge angehörten, auf dem Rückweg von Straßenbauarbeiten auf dem Gebiet des Konzentrationslagers Auschwitz und dem ehemaligen Wirtschaftshof Budy eine etwa 20-jährige Jüdin mit seiner Pistole erschossen haben, nur weil sie sich aus der Reihe gestellt und sich gebückt hatte, um sich die Schuhe zu richten. Danach sollte er dem jüdischen Häftling Chaim Grünberg befohlen haben, »den Haufen« aus dem Weg zu räumen. Weiter warf die Anklage Pöllmann vor, an einem Spätnachmittag im Sommer 1944 den etwa 19-jährigen polnisch-jüdischen Häftling Zwi Hirsch und einen weiteren etwa 24-jährigen Mann auf einem bei Auschwitz gelegenen Feld willkürlich und eigenmächtig aus Freude am Töten mit seiner Pistole durch...
| Erscheint lt. Verlag | 2.10.2017 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► 20. Jahrhundert bis 1945 |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Auschwitz • Deutsche Nachkriegsgeschichte • eBooks • Geschichte • Holocaust • John Demjanjuk • Nazi-Jäger • NS-Verbrecher • Oskar Gröning • Zentrale Stelle Ludwigsburg |
| ISBN-10 | 3-641-19603-5 / 3641196035 |
| ISBN-13 | 978-3-641-19603-5 / 9783641196035 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich