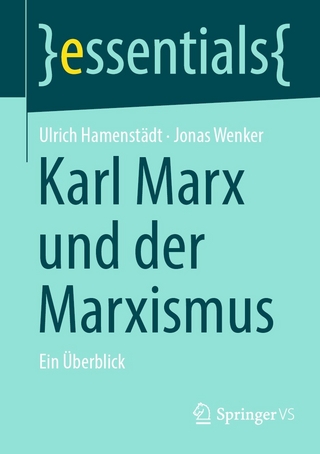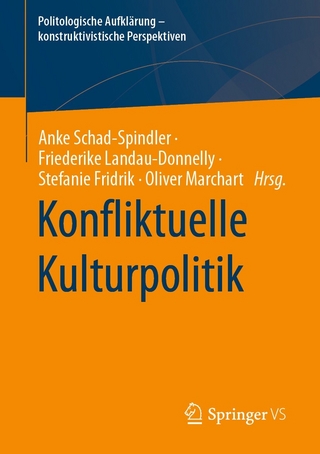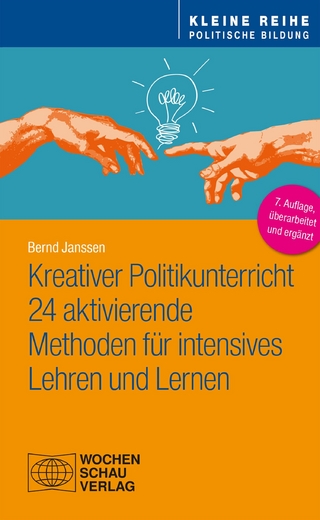Demokratie und Demokratieschutz (eBook)
315 Seiten
Campus Verlag
978-3-593-43846-7 (ISBN)
Sabrina Engelmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Frankfurt University of Applied Sciences.
Sabrina Engelmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Frankfurt University of Applied Sciences.
Inhalt
1.Warum Demokratieschutz?9
1.1.Das Dilemma der Demokratie9
1.2.Demokratieschutz15
1.2.1.Definition17
1.2.2.Demokratieschutz als Element nicht-idealer Theoriebildung24
1.3.Demokratie34
1.3.1.Volkssouveränität35
1.3.2.Legitimität38
1.3.3.Gleichheit und Freiheit 40
1.4.Anstelle einer Methode42
1.5.Rechtfertigungen des Demokratieschutzes44
1.6.Ausblick46
2.Das Überleben der Demokratie49
2.1.Vordenker des nationalstaatlich-reflexiven
Demokratieschutzes53
2.1.1.Karl Loewenstein und der Faschismus53
2.1.2.Karl Mannheim und die Massengesellschaft58
2.1.3.Carl Schmitt und die Neutralität der Weimarer
Reichsverfassung60
2.1.4.Schutz der Demokratie, Schutz der Verfassung66
2.2. Rechtfertigungen der militanten Demokratie67
2.2.1.Überlegene Demokratie, abzulehende Autokratie68
2.2.2.Aus der Vergangenheit lernen, sich für die Zukunft wappnen80
2.2.3.Der Schutz der Werte der Demokratie88
2.2.4.Rechtfertigungen zum Schutz der unbestimmten Demokratie103
2.3.Kritik an der militanten Demokratie105
2.3.1.Missbrauchsgefahr105
2.3.2.Symbolische Politik114
2.3.3.Selbstwidersprüche und die Frage der kollektiven Selbstbestimmung121
2.4.Fazit130
3.Kollektiver Demokratieschutz135
3.1.Formen des kollektiven Demokratieschutzes140
3.1.1.Demokratieschutz in der Organisation Amerikanischer
Staaten155
3.1.2.Demokratieschutz durch Einschränkung des Kredit- und Rohstoffprivilegs183
3.2.Kritik am kollektiven Demokratieschutz200
3.2.1.Gefahr des Missbrauchs aufgrund der Vagheit der Demokratieschutznormen200
3.2.2.Das Zurücktreten der demokratischen Selbstbestimmung
hinter die Schutzziele204
3.3.Fazit206
4.Demokratieschutz als Menschenrechtsschutz211
4.1.Pro-demokratische Interventionen214
4.1.1.Grenada 1983216
4.1.2.Panama 1989218
4.1.3.Haiti 1991 - 1994220
4.1.4.Sierra Leone 1997 - 1998221
4.1.5.Fazit zu den realweltlichen Beispielen pro-demokratischer Interventionen223
4.1.6. Fragen der Legalität und die Responsibility to Protect226
4.2.Rechtfertigungen pro-demokratischer Interventionen235
4.2.1.Menschenrecht auf Volksherrschaft (Michael W. Reisman)236
4.2.2.Recht auf humanitäre Hilfe (Lois E. Fielding)240
4.2.3.Prinzip der demokratischen Herrschaft (Fernando Tesón)245
4.2.4.Pro-demokratische Interventionen als humanitäre
Interventionen249
4.3.Kritik am externen Demokratieschutz250
4.3.1.Fragliche Effektivität250
4.3.2.Erkenntnisprobleme252
4.3.3.Missbrauchsgefahr253
4.3.4.Problematische Rechtfertigungsbasis256
4.4.Fazit283
5.Keine Garantie für den Schutz der Demokratie287
Literatur295
Danksagung315
1. Warum Demokratieschutz? 'The problem [...] attaches to democratic politics as such partly because the people are never so fully what they need to be (virtuous, democratic, complete) that a democracy can deny credibly that it resorts to violence, imposition, or coercion to maintain itself.' 1.1.Das Dilemma der Demokratie Demokratische Staaten sehen sich regelmäßig mit einem Dilemma kon-frontiert, wenn es um die Frage nach der Erhaltung ihrer demokratischen Verfasstheit geht. Ihnen stehen in dieser Hinsicht zwei gleichermaßen problematische Entscheidungsmöglichkeiten zur Verfügung, die beide zu unerwünschten Resultaten führen können. Sie können sich einerseits da-für entscheiden, demokratische Partizipationsmöglichkeiten für alle zu öffnen, und so riskieren, dass auch anti-demokratisch gesinnte Personen an die Macht kommen und womöglich die Demokratie abschaffen. Andererseits können demokratische Staaten auch die Partizipationsmöglichkeiten einschränken und so gegen die eigenen Grundprinzipien der gleichen Partizipation verstoßen. Das Dilemma ergibt sich also aus der Erkenntnis, dass es grundsätzlich möglich ist, die Demokratie mit demokratischen Mitteln abzuschaffen. Der demokratische Staat steht vor der dilemmatischen Wahl, diese Gefahr in Kauf zu nehmen oder aber Ausnahmen von den demokratischen Grundprinzipien zu formulieren, um sich zu schützen. Um zu verhindern, dass die Demokratie mit demokratischen Mitteln abgeschafft wird, kann sich der demokratische Staat entscheiden, sich stattdessen mit nicht-demokratischen Mitteln zu schützen. In diesem Zusammenhang sprechen viele Autor_innen nicht nur von einem Dilemma, sondern von einer paradoxen Situation. Der Begriff der Paradoxien kann prinzipiell auf eine ganze Reihe von (scheinbaren und tatsächlichen) Widersprüchen angewandt werden. Hier wird unter Parado-xie der Umstand verstanden, dass aus einer Idee oder These logisch ein-wandfreie Schlussfolgerungen gezogen werden können, die jedoch zum Gegenteil der ursprünglichen These führen. Ich gehe davon aus, dass beide Entscheidungsmöglichkeiten des demokratischen Dilemmas para-doxe Züge tragen. Die These, die der ersten Entscheidungsmöglichkeit zugrunde liegt, kann folgendermaßen formuliert werden: Um Demokratie zu ermöglichen, müssen allen die gleichen Partizipationschancen offen stehen. Wird diese Idee vollständig umgesetzt, kann es jedoch sein, dass auch solche Personen partizipieren und an die Macht kommen, die nach ihrer Wahl beschließen, die Demokratie abzuschaffen. Allen die demokratische Partizipation zu ermöglichen, kann also zur Abschaffung der Partizipationsmöglichkeiten aller führen. Die zweite Wahlmöglichkeit lässt sich ebenfalls als paradoxe These darstellen: Um die Demokratie zu schützen, werden von staatlicher Seite die Partizipationsmöglichkeiten bestimmter Individuen oder ganzer Gruppen von Individuen eingeschränkt. Das führt wiederum dazu, dass nicht alle gleichermaßen partizipieren können, was der (teilweisen) Außerkraftsetzung von Grundprinzipien der Demokratie gleichkommt. Bei den Bemühungen um den Schutz der Demokratie kann die Demokratie also auch durch ihre Beschützer_innen Schaden nehmen. Die beiden Wahlmöglichkeiten des Dilemmas führen somit nicht nur zu unerwünschten Resultaten, sondern sind darüber hinaus jeweils para-dox. Das demokratische Dilemma kann mithin als paradoxales Dilemma bezeichnet werden. Die dilemmatische Situation ist - entgegen der vorherigen Formulie-rung - nicht auf die nationalstaatliche Ebene beschränkt. Sie bleibt auch dann bestehen, wenn die zum Schutz der Demokratie eingreifenden Ak-teure nicht zum betroffenen Staat selbst gehören, sondern von außerhalb eingreifen. Auch hier stellen sich den handelnden Akteuren zwei gleichsam problematische Entscheidungsmöglichkeiten dar: Entweder sie lassen die Abschaffung der Demokratie in einem anderen Staat zu, ohne einzugreifen, oder aber sie greifen ein und nehmen dabei die Gefahr in Kauf, die staatliche Souveränität des anderen Staates zu missachten und womöglich gegen den Willen des jeweiligen Volkes zu handeln. In der Literatur finden sich sehr unterschiedliche Interpretationen die-ses Dilemmas, insbesondere was die Einschätzung der unerwünschten Resultate betrifft, die sich aus der Wahl einer der beiden Entscheidungs-möglichkeiten ergeben. Fox und Nolte beschreiben die erste Möglichkeit, also die Hinnahme der Tatsache, dass die Demokratie womöglich demo-kratisch abgeschafft wird, als ein System freier Wahl, das von den Bür-ger_innen auch dazu verwendet werden kann, um der Wahlfreiheit selbst ein Ende zu setzen. Klamt konstatiert, dass die Gewährung quasi unbe-grenzter Demokratie zu deren Untergang führen kann, indem die demo-kratische Freiheit auf demokratischem Wege gänzlich abgeschafft wird. Popper hebt besonders das paradoxale Element der ersten Entschei-dungsmöglichkeit hervor: 'Einerseits verlangt das von [den Demokraten] akzeptierte Prinzip, sich jeder Herrschaft zu widersetzen außer der Herrschaft der Majorität, also auch der Herr-schaft des neuen Tyrannen; andererseits fordert dasselbe Prinzip von ihnen die Anerkennung jeder Entscheidung der Majorität und damit auch die Anerkennung der Herrschaft des neuen Tyrannen.' Die Anerkennung ein und desselben Prinzips - in diesem Fall des Mehr-heitsprinzips - kann nach Popper also sowohl zur demokratischen Herr-schaft als auch zu deren Gegenteil, zur Tyrannis, führen. Aber auch die zweite Entscheidungsmöglichkeit trägt paradoxe Züge. Jesse beschreibt sie als die Gefahr eines Selbstmordes der Demokratie: 'Es handelt sich also um ein demokratisches Dilemma, um eine Gratwanderung: Der demokratische Verfassungsstaat muß vermeiden, aus Angst vor Mord Selbst-mord zu begehen.' Der demokratische Staat kann bei dem Versuch, sich selbst zu verteidi-gen, also so weit gehen, dass es nicht mehr die anti-demokratischen Ak-teure sind, welche die Demokratie gefährden oder abschaffen, sondern stattdessen die Maßnahmen, die zum Schutz der Demokratie beschlossen wurden. So sieht auch Müller die Problematik dieser Entscheidungsmög-lichkeit des Dilemmas in der Gefahr, dass die Demokratie sich selbst zer-störe, beim Versuch, sich zu verteidigen: '[...] what is often referred to as the ?democratic paradox? or the ?democratic dilemma?, namely the possibility of a democracy destroying itself in the process of defending itself.' Nicht alle Autor_innen gehen jedoch so weit, die unerwünschten Re-sultate der zweiten Entscheidungsmöglichkeit in der Abschaffung der De-mokratie zu sehen. Stattdessen nehmen einige an, dass diese Entscheidung lediglich zu einem Selbstwiderspruch bezüglich der zentralen Prinzipien der Demokratie führt. So erkennt Gusy das Dilemma des demokratischen Staates darin, dass dieser entweder die eigene Existenz aufs Spiel setzt oder den Grundsätzen, auf denen er selbst beruht, zuwider handelt. Wassermann bezeichnet das unerwünschte Resultat als die Tatsache, dass die Demokratie ihren Systemgegner_innen wehrlos preisgegeben sein kann - was noch nicht zwangsläufig die Abschaffung der Demokratie bedeutet. Je nach Interpretation besteht somit bei der Wahl der ersten Entschei-dungsmöglichkeit die Gefahr der Abschaffung der Demokratie durch de-mokratische Mittel oder zumindest deren Wehrlosigkeit und bei der Wahl der zweiten Entscheidungsmöglichkeit die Gefahr der Abschaffung der Demokratie durch die Maßnahmen des Demokratieschutzes oder aber die Gefahr eines Selbstwiderspruchs der Demokratie. Fox und Nolte bringen dieses (von ihnen als Paradox bezeichnete) Di-lemma zudem mit der Frage der Toleranz in Verbindung: 'This is perhaps the central paradox of democratic regimes: to suppress anti-democratic movements infringes notions of tolerance at the heart of the democratic ideal, but to allow them endangers the survival of the very system institutionalizing principles of tolerance.' Überhaupt wird in diesem Zusammenhang oft auf die Frage der Toleranz rekurriert. So kann die Entscheidungssituation des demokratischen Dilemmas auch als Frage der Toleranz verstanden werden; wie tolerant etwa die Demokratie mit den sogenannten Feinden der Demokratie umgehen dürfe. Diese Rahmung des Demokratieschutzes kann jedoch problematisch sein, da dann Toleranz in der Regel im Sinne der Erlaubniskonzeption gedeutet wird. Die Erlaubniskonzeption ist eine Vorstellung von Toleranz, bei der eine Autorität oder Mehrheit einer Minderheit erlaubt, gemäß bestimmten Vorstellungen zu leben, solange diese nicht die Vormachtstellung der Autorität oder Mehrheit infrage stellt. Interpretiert man die Rechtfertigungen des Demokratieschutzes im Lichte der Toleranzthematik, so ist es sehr wahrscheinlich, dass letztlich alles auf die Frage danach hinausläuft, was die Mehrheit oder der demokratische Staat seinen (potenziell anti-demokratischen) Bürger_innen erlauben darf. Eine solche Rahmung des Demokratieschutzes erscheint jedoch - auch angesichts der verschiedenen Ebenen des Demokratieschutzes - verkürzt und wenig hilfreich, da sie die bestehende Argumentation in der Debatte um Demokratieschutz lediglich in die Toleranzbegrifflichkeit übersetzt. Die grundlegende Frage ist also diejenige danach, wie zu rechtfertigen ist, dass Demokratien versuchen, sich selbst oder fremde Demokratien mit anti-demokratischen Mitteln gegen Bedrohungen zu verteidigen. Welche Formen nehmen die Rechtfertigungen für die Wahl der zweiten Entscheidungsmöglichkeit des Dilemmas an? Wie rechtfertigen also Autor_innen die Entscheidung, mit anti-demokratischen Mitteln die Demokratie zu schützen? Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung, wie ein solcher Demokratieschutz, der mit Zwangsmitteln betrieben wird, gerechtfertigt wird; nicht jedoch auf der Frage nach dessen Effektivität. Der hier ver-wendete Begriff der Rechtfertigung ist primär deskriptiv. Er bezieht sich auf die vorgebrachten Gründe für ein bestimmtes Handeln (oder für Handlungsempfehlungen) und sagt nichts darüber aus, ob es sich bei die-sen Gründen auch um nicht-zurückweisbare Gründe handelt, man also von einer normativen Rechtfertigung sprechen kann. Diese Rechtfertigungen wiederum werden kritisch untersucht, um sich einer möglichen Antwort auf die Frage nach einem gerechtfertigten Demokratieschutz zu nähern. Kann also die zweite Entscheidungsmöglichkeit des Dilemmas gerechtfertigt werden oder muss dieses Vorhaben etwa aufgrund von Selbstwidersprüchen scheitern? Bevor diese Fragen für die verschiedenen Ebenen und Rechtfertigun-gen des Demokratieschutzes in den einzelnen Kapiteln beantwortet wer-den können, soll zunächst dargelegt werden, was in dieser Arbeit unter Demokratieschutz konkret verstanden wird und was explizit nicht dazu gezählt wird. Die darauffolgenden Abschnitte beschäftigen sich sodann mit der Frage danach, ob es sich beim Demokratieschutz um ein Element nicht-idealer Theoriebildung handelt, sowie mit der Darstellung des von mir vertretenen (idealen) Demokratieverständnisses. Darauf folgt die Darlegung der methodischen Vorgehensweise in dieser Arbeit. Das Kapitel endet mit einer kurzen Vorstellung der verschiedenen herausgearbeiteten und zu analysierenden Rechtfertigungen des Demokratieschutzes sowie mit einem Ausblick auf die im Rest der vorliegenden Arbeit zu untersuchenden Fragestellungen. 1.2.Demokratieschutz Demokratie hat - zumindest theoretisch - eine Vormachtstellung. Sie scheint universell anerkannt, keine andere Herrschaftsform erhält so viel Zustimmung, wenn auch die verschiedenen Vorstellungen der darunter verstandenen Prozesse und Institutionen stark voneinander abweichen. Faktisch scheint Demokratie jedoch nicht über die gleiche Dominanz zu verfügen wie theoretisch. So gibt es einerseits weltweit eine Vielfalt an defekten Demokratien, andererseits sind auch konsolidierte Demokra-tien, denen keine Defekte zugeschrieben werden, einer Reihe von Bedro-hungen ausgesetzt. Etliche Hürden in der Realität erschweren es somit, die normative Idee der Demokratie zu universalisieren. Diese Hürden können je nach Zeitpunkt und Ort sehr unterschiedlicher Art sein. Einer der ersten Theoretiker, der diese Hürden für die Verwirklichung der Demokratie erkannte und analysierte sowie Handlungsempfehlungen aussprach, war Karl Loewenstein. In den 1930er Jahren identifizierte er den Faschismus als größte Gefahr für die Demokratie: 'Fascism has declared war on democracy. A virtual state of siege confronts European democracies. [...] If democracy believes in the superiority of its absolute values over the opportunistic platitudes of fascism, it must live up to the demands of the hour, and every possible effort must be made to rescue it, even at the risk and cost of violating fundamental principles.' Heutzutage ist die Gefahr durch faschistische Bewegungen eher in den Hintergrund gerückt. Aktuelle Ansätze verorten die Bedrohungen der Demokratie üblicherweise entsprechend anders: 'Neue Bedrohungen erwachsen der Demokratie neben dem seit Jahren erhebli-chen rechtsradikalen Gewaltpotential durch religiösen Fundamentalismus, neue Organisationen wie die ?Scientology-Kirche? und schließlich vor allem durch den in den Anschlägen vom 11. September 2001 sichtbar gewordenen internationalen Terrorismus.' Auch wenn heutige Ansätze weniger martialisch daherkommen als die Rhetorik von Loewenstein, bleibt der grundlegende Gedankengang gleich: Bedrohungen, denen Demokratien ausgesetzt sind, werden reflektiert, und auf der Basis dieser Reflexionen werden Handlungsempfehlungen für den Staat zum Schutz der jeweils bedrohten Demokratien entwickelt. In den folgenden Abschnitten wird zunächst Demokratieschutz defi-niert, und es wird eine Kategorisierung seiner verschiedenen Ausprägungen vorgestellt, um so einen klaren Überblick über die zum Demokratieschutz gehörenden Bereiche zu bieten. Diese Kategorisierung strukturiert zugleich die folgenden Kapitel. Zudem wird verdeutlicht, gegen welche Arten von Gefahren der Demokratieschutz in Anschlag gebracht wird. Schließlich fokussiert der letzte Abschnitt die Frage danach, ob es sich bei den Beiträgen zum Demokratieschutz um ein Element nicht-idealer Theoriebildung handelt. 1.2.1.Definition von Demokratieschutz Staatlicher Demokratieschutz kann zunächst eine Vielzahl verschiedener Formen annehmen. Einschränkungen der Meinungsfreiheit oder der Ver-sammlungsfreiheit, Partei- und Organisationsverbotsverfahren, die Institu-tionalisierung eines Verfassungsschutzes oder pro-demokratische Inter-ventionen sind nur einige Beispiele für die möglichen Maßnahmen. Diese können in demokratieschützender Absicht eingesetzt werden, können aber auch andere Hintergründe haben. Damit ist bereits ein zentrales Problem bei der Untersuchung des Demokratieschutzes genannt: Es ist nur selten möglich, mit Sicherheit zu sagen, ob es sich bei bestimmten Maßnahmen tatsächlich um Demokratieschutz handelt oder ob die Maß-nahmen zu einem anderen Ziel eingesetzt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein faktischer Erfolg einer Demokratieschutzmaß-nahme ebenso schwer nachzuweisen ist wie die Intention der Akteure, die diese Maßnahme erlassen haben. Hier soll es jedoch zunächst um die Definition dessen gehen, was - zumindest theoretisch - Maßnahmen des Demokratieschutzes ausmacht. In der wissenschaftlichen Diskussion besagter Maßnahmen wird nicht immer der Begriff des Demokratieschutzes verwendet, es herrscht stattdessen eine Vielfalt an Begrifflichkeiten vor. So wird von ?militanten Demokratien? gesprochen, von ?intoleranten Demokratien? , im deutschen Zusammenhang ist in der Regel von der ?wehrhaften? oder ?streitbaren Demokratie? die Rede. Dabei sind die Begriffe keineswegs immer austauschbar, verweisen sie doch innerhalb der Grundidee des Demokratieschutzes auf unterschiedliche Schwerpunkte. Unter Demokratieschutz verstehe ich in dieser Arbeit jedes staatliche, zwangsbewehrte Handeln, dessen explizites und vorrangiges Ziel es ist, den Fortbestand der Demokratie zu sichern. Dazu können sowohl innerhalb eines Nationalstaats beschlossene und angewandte Maßnahmen gehören als auch solche, die grenzüberschreitend gerechtfertigt und/oder angewandt wer-den. Darüber hinaus sind Fälle des Demokratieschutzes denkbar, bei denen eine Sicherung des Fortbestandes der Demokratie nur nach einer Unterbrechung des demokratischen Prozesses möglich ist - etwa, weil bewaffnete Gruppen diesen kurzzeitig unterbrechen konnten. Auch in diesen Fällen, bei denen es sich streng genommen um eine Wiederherstellung der Demokratie handelt, möchte ich von Demokratieschutz sprechen, vorausgesetzt, die Bemühungen zur Wiederherstellung setzen unmittelbar nach oder gar bereits während der Unterbrechung ein und die Wiederherstellung betrifft das spezifische demokratische System, das unterbrochen wurde. Zentral für das Merkmal des Demokratieschutzes ist bei der Wiederherstellung der Demokratie, dass es im Grunde um den Fortbestand der unterbrochenen Demokratie geht, und nicht um die Errichtung eines neuen Systems. Dies ist einerseits am zeitlichen Abstand abzulesen, andererseits aber auch an der Struktur der Demokratie, die nach der Unterbrechung wiederhergestellt wird. Rein zeitlich sollte die Unterbrechung nicht zu lange währen, weiterhin sollten die Bemühungen für die Wiederherstellung während der Unterbrechung andauern. Das demokratische System sollte nach der Unterbrechung eindeutig als dasselbe, das es vor der Unterbrechung war, erkennbar sein. Dies betrifft weniger das Personal in einer Demokratie - was nach einem Putsch auch nicht immer möglich wäre -, sondern die Institutionen und Regeln der je spezifischen Demokratieausprägung. 1.2.1.1.Kategorien und Unterscheidungen Demokratieschutz muss grundsätzlich von all denjenigen Anstrengungen unterschieden werden, die lediglich einer zunehmenden Demokratisierung dienen. Demokratieschutz schließt alle Handlungen mit erhaltendem, kon-servierendem Charakter ein, die verhindern sollen, dass eine Demokratie hinter ein bereits erreichtes Minimum an demokratischer Ordnung zurückfällt. Demokratisierung hingegen bezeichnet sowohl alle Anstren-gungen, für mehr Demokratie innerhalb einer bereits demokratischen Ordnung zu sorgen, als auch die Demokratisierung im Sinne eines Sys-temwechsels von einem nicht-demokratischen System hin zu einem (zu-mindest minimal) demokratischen System. Von der Demokratisierung zu unterscheiden ist der bereits genannte Fall der unmittelbaren Wiederherstellung der Demokratie, der eintreten kann, weil unter Umständen erst bei vollständiger Abschaffung der Demokratie für externe Akteure deutlich wird, dass sich eine Gefahr für die Demokratie materialisiert hat. Sind die entsprechenden Kriterien des Demokratieschutzes nicht erfüllt, handelt es sich entsprechend um (Re-)Demokratisierung. Außerdem sind vom hier untersuchten Demokratieschutz jene Maß-nahmen und Praktiken zu trennen, die eher einem strukturellen und damit weiteren Verständnis von Demokratieschutz zugeordnet werden könnten. Die Existenz einer geschriebenen Verfassung oder das Abhalten von Wahlen beispielsweise könnten zwar auch als Erhalt der Demokratie mit staatlichen Mitteln verstanden werden, es handelt sich dabei jedoch nicht um Demokratieschutz im engeren Sinne, sondern um Demokratieerhalt. Zu diesem können die strukturellen Eigenschaften von konstitutionellen Demokratien gezählt werden, die ihnen erst eine dauerhafte Form verleihen, dabei aber gleichzeitig auch demokratieerhaltende Funktion haben. Maßnahmen des Demokratieschutzes bedürfen aufgrund ihres auf konkret auftretende Gefahren bezogenen Charakters immer wieder der Rechtfertigung ihrer Anwendung, auch wenn die dazugehörigen Maßnahmen teilweise in der Verfassung verankert sind. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit Demokratieschutz, nicht mit Demokratieerhalt. Durch den Fokus auf staatliches Handeln werden des Weiteren sämtli-che zivilgesellschaftliche Aktivitäten, die dem Schutz der Demokratie die-nen, nicht von der hier verwendeten Definition des Demokratieschutzes abgedeckt. Ebenso muss Demokratieschutz von Staatsschutz unterschie-den werden. Während es bei Ersterem um den Schutz der Demokratie geht, steht bei Letzterem der Erhalt oder Schutz des Staates als solchem, sei er demokratisch oder nicht, im Vordergrund. Entsprechend unterscheiden sich die Rechtfertigungen der jeweils angewandten Maßnahmen - einerseits mit Bezug auf Demokratie, andererseits mit Bezug auf die Aufrechterhaltung von staatlicher Ordnung. Innerhalb des Demokratieschutzes kann grundsätzlich unterschieden werden zwischen Demokratieschutz auf nationalstaatlicher Ebene und Demokratieschutz mit grenzüberschreitendem Charakter. Dass es grenz-überschreitenden Demokratieschutz gibt, kann unter anderem darauf zu-rückgeführt werden, dass einzelne Demokratien immer wieder ohne Erfolg versucht haben, die eigene Demokratie vor der Abschaffung zu bewahren, sodass internationale Vertragswerke und Kooperationen geschaffen wurden, die (auch) dem Zweck des Schutzes der demokratischen Systeme in den jeweiligen Mitgliedsländern gewidmet sind. Während also etwa das Verbot einer Partei oder einer Organisation in der Regel eine rein nationalstaatliche Maßnahme ist, handelt es sich bei der Durchführung einer pro-demokratischen Intervention um eine grenzüberschreitende, internationale Maßnahme. Dabei wird deutlich, dass rein zahlenmäßig ein Großteil der Vorkehrungen des Demokratieschutzes auf nationalstaatlicher Ebene festzustellen ist. Weiterhin kann zwischen solchen Maßnahmen unterschieden werden, deren Initiative bei den betroffenen Demokratien selbst liegt, und solchen, bei denen externe Akteure die Initiative zum Schutz einer fremden Demokratie ergreifen. Es ist also zu unterscheiden zwischen reflexivem Demokratieschutz, bei dem eine Demokratie sich darum bemüht, den eigenen Fortbestand zu sichern, und externem Demokratieschutz, bei dem andere Akteure ohne Betreiben der Vertreter_innen der betroffenen Demokratie die Initiative ergreifen. Die Kategorie der Initiative ist jedoch streng zu trennen von der Kategorie der Durchführung. Gerade bei grenzüberschreitendem Demokratieschutz kann es sein, dass der betroffene Staat zwar die Initiative für das Ergreifen von Demokratieschutzmaßnahmen innehat, jedoch selbst nicht (mehr) in der Lage ist, solche Maßnahmen durchzuführen.
| Erscheint lt. Verlag | 11.1.2018 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Politische Theorie |
| Schlagworte | Bürgerliche Freiheiten • Demokratie • Demokratieschutz • Internationale Beziehungen • Menschenrechte • Völkerrecht • Volkssouveränität |
| ISBN-10 | 3-593-43846-1 / 3593438461 |
| ISBN-13 | 978-3-593-43846-7 / 9783593438467 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 14,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich