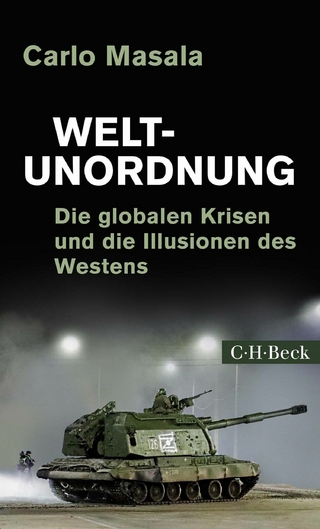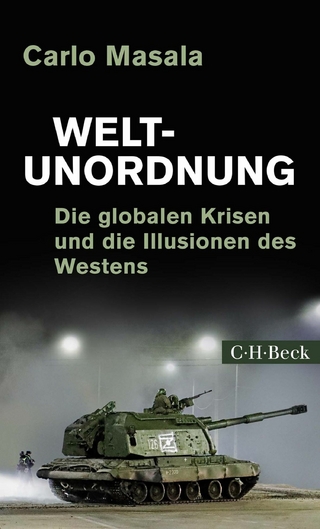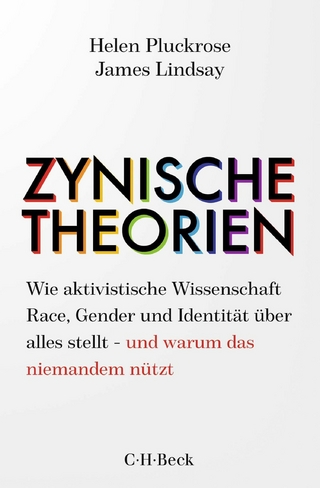Deutschland rechts außen (eBook)
320 Seiten
Piper Verlag
978-3-492-99432-3 (ISBN)
Matthias Quent ist Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Er gründete und leitete bis 2022 das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) in Jena. Quent forscht und lehrt unter anderem zu Rechtsradikalismus, Folgen der Digitalisierung, zu Demokratieförderung und zu gesellschaftspolitischen Fragen der ökologischen Transformation. Als medial gefragter Experte, Redner und Sachverständiger berät und unterstützt er Aktivitäten zur Stärkung demokratischer Kultur in unterschiedlichen Kontexten. Sein Sachbuch »Deutschland rechts außen« (Piper, 2019) stand auf der Spiegel-Bestsellerliste und wurde mit dem Preis »Das politische Buch 2020« der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgezeichnet. Quent studierte Soziologie, Politikwissenschaft und Neuere Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der University of Leicester (UK).
Dr. Matthias Quent, 1986 geboren und aufgewachsen in Thüringen, ist Soziologe und profilierter Rechtsextremismusforscher. Er ist Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) der Amadeu Antonio Stiftung in Jena. Gegründet als Konsequenz aus dem NSU-Komplex, werden dort Ursachen und Erscheinungsformen von Diskriminierung, Hass, politischer Gewalt und Demokratiefeindlichkeit erforscht.
Vorwort
Viele Menschen reagierten im September 2017 schockiert auf den Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag. Empörung und Fassungslosigkeit begleiteten die rechtsradikalen Krawalle in Chemnitz 2018, bei denen rechte Populisten und Problembürger mit Hooligans und Neonazis gemeinsame Sache machten. Weltweit sorgte der rechtsterroristische Anschlag im neuseeländischen Christchurch, bei dem im März 2019 einundfünfzig Muslime starben, für Entsetzen. Die neue Stärke populistischer und radikaler Rechter nach den Europawahlen im Mai 2019 macht deutlich, wie groß die Gefahr von rechts ist. Die Frage, wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können, beschäftigt viele: Sicherheitsbehörden, Politiker und 86 Prozent der Deutschen sorgten sich im Frühjahr 2019 vor einer Zunahme von Rechtsradikalismus und rassistischer Gewalt.[1] Doch wenn die öffentliche Aufmerksamkeit einsetzt, ist es meist schon zu spät.
So auch bei der Ermordung des hessischen CDU-Politikers Walter Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident wurde am 2. Juni 2019 aus nächster Nähe erschossen. Im Internet ergoss sich eine menschenverachtende Lawine der Genugtuung über den Tod des Politikers, der sich gegen rechts und für einen humanen Umgang mit Geflüchteten ausgesprochen hat. Der tatverdächtige Attentäter wurde seit den frühen Neunzigerjahren Jahren mehrfach wegen rassistischer Anschläge und rechter Gewalttaten verurteilt – offenbar handelt es sich um einen rechtsradikalen Schläfer. Zum ersten Mal seit 1945 hatte der Rechtsradikalismus damit für einen amtierenden Politiker tödliche Folgen.
Die Qualität ist eine andere, aber weder die rechten Positionen noch die Gewalt ist neu. Nicht für Fachleute, nicht für mich und nicht für viele meiner Freunde aus dem Osten der Republik. Wir wurden immer wieder von Neonazis gejagt, überfallen und verprügelt, weil ihnen unsere Frisuren und unsere Kleidung oder unsere Ideen nicht passten. Rassismus und Hasskriminalität ist auch nichts Neues für viele Menschen aus Einwandererfamilien, denen ihr Migrationshintergrund anzusehen ist und die seit Jahrzehnten noch schlimmere Erfahrungen machen müssen. Sie haben nicht die Möglichkeit, sich durch Anpassung vor Alltagdiskriminierung und rechter Gewalt zu schützen.
Ich bin 1986 in der DDR geboren und habe vom SED-Regime nicht viel mitbekommen. Prägend waren Erfahrungen, die ich als Jugendlicher machen musste. Die beschauliche Thüringer Kleinstadt Arnstadt, in der ich aufgewachsen bin, rühmt sich damit, dass der Komponist Johann Sebastian Bach einige Zeit dort tätig war, und vermarktet sich als »Tor zum Thüringer Wald«. Wie in jedem anderen Ort auch gibt es in Arnstadt anständige und unanständige Menschen. Nur sind die Anständigen meist zu leise und die Unanständigen zu laut. Als ich das erste Mal von Neonazis überfallen wurde, war ich gerade vierzehn geworden. Im Schulbus hielten sie mich fest und gingen mit einem Messer auf mich los, um mir meine Haare abzuschneiden. Der Bus war voll besetzt, niemand griff ein.
Die Situationen variierten – gleich blieb die ständige Bedrohung durch die Gewalt der Rechtsradikalen und die Ignoranz der Öffentlichkeit. Sogar auf dem morgendlichen Schulweg wurden meine Freunde und ich von Nazis überfallen und mit Stahlstangen und Pflastersteinen verletzt. Am Bahnhof stießen sie mich auf die Gleise, im Zug nach Erfurt zündeten sie meinen Rucksack an. Freunde wurden mit Autos angefahren, einem der Kiefer zertrümmert und einer Bekannten Teile des Ohres abgerissen. Zum Glück musste ich nie Schlimmeres als eine gebrochene Nase erleiden.
Neonazis patrouillierten am Wochenende in Autos und verprügelten Menschen, die nicht in ihre ideologischen Vorstellungen passten. Anwesende sahen meist weg – ob aus Angst oder heimlicher Sympathie, weiß ich nicht. Die Polizei kam häufig gar nicht erst, nur einmal wurde ein rechter Gewalttäter verurteilt. Die anhaltende Normalität des rechten Alltagsterrors bewegte viele zum Wegzug. Ich blieb in Ostdeutschland, studierte Soziologie und wurde schließlich öffentlicher Rechtsextremismusforscher, doch ich verstehe jeden, der dieses Klima der Angst hinter sich ließ. Andere politisierten und wehrten sich, einige radikalisierten sich. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann erschüttert es mich sehr, wie normal es damals war, dass Sechzehnjährige mit Springmesser und Gaspistole ausgingen, um sich vor Nazis zu schützen. Leider hat sich an dieser prekären Situation mancherorts bis heute nicht viel geändert.
Das waren und sind keine Einzelfälle, sondern systematische Raumkämpfe, die so ähnlich überall in Ostdeutschland vorkamen und noch immer vorkommen. Und dabei waren die Nullerjahre schon viel friedlicher als das vorherige Jahrzehnt, in dem Rechtsradikale überall im Land Menschen überfielen, verletzten und sogar totschlugen. Wenn ich heute in Gesprächen mit Westdeutschen von meinen Erfahrungen berichte, erlebe ich bei den meisten Fassungslosigkeit, Unkenntnis und Wut. Bei einem Vortrag vor westdeutschen Gewerkschaftern schilderte ich am Rande die Erlebnisse in meiner Jugend; eine Teilnehmerin brach dabei in Tränen aus. Erst da verstand ich richtig, dass es in einer Demokratie nicht normal ist, ständig auf der Hut vor rechten Angriffen sein zu müssen. Wer den Rechtsradikalismus verstehen will, muss seine Nähe zur Gewalt – sei sie in offener Aggression oder in drohender Manier – einbeziehen. Und wer das, was derzeit in unserer Gesellschaft geschieht, verstehen will, muss die Kontinuität des Rechtsradikalismus berücksichtigen.
Auch der Rechtspopulismus ist für mich nicht neu. Der jahrelange Bürgermeister meiner Heimatstadt Arnstadt, Hans-Christian Köllmer (Wählergemeinschaft Pro Arnstadt), sympathisierte mit der rechtsradikalen Kleinstpartei Pro Deutschland. Während die EU-Staaten im Jahr 2000 die österreichische Bundesregierung unter dem Pionier der europäischen Rechtspopulisten, Jörg Haider, boykottierten, traf sich »mein« Bürgermeister öffentlichkeitswirksam mit Haider. Nachdem 2002 ein Amokläufer am Erfurter Gutenberg-Gymnasium fünfzehn Menschen erschoss, stellte Köllmer mit einem Aufkleber auf seinem Dienstwagen klar: »Ich bin die Waffenlobby.« Er erklärte eine CDU-Politikerin mit einem Plakat zur »unerwünschten Person«, setzte Proteste gegen rechts mit der Verfolgung der Juden im Dritten Reich gleich und wehrte sich gegen den Vorwurf, er sei ein »kleiner Nazi«, mit der Reaktion: »Im Nazi ist mir zu viel Sozialismus drin.« Das alles geschah vor der AfD.
In den vergangenen dreißig Jahren haben die Zivilgesellschaft und die demokratische Kultur in Ostdeutschland erhebliche Fortschritte gemacht, nicht zuletzt in der Abwehr der permanenten rechten Gefahr. Heute ist die vollbrachte historische Aufholleistung zum Westen riesig – nicht nur in Bezug auf die Wirtschaft, sondern gerade auch hinsichtlich der politischen Kultur. Trotz des hohen gewaltsamen und politischen Drucks von rechts außen. Was die Rechtsradikalen nicht bedenken: Ihre Angriffe und Überfälle mobilisieren nicht nur Angst und Resignation, sondern auch Empörung und Gegenwehr. Viele Ostdeutsche meiner Generation teilen die Gewalterfahrungen aus eigenen Erlebnissen oder aus ihrem Umfeld. Aus der Betroffenheit erwächst Widerstand, der den Rechtsradikalismus und seine Wurzeln meist gezielt, intelligent und wirkungsvoll angeht. Wir konnten es uns nie leisten, neutral und gleichgültig gegenüber Rechtsradikalen zu sein. Ignoranz war – und ist – potenziell lebensgefährlich.
Überall treffe ich Menschen, die Erfahrungen mit dem Hass von rechts außen machen mussten und daraus Widerstandskraft entwickelt haben. Ich denke, wer lernen musste, stets auf der Hut vor rassistischen oder rechtsradikalen Angriffen zu sein, entwickelt eine besondere Sensibilität gegenüber den Gefahren von rechts außen. Dieser »andere« Osten braucht und verdient Solidarität, keine Vorurteile. Die rechten Angriffe auf die Demokratie hinterlassen in den neuen Bundesländern besonders starke Spuren, nicht zuletzt, weil die Zivilgesellschaft schwächer ist. Aber sie ist da, und sie ist wehrhaft. Ich bin überzeugt davon, dass die bundesdeutsche Gesellschaft von den Erfahrungen und der Expertise lernen kann, die viele Ostdeutsche – und auch viele Menschen aus Einwandererfamilien – unfreiwillig mit radikal Rechten machen mussten. Und oft kommen radikal rechte Angriffe aus dem Milieu der sogenannten Mitte der Gesellschaft.
Schon als 2011 bekannt wurde, dass mit dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) ein rechtsterroristisches Netzwerk für Anschläge, Überfälle und den Tod von zehn Menschen verantwortlich war, fragte sich die Öffentlichkeit empört, warum scheinbar niemand das Treiben der Rechten erkannt und gestoppt hat. Die Neonazis kamen aus Jena – der Stadt, in der ich heute lebe und arbeite. Sie wohnten im sächsischen Zwickau und Chemnitz – Orte, die immer wieder wegen rechtsradikaler Vorfälle in die Schlagzeilen geraten. Um zu erforschen und die Gesellschaft darüber zu informieren, wie die Rechtsradikalen vorgehen, wie Diskriminierung wirkt und was die Ursachen dieser Bedrohungen für das Zusammenleben sind, fördert die Thüringer Landesregierung seit 2016 das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena (IDZ). In Trägerschaft der Amadeu Antonio Stiftung, die sich seit über zwanzig Jahren gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsradikalismus einsetzt, leite ich die Einrichtung. Als Thinktank der Zivilgesellschaft wollen wir verstehen, wo undemokratische und menschenfeindliche Tendenzen der Gesellschaft herkommen, was wir gegen Rassismus und für die Werte des Grundgesetzes tun können. Mit zehn anderen Forschungseinrichtungen in Deutschland untersuchen wir am IDZ als Teil des »Forschungsinstituts Gesellschaftlicher...
| Erscheint lt. Verlag | 5.8.2019 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Adorno • AfD • Anschlag • Brandenburg • Halle • Hanau • Hasskriminalität • hate crime • Juden • Landtagswahl in Brandenburg • Landtagswahl in Sachsen • Landtagswahl in Thüringen • Mordfall Lübcke • Nazi • Nazismus • Neonazis • Neuerscheinung 2019 • NSU • populisten • Rassismus • rechts • Rechtsextremismus • Rechtsradikalismus • Sachsen • Shisha-Bar • Synagoge • Thilo Sarrazin • Thüringen • Türken • Walter Lübcke |
| ISBN-10 | 3-492-99432-6 / 3492994326 |
| ISBN-13 | 978-3-492-99432-3 / 9783492994323 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich