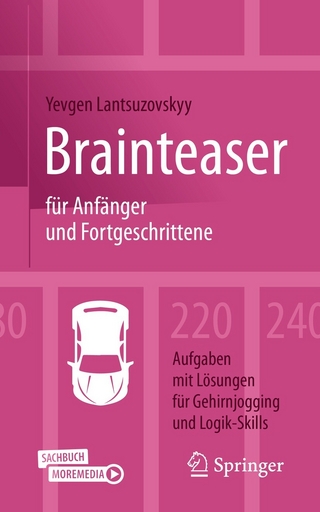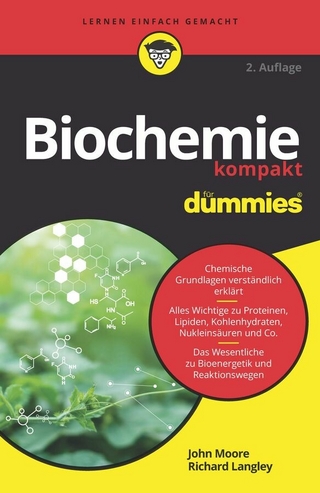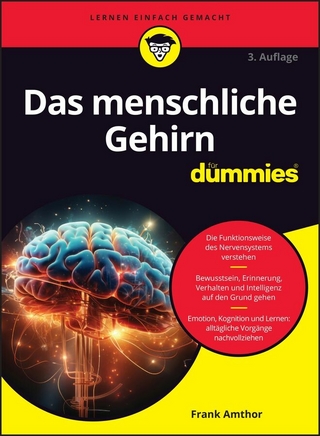Hotspot (eBook)
192 Seiten
Piper Verlag
978-3-492-97592-6 (ISBN)
Prof. Dr. med. Hendrik Streeck ist der Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn. Er begann seine medizinische Laufbahn an der Charité in Berlin und promovierte an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Von 2006 bis 2009 absolvierte er ein Postdoctoral Fellowship an der Harvard Medical School. Er war u. a. Assistenzprofessor am Ragon Institute of Massachusetts General Hospital, Massachusetts Institute of Technology und an der Harvard Medical School, sowie Leiter der Abteilung für zelluläre Immunologie am US Military HIV Research Program. 2015 folgte Streeck dem Ruf nach Essen, wo er das Institut für HIV-Forschung gründete. Er ist Mitglied der europäischen Akademie der Wissenschaft und Künste, sowie Kuratoriumsvorsitzender der deutschen AIDS-Stiftung. Er war Mitglied im Corona-Expertenrat des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Bundesregierung. Derzeit ist er Mitglied der Enquete-Kommission NRW zum Krisenmanagement sowie des Expertenrats der Bundesregierung zu Gesundheit und gesellschaftlicher Resilienz.
Prof. Dr. med. Hendrik Streeck, Jahrgang 1977, ist Direktor der Institute für Virologie und HIV-Forschung an der Universität Bonn. Er absolvierte seine medizinische Ausbildung an der Charité in Berlin und promovierte an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Von 2006-2009 absolvierte er einen Postdoctoral Fellowship am Partner AIDS Research Center und war Assistenzprofessor an der Ragon Institute of MGH, MIT und Harvard sowie Assistant Immunologist am Massachusetts General Hospital.
Kapitel 1
Ein neues Virus
21. Januar 2020, am Nachmittag. Ich eilte den Venusberg hinunter, um den Zug nach Brüssel noch zu bekommen. Gerade einmal ein paar Monate war es her, dass ich meine neue Stelle am Institut für Virologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn angetreten hatte, und seitdem war ich vollauf damit beschäftigt, mich in dem neuen Job einzurichten. Vor allem mit den engen Mitarbeitern, der großen Gruppe an Diagnostikern, den vielen medizinisch-technischen Assistenten und Wissenschaftlern führte ich Kennenlerngespräche und verschaffte mir Einblicke in die Forschungsarbeiten und die Klinik.
Anfang Januar, ich war erst drei Monate zuvor von Essen nach Bonn umgezogen, erreichte uns die Nachricht aus Wuhan von Infektionen mit einem neuartigen Coronavirus. 44 Fälle einer schweren Pneumonie waren am 31. Dezember 2019 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeldet worden, von denen die meisten stationär behandelt werden mussten. Sie alle hatten gemeinsam, dass sie auf einem sogenannten Wet Market, einem Nassmarkt, in der chinesischen Stadt Wuhan gewesen waren. Der Huanan-Großhandelsmarkt für Fische und Meeresfrüchte ist berüchtigt dafür, dass hier nicht nur Meerestiere, sondern auch Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Insekten verkauft werden, die meisten von ihnen lebend, oder sie werden auf dem Markt direkt geschlachtet. Daher der Name Nassmarkt. Ich selbst habe ihn einmal gesehen, als wir im Rahmen eines Forschungsaustauschs die Kollegen der Universität von Wuhan und vom virologischen Institut besuchten. Das war 2015, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mich der Markt zugleich faszinierte wie befremdete. Auch mit dem Essen in Wuhan konnte ich mich wie viele der deutschen Kollegen nie so richtig anfreunden.
Dass es in China, wo die Menschen in engem Kontakt mit Tieren leben und Wildtiere als Delikatesse gelten, zu einer Zoonose, also einem Virusübertritt vom Tier auf den Menschen gekommen war, überraschte mich wenig. Ein solcher Nassmarkt war ein ideales Milieu für eine derartige Ausbreitung. Verursacht vielleicht durch einen Bauern, der Schuppentiere hielt oder in freier Wildbahn fing und von ihnen mehrfach angeschnäuzt worden war. Die vom Aussterben bedrohten Schuppentiere gelten in China nicht nur als Leckerbissen, sondern finden auch in der traditionellen chinesischen Medizin Verwendung. Vor allem die Schuppen sollen potente Mittel gegen Hautprobleme und Lähmungen sein. Die Schuppentiere tragen wie viele andere Tiere Coronaviren in sich. Häufig werden sie gar nicht krank davon; in seltenen Fällen aber kann solch ein Virus von einem Tier auf den Menschen übergehen.
Es ist schwer, im Nachhinein festzustellen, wann und wo der Übertritt stattgefunden haben könnte und von welchem Tier das Virus überhaupt kam, aber die genetischen Sequenzen liefern einige Hinweise. Zwar ist es nicht bewiesen, aber man geht davon aus, dass das Virus von einer Fledermaus wahrscheinlich irgendwann einmal auf ein Schuppentier übergegangen ist und von dort auf den Menschen. Das würde in einem Apokalypsefilm dann so aussehen, dass sich in der Nacht eine Fledermaus auf ein Schuppentier stürzt und es beißt. Dabei tritt das Virus über. Das Schuppentier erkrankt, wird vom Jäger eingefangen und niest dem Jäger ins Gesicht. Der Jäger geht mit dem Schuppentier auf den Markt, will es verkaufen, ist aber bereits erkrankt. Lauthals versucht er, das Tier an den Mann zu bringen, und verteilt dabei die Viren über den Markt.
Am 7. Januar 2020 meldete die chinesische Gesundheitsbehörde, dass es sich um ein neues Coronavirus handele, novel Coronavirus 2019 (nCoV-2019), wie es zunächst hieß. Bereits am 10. Januar wurde die Sequenz des neuen Coronavirus veröffentlicht, die eine Ähnlichkeit zu SARS-Viren aufwies und auf deren Basis viele Labore nun an Nachweistests arbeiteten. Am Vortag waren erste Einzelfälle aus den Nachbarländern Thailand, Japan und Südkorea gemeldet worden. Das ließ den Gedanken an eine Pandemie zu, aber das Virus war weit weg. Zudem gab es bislang noch unter 100 Fälle, und man versuchte in Asien mit Hochdruck, jeden Infizierten zu erkennen und zu isolieren, um eine Pandemie zu verhindern. Eine lokale Eindämmung schien möglich.
Am Vormittag des 21. Januar hatten wir noch ein Diagnostikmeeting im Institut abgehalten, um neben den anderen diagnostischen Aufgaben auch zu besprechen, ob es sinnvoll wäre, den Test auf das neuartige Coronavirus im Institut zu etablieren. Die Grundlage für die Testentwicklung war die Genomsequenz, die in China veröffentlicht worden war. Zudem hatte mein Vorgänger am Institut, Christian Drosten, bereits einen Test an der Berliner Universitätsklinik Charité entwickelt, der leicht adaptierbar war. Wir diskutierten, ob es sinnvoll wäre, ihn bei uns einzuführen. Aufgrund des Mangels an Personal und der großen Arbeitsbelastung der Mitarbeiter entschieden wir uns vorerst dagegen. Wir wollten abwarten.
Am Abend dieses 21. Januar saß ich in Brüssel mit amerikanischen Bekannten zusammen, als plötzlich die Meldung kam: In den USA war ein Mann positiv auf den neuen Erreger getestet worden. Der erste Fall außerhalb Asiens! Mit einem Mal war das neue Virus bedenklich nahe gerückt. Wir mussten uns vorbereiten. Wir brauchten den Test. Ich rief meine Stellvertreterin an, um mit ihr die neue Situation zu besprechen. Wir diskutierten, wie lange wir brauchen würden, um den Test zu etablieren. Es war Dienstag, und wir wollten ihn bereits Ende der Woche einsatzfähig haben. Meine Sorge bestand darin, dass es schon erste Fälle in Deutschland gab, die wir übersehen hatten.
Die Verbindungen zwischen China und vielen Städten in Nordrhein-Westfalen waren rege. Auch ich hielt noch Kontakt zu meinen Kollegen in Wuhan. Die Bilder von dort, die in den folgenden Tagen in den sozialen Medien auftauchten, waren erschreckend – Szenen, die das chinesische Staatsfernsehen nicht zeigte. Menschen, die reihenweise umzukippen schienen, eine Frau, die eine Fledermaus aß, ein Mann, der lebende Mäusebabys verspeiste. Dann geheime Aufnahmen. »Mein Gott, so viele Tote«, kommentierte einer den Anblick eines Leichenwagens vor dem Krankenhaus. Doch viele der Bilder waren falsch. Die Menschen, die umkippten, starben nicht an dem neuen Virus; es waren zum Teil alte Aufnahmen und der Grund zum Beispiel ein Herzinfarkt. Die Frau, die die Fledermaus aß, tat dies auf den Philippinen für eine Reisesendung. Aber wer wusste schon, was stimmte oder nicht. Hier begann bereits eine Infodemie, die sich durch die gesamte Coronakrise ziehen sollte.
Am nächsten Morgen fuhr ich mit dem ICE zurück nach Bonn.
Webasto – Der erste Fall in Deutschland
Das Virus hatte die Grenzen Chinas verlassen, und dass es nun auch zu uns kommen würde, stand außer Frage. Es begann ein Warten, in welchem deutschen Labor der erste Fall auftauchen würde. Wir tauschten uns aus. Der Test war gut etabliert. Er zeigte verlässlich unsere Positivkontrolle an und war verlässlich negativ. Da lag aber meine Sorge. Ich befürchtete, dass der Test zwar funktionierte, aber nicht das Virus detektierte. Bisher hatte nämlich noch niemand in Deutschland eine Probe des Virus und damit die Möglichkeit, das Virus selbst nachzuweisen. Die Positivkontrolle war bis dahin nur ein künstlich erzeugter Strang Ribonukleinsäure, abgekürzt RNA. Aus dem Labor, kein Virus. Der Gedanke, das Virus könnte sich ohne unsere Kenntnis ausbreiten, sorgte bei mir für Anspannung.
Wir hatten im Labor viel Erfahrung mit Coronaviren, nicht nur mit SARS, sondern auch mit fünf weiteren, die den Menschen krank machen können. Darüber hinaus gibt es unzählig viele Coronaviren im Tierreich. Man nennt sie Coronaviren, da sie in ihrem Aussehen unter dem Elektronenmikroskop der Sonnenkorona ähneln. Das Bild entsteht durch die Spikes – den auf der Oberfläche der Viren sitzenden stachelartigen Proteinen, die für den Eintritt in die Wirtszelle zuständig sind. Bekannt wurden Coronaviren der Allgemeinheit mit dem SARS-Virus. Im Jahr 2002 ging es vermutlich von Schleichkatzen auf den Menschen über und breitete sich weltweit aus. Auch damals war es ein bis dahin unbekanntes Coronavirus; es gab rund 8400 Infizierte und 800 Todesopfer. Das Besondere an SARS ist, dass es tief in der Lunge repliziert und dadurch eine schwere atypische Lungenentzündung verursacht. Durch diese Lage in der Lunge ist es sehr viel gefährlicher als das neue SARS-CoV-2-Virus, aber da es nicht im gleichen Maß im Rachen aktiv ist, überträgt es sich schlechter. Den Ausbruch damals hatten die chinesischen Behörden versucht zu verheimlichen. Umso skeptischer wurden die derzeitigen Berichte aus China betrachtet. Es schien aber, als wollte man nun alles richtigmachen.
Später folgte ein weiteres Coronavirus: das Middle East Respiratory Syndrome Related Virus, MERS, das von Kamelen auf den Menschen übergegangen war. In mehreren Ländern kam es in verschiedenen Wellen zu Ausbrüchen, wobei die größten in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Republik Korea zu verzeichnen waren. Das Virus scheint aber zum Glück nicht ohne Weiteres von Person zu Person übertragen zu werden, es sei denn, es besteht ein enger Kontakt. Aber es ist tödlich, rund 35 Prozent der Infizierten versterben.
Während SARS seit dem Ausbruch 2002 nicht mehr aufgetreten ist, kommt MERS immer mal wieder sporadisch vor, sodass verstärkt nach einem Impfstoff gegen MERS geforscht wird. Aber auch an einem universellen Coronavirus-Impfstoff wurde schon vor SARS-CoV-2 geforscht. Denn nicht nur MERS und SARS...
| Erscheint lt. Verlag | 1.2.2021 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Natur / Technik ► Naturwissenschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Alexander Kekulé • Ausbruch • Ausgangsbeschränkungen • Ausnahmezustand • Christian Drosten • Corona-Kompass • Covid-19 • Drosten • Gesellschaft • Heinsberg Studie • Hot Spot • infektionsketten • Isolation • Krise • lockdown • Pandemie • Quarantäne • SARS-CoV-2 • shutdown • Virologen • Virus • Vorsichtsmaßnahme |
| ISBN-10 | 3-492-97592-5 / 3492975925 |
| ISBN-13 | 978-3-492-97592-6 / 9783492975926 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich