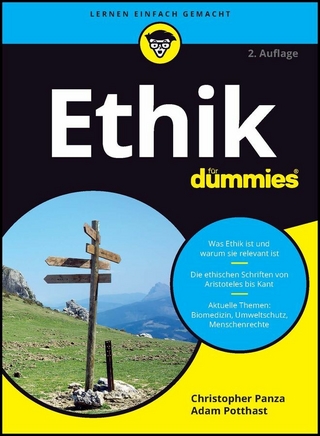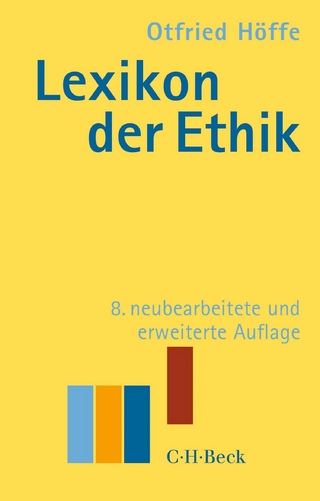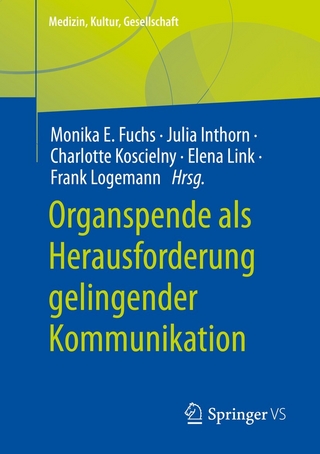Handlungsfreiheit und moralische Verantwortung (eBook)
291 Seiten
De Gruyter (Verlag)
978-3-11-123495-3 (ISBN)
In einem großen systematischen Bogen werden Metaphysik, Handlungstheorie und Tugendethik verbunden, um die Voraussetzungen moralischer Verantwortung zu begründen. Die Arbeit liefert nicht nur einen detaillierten Überblick über den aktuellen Stand der Debatte um Handlungs- und Willensfreiheit, sondern bringt mit der Verbindung von Libertarismus und Tugendethik auch selbst eine neue Perspektive in die Debatte ein.
Carolin Denise Rutzmoser, Hochschule für Philosophie München, München.
3 Die Inkompatibilität von freier Handlung und Determinismus
„Neuerdings sind es vor allem einige Hirnforscher, die die Handlungsfreiheit infrage stellen. Da unbewußte Gehirnprozesse das Bewußtsein steuerten, sei die Handlungsfreiheit eine Illusion“ (Höffe 2013, 51). Wenn die Handlungsfreiheit allerdings eine Illusion ist und alle Entscheidungen, die wir treffen, durch das Feuern unserer Neuronen vollständig erklärbar sind, dann können wir weder sinnvollerweise für unser Verhalten verantwortlich gemacht werden, noch können wir bei unserem Agieren überhaupt noch von einer Handlung sprechen. Denn „Handlung“ setzt voraus, dass man etwas absichtlich und freiwillig tut und dass es einen Grund für die Handlung gibt. Haben der Physikalismus und seine verschiedenen Strömungen Recht, dann kann man nicht mehr von freien oder freiwilligen Handlungen sprechen. Wollen wir zumindest die Rede von einem freien Willen oder freien Handlungen nicht aufgeben, sind die einzigen beiden Alternativen der Kompatibilismus und der Libertarismus. Der Kompatibilismus nimmt an, dass nur die Entscheidungen frei sein können, die einen bestimmten Grund haben, der die Handlung erklärbar macht. Dieser muss eindeutig determinieren, warum es für die Person besser ist, so und nicht anders zu handeln, weil jede Entscheidung ohne solch einen Grund reine Willkür wäre. Hier ist also freies Handeln mit dem Determinismus kompatibel. Da Kompatibilisten für ihre Theorie starke Argumente haben, wird im Folgenden zunächst untersucht, ob eine Handlung allein durch das Feuern der Neuronen im Gehirn erklärt werden und als bloße Körperbewegung betrachtet werden kann. Im Anschluss wird der Frage nachgegangen, ob eine Handlung determiniert sein kann, oder ob freie Handlungen nicht vielmehr inkompatibel mit einem universalen Determinismus sind.
3.1 Sind unsere Handlungen determiniert?
Das durch Naturwissenschaften geprägte Weltbild trägt dazu bei, dass Handlungen als nur durch Impulse vom Gehirn ausgelöste Körperbewegungen angesehen werden. Die Naturwissenschaften gehen von einer kausal lückenlos geschlossenen Welt aus, in der es genau eine physikalische Ursache für jedes Ereignis gibt. Diese eine Ursache bewirkt das Ereignis, sonst wäre es reiner Zufall. Das bedeutet, dass es nicht mehrere Ursachen geben kann, die ein Ereignis bewirken, wodurch eine mentale Entität ein Ereignis wie eine Handlung nicht hervorbringen kann, denn es gibt ja schon eine physikalische Ursache dafür. Wir nehmen uns im Gegensatz dazu selbst als handelnde Wesen wahr, die durch ihre Entscheidungen in die Welt eingreifen. In unserer Selbsterfahrung und in unserem Zusammenleben werden mentale Entitäten also tatsächlich als kausal wirksam betrachtet, sonst könnten wir uns gegenseitig und selbst gar keine Verantwortung zuschreiben (vgl. Brüntrup 2012a, 18 – 20).
Nach Erasmus Mayr gibt es drei Thesen über menschliches Handeln, die scheinbar nicht alle gleichzeitig wahr sein können. Erstens sind menschliche Handlungen Tätigkeiten, bei denen der Handelnde aktiv ist und nicht nur passiv etwas erleidet. Zweitens sind menschliche Handlungen natürliche Phänomene und als solche Teil der natürlichen Ordnung. Drittens können menschliche Handlungen durch ihre Gründe erklärt werden (wenn sie absichtlich sind). Diese drei Thesen stellen Auffassungen dar, die wir über uns selbst als Menschen und über unsere Handlungen haben. Doch wenn man eine dieser Thesen zu ernst nimmt, steht sie im Konflikt mit den anderen beiden Thesen (vgl. Mayr 2011, 6 – 7).
Nach Mayr gibt es jedoch keinen direkten Konflikt zwischen der zweiten und den anderen beiden Thesen, wenn man das als wissenschaftliches Bild der Welt betrachtet, was durch die tatsächlichen Entdeckungen der heutigen Naturwissenschaften nahegelegt oder belegt werden kann. Konflikte mit den anderen Thesen treten nur auf, wenn man philosophische Meinungen und Vorurteile darüber hat, wie dieses wissenschaftliche Bild aussehen müsste. Solche Vorurteile waren nach Mayr seit dem 18. Jahrhundert sehr einflussreich. Doch es handelt sich dabei um Interpretationen von naturwissenschaftlichen Entdeckungen, die selbst nicht mehr Teil von Naturwissenschaften, sondern bereits philosophische Interpretationen sind. Während diese Meinungen, Vorurteile und Interpretationen mit den anderen beiden Thesen im Konflikt stehen, sind die aktuellen Ergebnisse und Entdeckungen der Naturwissenschaften dafür nicht problematisch. Für Mayr sind die beiden wichtigsten dieser vorgefassten Meinungen die Ereigniskausalität und ein bottom-up Verständnis der Welt (vgl. Mayr 2011, 8 – 9).
Die Ereigniskausalität hat ihre Ursprünge bei Humes Überlegungen zur Kausalität, bei der die Natur als Fluss von miteinander verbundenen Ereignissen betrachtet wird. Hier gibt es nur Ereignisverursachung, die von den Naturgesetzen abhängt. Ein Geschehnis kann dabei durch die früheren Geschehnisse in Verbindung mit den Naturgesetzen erklärt werden, wodurch der Handelnde keinen gesonderten Platz mehr hat. Denn die menschlichen Handlungen gehören hier als natürliche Phänomene zum Fluss der Ereignisse und sind daher selbst nur Ereignisse. Der Handelnde ist dann nur in dem Sinne involviert, dass ihm etwas (ein Ereignis) geschieht oder das Ereignis (seine Handlung) mit anderen Ereignissen verbunden ist, die ihm passieren. Seine Handlungen sind dadurch nichts, wovon er die aktive Quelle sein könnte. Gehört diese Sicht also wirklich zum wissenschaftlichen Bild der Welt, dann sind die Thesen eins und zwei nicht kompatibel (vgl. Mayr 2011, 9).
Bei der bottom-up Sicht geht man davon aus, dass höhere Ebenen von Phänomenen von den niedrigeren Ebenen völlig abhängen und durch diese entstehen. Die Phänomene auf der Makroebene und die kausalen Verbindungen auf höheren Ebenen können durch die Phänomene auf der Mikroebene vollständig beschrieben werden. Die kausalen Verbindungen auf höheren Ebenen können also völlig auf das Wirken und die Phänomene auf niedrigeren Ebenen reduziert werden, wodurch die bottom-up Sicht in Konflikt mit den anderen beiden Thesen steht. Denn hier würden die Phänomene auf einer höheren Ebene (menschliche Handlungen) von den Phänomenen niedrigerer Ebenen (wie neurophysiologischen Prozessen) vollständig abhängen. Die gesamte kausale Arbeit würde dann auf der neurophysiologischen Ebene stattfinden. Damit hätte der Handelnde keine aktive Rolle mehr. Darüber hinaus wären aber auch Erklärungen durch Gründe als Erklärungen einer höheren Ebene keine kausalen Erklärungen mehr (vgl. Mayr 2011, 11).
3.1.1 Kausalität
Eine bestimmte metaphysische Auffassung besteht also darin, dass ein Ereignis durch ein vorhergehendes Ereignis vollständig kausal bestimmt sein muss. Ist dies nicht der Fall, dann ist das folgende Ereignis reiner Zufall (vgl. Brüntrup 2012b, 197). Für jedes Ereignis in der kausal lückenlos geschlossenen Welt gibt es dann genau eine physikalische Ursache. Wenn die Welt derart kausal geschlossen ist und es für jedes Ereignis genau eine physikalische Ursache gibt, dann können mentale Entitäten logischerweise kausal nicht wirksam sein. Dagegen haben wir aber besonders aus unserer Alltags- und Selbsterfahrung die starke Intuition, dass mentale Entitäten beispielsweise immer dann wirksam sind, wenn wir eine Entscheidung treffen (vgl. Brüntrup 2012a, 18 – 20).
Nach dem Hempel-Oppenheim-Schema muss eine Kausalbeziehung zweier Ereignisse nach dem Prinzip eines allgemein gültigen Naturgesetzes funktionieren (vgl. Brüntrup 2012a, 48 – 50). Solche strikten physikalischen Gesetze könnten aber nicht mehr zustande kommen, wenn mentale Ereignisse in das Kausalnetz intervenieren könnten (vgl. Brüntrup 2012a, 48 – 50). Auch das Prinzip der Exklusivität von Kausalerklärungen schafft gewisse Probleme für die mentale Verursachung: „Es kann auch nicht sein, daß es eine vollständige physische Kausalerklärung für ein Ereignis (z. B. eine Körperbewegung) gibt und man darüber hinaus eine zweite davon unabhängige und vollständige mentale Erklärung für exakt dasselbe Ereignis angeben kann“ (Brüntrup 2012a, 49). Aus diesen Gründen gehen der Determinismus und der Mechanismus als Variante des Physikalismus davon aus, dass die physische Welt lückenlos kausal geschlossen ist und es für jedes Ereignis ein physisches Ereignis als Ursache gibt. Hier sind Ursachen Gründe.
3.1.2 Warum die mechanistische Sicht auf Handlung falsch ist
Der Mechanismus ist eine bestimmte Art des physikalischen Determinismus und nimmt eine neurophysiologische Theorie an, die allerdings noch nicht existiert. Sie wäre, wenn es sie gäbe, in der Lage, alle Bewegungen menschlicher Körper, die nicht von äußeren Kräften bewirkt werden, zu erklären und vorherzusagen. Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass der menschliche Körper ein kausales System ist und alle neuronalen Zustände mit den Mechanismen korrelieren, die Bewegungen hervorrufen. Ein Vorgang kann demnach folgendermaßen beschrieben werden: Chemische und elektrische Veränderungen im Nervensystem des Körpers verursachen Muskelkontraktionen, die wiederum Bewegungen verursachen. Der Zusammenhang zwischen neurophysiologischen Zuständen und Bewegungen wird durch Gesetze der Form angegeben: „Whenever an organism of structure S is in...
| Erscheint lt. Verlag | 4.10.2023 |
|---|---|
| Reihe/Serie | ISSN | Quellen und Studien zur Philosophie |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Ethik |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie | |
| Technik | |
| Schlagworte | action theory • Determinism • Determinismus • Free Will • Freier Wille • Handlungstheorie • Metaphysics • Metaphysik |
| ISBN-10 | 3-11-123495-9 / 3111234959 |
| ISBN-13 | 978-3-11-123495-3 / 9783111234953 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich