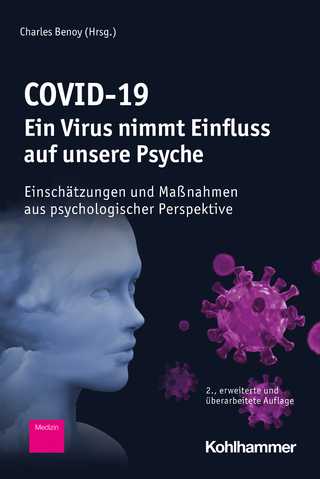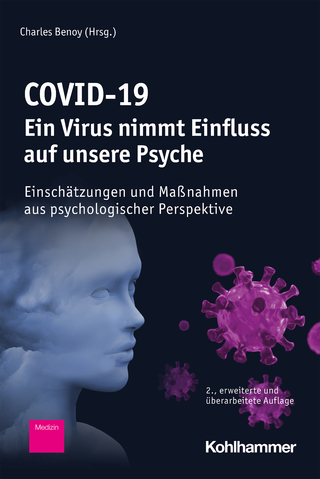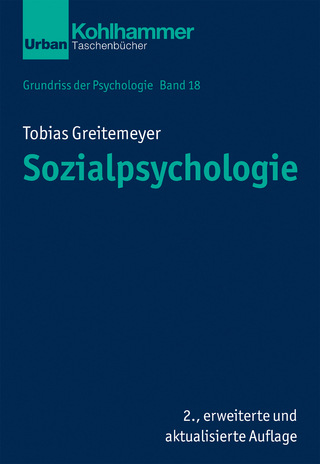Gesunde Gestaltung (eBook)
XX, 626 Seiten
Springer-Verlag
978-3-658-23555-0 (ISBN)
Jonas Rehn ist Designer und Designforscher und lehrt an der Hochschule Darmstadt. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Gebiet der gesundheitsfördernden und verhaltenswirksamen Gestaltung sowie der empirischen Designforschung.
Jonas Rehn ist Designer und Designforscher und lehrt an der Hochschule Darmstadt. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Gebiet der gesundheitsfördernden und verhaltenswirksamen Gestaltung sowie der empirischen Designforschung.
Abstract 5
Keywords 5
Hinweis zu dieser Arbeit 6
Abkürzungen 7
Inhalt 8
Vorwort 15
1 Gesundheitsförderung und Gesundheitsverhaltenswirksamkeit in der Gestaltung 17
1.1 Gestaltung und Gesundheit 18
1.2 Gestaltung und Verhalten 19
1.3 Zentrale Forschungsfrage und -methoden 21
1.4 Gliederung 22
Teil 1 Theoretische Grundlagen 26
2 Evidence-based Design und empirische Designforschung 27
2.1 Die Methodik des Evidence-based Designs 27
2.2 Einordnung dieser Forschungsarbeit 36
3 Medizinische und gesundheitspsychologische Theoriemodelle 39
3.1 Medizinische Theoriemodelle 39
3.1.1 Biopsychosoziales Krankheitsmodell als Beispielparadigma der Pathogenese 40
3.1.2 Salutogenese 43
3.2 Gesundheitspsychologische Perspektive 49
3.2.1 Compliance 50
3.2.2 Commitment 54
3.2.3 Resilienz 57
3.2.4 Kontrollüberzeugung 59
3.2.5 Gesundheitsverhalten 63
3.3 Theoriemodelle der Gesundheitspsychologie 65
3.3.1 Stufenmodelle vs. Prozessmodelle und ihre Implikation für die Designtheorie 66
3.3.2 Health Belief Modell 69
3.3.3 Selbstwirksamkeitserwartung und die sozial-kognitive Theorie nach Bandura 71
3.3.4 Selbstwirksamkeitserwartung als übergreifendes Konzept 82
3.3.5 Transtheoretisches Modell (TTM) 84
3.3.6 Sozial-kognitives Prozessmodell Health action process approach (HAPA) 89
4 Gesundheitsfördernde Gestaltung 95
4.1 Paradigmenwechsel in der Gestaltung im therapeutischen Kontext 96
4.2 Methodiken der gesundheitsfördernden Gestaltung 99
4.2.1 Healing Environments 102
4.2.2 Evidence-based Design 112
4.2.3 Biophilic Design 124
4.2.4 Psychosocially Supportive Design 134
4.2.5 Salutogenes Design 145
4.3 Das Forschungsgebiet der gesundheitsfördernden Gestaltung 153
5 Gesundheitsverhaltenswirksame Gestaltung 155
5.1 Verhaltenswirksamkeit der Gestaltung 155
5.1.1 Affordanztheorie und „perceived affordances“ 161
5.1.2 Ansätze der Ergonomie 165
5.1.3 Ansätze der Konsumentenpsychologie, der Verhaltensökonomie und des Neuromarketings 177
5.1.4 Experience Design 191
5.1.5 Interaktive Systeme und die Captology 200
5.1.6 Verhaltenswirksamkeit durch die Materialität physischer Objekte. Embodiment, embodied cognition, haptisches Designund physical intelligence 203
5.1.7 Design with Intent / Architecture of Control 206
5.1.8 Behavior Settings 209
5.2 Wirkung der Gestaltung auf das Gesundheitsverhalten 213
5.2.1 Aktivitätssteigerung durch Gestaltung 215
5.2.2 Veränderung des Informationsverhaltens durch Gestaltung 218
5.2.3 Veränderung von Einstellungen und Problembewusstsein durch Gestaltung 220
5.2.4 Veränderung von Patientenrollenverhalten 223
5.2.5 Individuelle und spezifische gestalterische Interventionen 225
5.3 Rolle und Stellenwert der GestalterInnen 227
Teil 2 Methodenentwicklung und empirische Überprüfung 230
6 Modelle der gesundheitsfördernden und gesundheitsverhaltenswirksamen Gestaltung 231
6.1 System der gesundheitsfördernden Gestaltung 232
6.1.1 Die Systemkategorien im Einzelnen 238
6.2 Modelle der Gesundheitspsychologie aus designtheoretischer Sicht am Beispiel des sozial-kognitiven Prozessmodells 241
6.3 Das Modell der gesundheitsverhaltenswirksamen Gestaltung 243
6.3.1 Einfluss der Gestaltung auf die Selbstwirksamkeitserwartung 244
6.3.2 Einfluss der Gestaltung auf die Risikowahrnehmung 246
6.3.3 Einfluss der Gestaltung auf die Handlungsergebniserwartung 247
6.3.4 Gestalterische Maßnahmen als situative Barrieren und Gelegenheiten 249
7 Methodik des gestalterischen Placebo-Effektes 253
7.1 Der Placebo-Effekt 253
7.1.1 Geschichte und Hintergrund des Placebo-Effekts 253
7.1.2 Arbeitsdefinitionen der Begriffe „Placebo“ und „Placebo-Effekt“ 254
7.1.3 Erklärungsmodelle zum Placebo-Effekt 256
7.1.4 Der Placebo-Effekt im nicht-medizinischen Kontext 260
7.1.5 Der Placebo-Effekt aus soziologischer Sicht 261
7.2 Der gestalterische Placebo-Effekt 263
7.2.1 Voraussetzungen und Anwendung des gestalterischen Placebo-Effektes 265
7.2.2 Gestalterischer Placebo-Effekt als gesundheitsverhaltenswirksame Gestaltung 269
8 Quantitative Erhebung zum gestalterischen Placebo-Effekt 275
8.1 Forschungsdesign 275
8.1.1 Hintergrund und Methodenauswahl 275
8.1.2 Beschreibung der gestalterischen Intervention 276
8.1.3 Methodenbeschreibung 279
8.1.4 Dimensionen, Operationalisierung und Forschungshypothese 279
8.2 Untersuchungsablauf 285
8.3 Ergebnisse und Auswertung der Erhebung 286
8.3.1 Deskriptive Statistik 286
8.3.2 Inferenzstatistik zum allgemeinen Gruppenvergleich. Ad-hoc Varianzanalyse 289
8.3.3 Inferenzstatistische Untersuchung zum Einfluss klimatischer Parameter. (Sommer-Winter) 290
8.3.4 Inferenzstatistische Analyse der gestalterischen Intervention im Vergleich zwischen E1 und E4 293
8.3.5 Pfadanalyse (mit AMOS) 301
8.3.6 Untersuchung zum Einfluss der Anmutung des Patientenzimmers (Vergleich altes und neues Zimmer) 305
8.3.7 Qualitative Äußerungen 308
8.4 Schlussfolgerung und Diskussion 309
8.5 Weiterer Forschungsbedarf 313
9 Methodik des gestalterischen Priming-Effektes 318
9.1 Theoretische Grundlagen zum Priming 318
9.1.1 Der Priming-Effekt als psychologisches Phänomen 319
9.1.2 Erklärungsmodelle zum Priming-Effekt 323
9.2 Priming als Gestaltungsmethodik 329
9.2.1 Priming und die physische Welt - wissenschaftliche Annäherungen an den gestalterischen Priming-Effekt 330
9.3 Methodik des gestalterischen Primings 351
9.3.1 Chronizität und Aktivierung beim gestalterischen Priming-Effekt 351
9.3.2 Anwendungsbeispiele 354
9.3.3 Implementierung der Methode in den Designprozess 357
10 Empiriegestützte Entwicklung zweier gestalterischer Primes 367
10.1 Ausgangspunkt: Selbstsorge, Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeitserwartung als zu primende Konzepte 369
10.2 Kreativsession als gestalterische Forschungsmethode 372
10.2.1 Ausgangssituation 372
10.2.2 Methodenauswahl 373
10.2.3 Phase 1: Einführung und Vorbereitung 374
10.2.4 Phase 2: Warm-Up 375
10.2.5 Phase 3 und 4: Konzeption von „Welten“ 376
10.2.6 Ergebnisse und Auswertung 377
10.3 Gestalterische Iteration #1: Aktivierung der Selbstwirksamkeitserwartung 379
10.3.1 Zeichnerische Umsetzung 380
10.3.2 CAD-gestützte Umsetzung 384
10.4 Anmutungsforschung mittels Moodboards und dem semantischen Differenzial 387
10.4.1 Gestaltung von acht Moodboards 388
10.4.2 Entwicklung eines semantischen Differenzials 390
10.4.3 Empirische Erhebung und Auswertung des semantischen Differenzials 394
10.5 Gestalterische Iteration #2: Anmutungskonzepte 397
10.5.1 Konzept 2.1 positiv: Holzschreibtisch mit Sitzball 397
10.5.2 Konzept 2.2 positiv: Runder Gruppentisch 398
10.5.3 Konzept 2.3 negativ: Fliesentisch 399
10.6 Embodiment als Faktor des gestalterischen Primings 400
10.6.1 SWE-steigernde Körperhaltungen: Macher und Sieger 401
10.6.2 SWE-verringernde Körperhaltungen: Machtlos und Verlierer 403
10.6.3 Abstraktion der Körperhaltungen 403
10.7 Gestalterische Iteration #3: Definition von Prime und Aufgabe 405
10.7.1 Zeichnerische Konzepte 406
10.7.2 Umsetzung in CAD 408
10.7.3 Freiheitsgrade und Variationen 415
10.8 Empirische Untersuchungen zu Haptik und Materialität 418
10.8.1 Experimental-Design 419
10.8.2 Gestaltung der Stationen 421
10.8.3 Entwicklung des Fragebogens 426
10.8.4 Ergebnisse 428
10.9 Gestalterische Iteration #4 432
10.9.1 Gestalterische Umsetzung des Briefings in sechs Konzepten 434
10.10 Vormodellbau - Überprüfung der Proportionen 439
10.11 Alibi-Design 440
10.11.1 Namensgebung 441
10.11.2 Logo-Entwicklung 442
10.11.3 Gestaltung von Präsentationsmaterial 444
10.12 Gestalterische Iteration #5: Modellbau und Finalisierung der beiden Primes 445
10.12.1 Modellbau und Finalisierung - Negativer Prime 446
10.12.2 Modellbau und Finalisierung Positiver Prime 448
10.13 Darstellung und Erläuterung der beiden Primes 451
10.13.1 Negativer Prime 451
10.13.2 Positiver Prime 456
10.13.3 Überprüfung von Anmutung und Funktionsweise 459
11 Empirische Untersuchung zum gestalterischen Priming-Effekt 460
11.1 Experimental-Design Versuchsaufbau und Struktur des Experimentes 461
11.1.1 Versuchsaufbau 461
11.1.2 Forschungshypothesen 469
11.1.3 Erhebung A: Physiologie – Pulsoximetrie 470
11.1.4 Erhebung B: Fragebogen 473
11.1.5 Erhebung C: Auswahl Gewinnspiel 480
11.1.6 Erhebung D: Auswahl Belohnung 481
11.1.7 Erhebung E: Beurteilung des Pultes 482
11.1.8 Versuchsablauf 482
11.2 Ergebnisse und Auswertung Experiment #1: Hochschule Darmstadt 484
11.2.1 Deskriptive Statistik für das Hochschul-Setting 485
11.2.2 Beurteilung der Pulte 485
11.2.3 Pulsoximetrie 487
11.2.4 Selbstwirksamkeitserwartung ALLWIRK_r 488
11.2.5 Kohärenzgefühl – SOC-L9 489
11.2.6 Resilienz – RS-11 489
11.2.7 Kontrollüberzeugung – KÜ4 490
11.2.8 Quantitative Auswertung zur freien Wortnennung 491
11.2.9 Belohnung – Gewinnspiel 495
11.2.10 Belohnung – direkt 495
11.3 Besonderheiten des Klinik-Settings Experiment #2 497
11.3.1 Grundstruktur 497
11.3.2 Population und Stichprobe 497
11.3.3 Ablauf 498
11.3.4 Debriefing 499
11.3.5 Belohnung 500
11.3.6 Werbung und visuelle Präsenz 501
11.4 Ergebnisse und Auswertung Experiment #2: Klinik-Setting 502
11.4.1 Selbstwirksamkeitserwartung – ALLWIRK_r 503
11.4.2 Kohärenzgefühl – SOC-L9 503
11.4.3 Resilienz (RS-11) und Kontrollüberzeugung (KÜ4) 504
11.4.4 Item 7 - Gesundheitsverhalten 504
11.4.5 Freie Wortnennung 504
11.4.6 Belohnung – direkt 507
11.5 Diskussion 510
12 Diskussion, ethische Aspekte und Ausblick 514
12.1 Definition und Nutzen der Gesundheitsverhaltenswirksamkeit 518
12.1.1 Gesundheitsförderliches Verhalten 518
12.1.2 Interessen der Beeinflussten 520
12.2 Beabsichtigte und unbeabsichtigte Ergebnisse 522
12.3 Absicht, Motiv und Mittel 524
12.4 Systemanalyse und Kosten-Nutzen-Abwägung 526
12.5 Gestaltung zwischen moralischen Maximen und wirtschaftlichem Interesse 526
12.6 Weiterer Forschungsbedarf 528
12.6.1 Wissenschaftlicher Forschungbedarf 529
12.6.2 Ethischer Forschungsbedarf 531
12.6.3 Gestalterischer Forschungsbedarf 533
12.7 Fazit 537
Literaturverzeichnis 539
Internetseiten 590
Teil 3 Appendix 593
Danksagungen 623
| Erscheint lt. Verlag | 6.9.2018 |
|---|---|
| Zusatzinfo | XX, 621 S. 208 Abb. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Psychologie ► Sozialpsychologie |
| Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Psychiatrie / Psychotherapie | |
| Technik ► Architektur | |
| Schlagworte | Designmethodik • Design und Gesundheit • empirische Designforschung • Evidence-Based Design • Gesunde Gestaltung • Gesundheitsfördernde Gestaltung • Gesundheitsförderung • Gesundheitsverhaltenswirksame Gestaltung • Medical Design • Placebo-Effekte • Priming-Effekte • Psychosocially-supportive Design • Salutogenic Design |
| ISBN-10 | 3-658-23555-1 / 3658235551 |
| ISBN-13 | 978-3-658-23555-0 / 9783658235550 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 23,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich