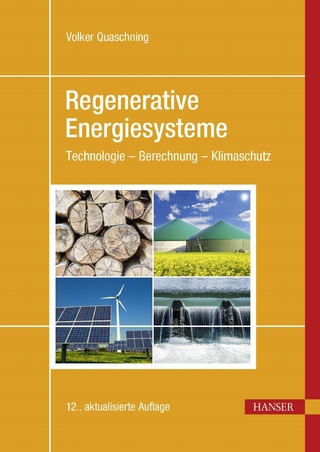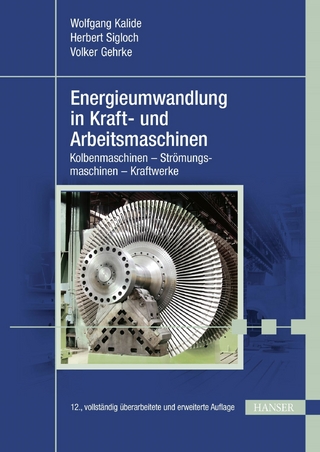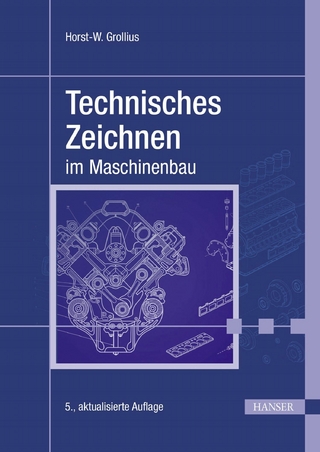Zahnrad- und Getriebetechnik (eBook)
754 Seiten
Carl Hanser Fachbuchverlag
978-3-446-46976-1 (ISBN)
Dieses Grundlagenwerk gibt einen umfassenden Überblick über das Maschinenelement Zahnrad und sein Wirkungsfeld, das Getriebe. Es führt in sämtliche Bereiche der Getriebetechnik ein - von der Auslegung über die Herstellung und Untersuchung von Zahnradgetrieben bis zu Simulationsmethoden für deren Einsatzverhalten und Fertigung. Das Buch richtet sich an Studierende des Maschinenbaus, spricht aufgrund seiner aktuellen Anwendungsbeispiele und Forschungsergebnisse aber auch erfahrene Konstrukteur:innen und Fertigungsingenieur:innen an.
Folgende Themen werden behandelt:
- Grundlagen der Verzahnung und Verzahnungsarten: Verzahnungsgesetz, Stirnradverzahnungen, Kegelradgetriebe, Beveloidverzahnungen
- Verfahren der Getriebeentwicklung: Konzeptionierung, Auslegung und Optimierung von Zahnradgetrieben (inklusive Anforderungen für die Elektromobilität)
- Fertigungsverfahren von Zahnradgetrieben sowie damit verbundene Anforderungen und Randbedingungen
- Methoden der Getriebeuntersuchung zur Gewährleistung eines optimalen Einsatzverhaltens (Tragfähigkeit, Akustik, Wirkungsgrad)
- Simulationsmethoden zur Getriebeauslegung und -fertigung anhand des digitalen Zwillings
Das Buch zeichnet sich durch seinen ganzheitlichen Analyseansatz aus. Dieser ermöglicht es, die Auslegung und Fertigung sowie das Funktionsverhalten von Zahnradgetrieben integrativ zu erklären, zu optimieren und unter Funktions- und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu bewerten.
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. Dr. h.c. Fritz Klocke war von 1995 bis 2018 Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie (IPT) sowie Direktoriumsmitglied des Werkzeugmaschinenlabors WZL der RWTH Aachen, an dem er auch den Lehrstuhl für Technologie der Fertigungsverfahren innehatte.
Inhalt 7
Vorwort 17
1 Einführung 19
1.1 Geschichte des Zahnrads 20
1.2 Einteilung der Getriebetechnik 23
1.3 Gestufte Zahnradgetriebe 25
2 Grundlagen der Verzahnung 29
2.1 Das Verzahnungsgesetz 30
2.2 Stirnradverzahnungen 32
2.2.1 Arten der Stirnradverzahnungen 32
2.2.1.1 Zykloidenverzahnungen 33
2.2.1.2 Triebstockverzahnungen 34
2.2.1.3 Kreisbogenverzahnungen 35
2.2.1.4 Wildhaber-Novikov-Verzahnungen 35
2.2.1.5 Evolventenverzahnungen 36
2.2.2 Schrägverzahnungen 37
2.2.3 Erzeugungsprinzip von Evolventenverzahnungen 39
2.2.3.1 Die Evolventenfunktion 39
2.2.3.2 Das theoretische Herstellprinzip des Evolventenprofils 40
2.2.3.3 Das Bezugsprofil 41
2.2.3.4 Das praktische Herstellprinzip des Evolventenprofils 43
2.2.3.5 Räumliche Erzeugung des Flankenprofils 44
2.2.4 Geometrische Größen der Evolventenverzahnung 45
2.2.4.1 Modul und Teilung 45
2.2.4.2 Zähnezahl und Übersetzungsverhältnis 47
2.2.4.3 Eingriffswinkel und Überdeckungsgrad 48
2.2.4.4 Durchmesser 51
2.2.4.5 Profilverschiebung und Achsabstand 53
2.2.4.6 Lückenweiten, Zahndicken und Zahnweiten 58
2.2.5 Kontaktbedingungen zylindrischer Stirnräder 63
2.3 Kegelradgetriebe 64
2.3.1 Zahnprofile und Erzeugungsprinzip 65
2.3.2 Flankenlinie 69
2.3.3 Geometrische Größen 70
2.3.3.1 Mittlerer Modul und Spiralwinkel 72
2.3.3.2 Eingriffswinkel und Profilüberdeckung 73
2.3.3.3 Zahnhöhenverlauf, Zahndicke und Zahnweite 74
2.3.3.4 Profilverschiebung 76
2.3.3.5 Besonderheiten der Hypoidverzahnung 77
2.3.4 Kontaktbedingungen von Kegelradverzahnungen 79
2.4 Beveloidverzahnungen 79
2.4.1 Erzeugungsprinzip von Beveloidverzahnungen 81
2.4.2 Geometrische Größen von Beveloids 83
2.4.2.1 Konuswinkel 83
2.4.2.2 Eingriffs-, Schrägungswinkel und Überdeckungsgrad 84
2.4.3 Kontaktbedingungen von Beveloidverzahnungen 87
3 Getriebeentwicklung 97
3.1 Vorauslegung von Zahnradgetrieben 98
3.1.1 Konzeptionierung von Zahnradgetrieben 101
3.1.2 Auslegungsziele von Zahnradgetrieben 108
3.1.3 Vordimensionierung von Stirnradstufen 110
3.1.4 Vordimensionierung von Planetenstufen 120
3.2 Optimierung der Makrogeometrie 126
3.2.1 Akustische Optimierung durch Hochverzahnungen 128
3.2.2 Tragfähigkeitsorientierte Auslegung asymmetrischer Verzahnungen 134
3.2.3 Auslegung wirkungsgradoptimierter Low-Loss-Verzahnungen 138
3.2.4 Rechnergestützte Makrogeometrieoptimierung 140
3.3 Auslegung der Verzahnungsmikrogeometrie 142
3.3.1 Arten von Korrekturen 144
3.3.2 Topografieseparation durch Polynome 148
3.3.3 Auslegung funktionaler Modifikationen 149
3.3.3.1 Variantenrechnung 149
3.3.3.2 Berücksichtigung verfahrensbedingter Verschränkungen in der Mikrogeometrieauslegung 151
3.3.3.3 Toleranzfeldbasierte Mikrogeometrieoptimierung 152
3.3.3.4 Anwendungsbeispiel für toleranzfeldbasierte Mikrogeometrieauslegung 155
3.3.4 Inverse Ermittlung optimaler Sollkorrekturen 156
3.3.5 FE-basierte Auslegung von Kopfrücknahmen 158
3.4 Auslegung von Beveloidverzahnungen 162
3.5 Auslegung von Kegelradverzahnungen 167
3.5.1 Bestimmung der Tragfähigkeit 169
3.5.2 Auslegung der Mikrogeometrie 171
4 Herstellverfahren 185
4.1 Prozessketten und Wärmebehandlung 188
4.1.1 Prozessketten der Zahnradfertigung 188
4.1.2 Übliche Zahnradwerkstoffe 190
4.1.3 Wärmebehandlung von Zahnrädern 191
4.1.3.1 Gefügebestandteile von Stahlwerkstoffen 191
4.1.3.2 Glühverfahren 193
4.1.3.3 Härten, Anlassen und Vergüten 194
4.2 Vorverzahnen 203
4.2.1 Anforderungen an das Vorverzahnen 203
4.2.2 Schneidstoffe und Beschichtungen 206
4.2.3 Wälzverfahren 215
4.2.3.1 Wälzhobeln 216
4.2.3.2 Wälzfräsen 217
4.2.3.3 Wälzstoßen 230
4.2.3.4 Wälzschälen 234
4.2.4 Formschneidverfahren 237
4.2.4.1 Formfräsen 237
4.2.4.2 Räumen 241
4.2.5 Verfahrensvergleich 244
4.2.6 Entgraten und Anfasen 245
4.3 Weichfeinbearbeitung mit definierter Schneide 247
4.3.1 Anforderungen an die Weichfeinbearbeitung 248
4.3.2 Zahnradschaben 249
4.3.3 Fertigwälzfräsen 254
4.4 Hartfeinbearbeitung 258
4.4.1 Hartfeinbearbeitung mit geometrisch bestimmter Schneide 258
4.4.1.1 Schälwälzfräsen 258
4.4.1.2 Schälwälzstoßen 260
4.4.1.3 Hartwälzschälen 260
4.4.2 Hartfeinbearbeitung mit geometrisch unbestimmten Schneiden 262
4.4.2.1 Der Abrichtprozess 262
4.4.2.2 Aufbau und Zusammensetzung von Werkzeugen mit geometrisch unbestimmten Schneiden 268
4.4.2.3 Verfahren zur Hartfeinbearbeitung mit geometrisch unbestimmten Schneiden 274
4.5 Erzeugung von Zahnflankenmodifikationen 295
4.5.1 Erzeugung von Profilmodifikationen 296
4.5.2 Erzeugung von Flankenmodifikationen 297
4.5.3 Entstehung von verfahrensbedingten Verschränkungen 298
4.5.3.1 Verfahrensbedingte Verschränkung beim Profilschleifen 301
4.5.3.2 Verfahrensbedingte Verschränkung beim kontinuierlichen Wälzschleifen 302
4.6 Alternative Fertigungsverfahren 303
4.6.1 Endkonturnahe Fertigungsverfahren 304
4.6.1.1 Querwalzen von Verzahnungen 304
4.6.1.2 Taumelpressen 307
4.6.1.3 Pulvermetallurgische Herstellung von Zahnrädern 308
4.6.1.4 Additive Herstellung von Zahnrädern 313
4.6.1.5 Feinschneiden 315
4.6.1.6 Verfahren des Massivumformens zur Herstellung von Verzahnungen 319
4.6.2 5-Achs-Fräsen von Verzahnungen 322
4.7 Qualitätsprüfung und Analyse fertigungsbedingter Produkteigenschaften 327
4.7.1 Bauteilprüfung 327
4.7.2 Geometrische Prüfung von Verzahnungen 328
4.7.2.1 Erfassung der makrogeometrischen Verzahnungsabweichungen 328
4.7.2.2 Erfassung der mikrogeometrischen Abweichung 346
4.7.3 Metallografische Analyse von Verzahnungen 352
4.7.3.1 Zerstörungsfreie Prüfverfahren 353
4.7.3.2 Zerstörende Prüfverfahren 364
4.8 Kegelradherstellung 376
4.8.1 Diskontinuierlich teilendes Kegelradfräsen 377
4.8.2 Kegelradschleifen 379
4.8.3 Kontinuierlich teilendes Kegelradfräsen 380
4.8.4 Kegelradläppen 381
4.8.5 Optimierungsansätze für die Werkzeug- und Prozessauslegung 383
4.8.6 Kegelradverzahnmaschinen 384
4.8.6.1 Mechanische Kegelradfräsmaschinen 384
4.8.6.2 6-Achs-Universal-Fräsmaschinen 386
4.8.7 Der Closed Loop 388
4.8.8 Analogieversuche für die Kegelradfertigung 389
5 Untersuchung von Zahnradgetrieben 415
5.1 Beanspruchungs- und Schadensformen an Zahnrädern 416
5.1.1 Beanspruchung des Zahnfußes 417
5.1.2 Beanspruchung der Zahnflanke 419
5.1.2.1 Pressung im Zahnflankenkontakt 420
5.1.2.2 Beanspruchung in Folge der Kinematik 422
5.1.3 Zahnflankenschäden 425
5.1.3.1 Graufleckigkeit 427
5.1.3.2 Grübchenbildung 429
5.1.3.3 Fressen 433
5.1.3.4 Abrasivverschleiß 434
5.1.3.5 Zahnflankenbruch 435
5.1.4 Zahnfußschäden 437
5.1.4.1 Gewaltbruch 437
5.1.4.2 Dauerbruch 438
5.2 Einflussgrößen auf die Beanspruchbarkeit von Zahnrädern 440
5.2.1 Werkstoff 441
5.2.2 Schmierstoff 444
5.2.3 Oberflächengestalt 446
5.2.4 Randzoneneigenschaften 452
5.3 Untersuchung der Zahnradtragfähigkeit 454
5.3.1 Prüfstandkonzepte – Laufversuch 456
5.3.1.1 Zwei-Wellen-Verspannungsprüfstände 457
5.3.1.2 Drei-Wellen-Verspannungsprüfstände 459
5.3.1.3 Hochdrehzahl-Verspannungsprüfstände 461
5.3.1.4 Standardisierte Prüfverzahnungen für Tragfähigkeitsuntersuchungen 462
5.3.2 Prüfstandkonzepte – Analogieversuch 465
5.3.2.1 Zahnfußtragfähigkeit 466
5.3.2.2 Zahnflankentragfähigkeit 470
5.3.3 Schadenskriterien und Vorgehensweisen 476
5.3.4 Auswertemethoden für Zahnradtragfähigkeitsuntersuchungen 479
5.3.4.1 Statistische Grundlagen zur Zahnradtragfähigkeitsauswertung 481
5.3.4.2 Wöhlerdiagramm: Auswertung der Dauerfestigkeit 483
5.3.4.3 Wöhlerdiagramm: Auswertung der Zeitfestigkeit 488
5.3.4.4 Quantifizierung der Schmierstofftragfähigkeit 491
5.3.5 Übertragbarkeit zwischen Lauf- und Analogieversuch 498
5.3.5.1 Zahnfußtragfähigkeit 498
5.3.5.2 Zahnflankentragfähigkeit 502
5.4 Grundlagen der Getriebeakustik 506
5.4.1 Bewertungskenngrößen 507
5.4.1.1 Spektrale Zusammensetzung des Schalls 507
5.4.1.2 Kennwerte der Technischen Akustik 509
5.4.1.3 Zahneingriffsfrequenz und Ordnungsspektrum 511
5.4.1.4 Spektralanalyse von Getriebegeräuschen 512
5.4.2 Getriebegeräusche 514
5.4.2.1 Objektive Einteilung von Getriebegeräuschen 515
5.4.2.2 Subjektive Bewertung 517
5.4.3 Anregungsmechanismen im Zahneingriff 525
5.4.3.1 Parameteranregung 527
5.4.3.2 Stoßanregung 529
5.4.3.3 Weganregung 530
5.4.3.4 Einfluss von geometrischen Abweichungen 531
5.4.4 Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschabstrahlung 536
5.5 Untersuchung der Getriebeakustik 541
5.5.1 Untersuchungsmethoden 541
5.5.1.1 Einflankenwälzprüfung 541
5.5.1.2 Zweiflankenwälzprüfung 545
5.5.1.3 Drehbeschleunigungsmessung 546
5.5.1.4 Körperschallmessung 554
5.5.1.5 Luftschallmessung 559
5.5.1.6 Sondermessverfahren 565
5.5.1.7 Alternative Methoden zur Messung der Geräuschemission 574
5.5.2 Prüfstandkonzepte 578
5.5.2.1 Radsatzuntersuchung 578
5.5.2.2 Gesamtgetriebeuntersuchung 585
5.6 Wirkungsgradbestimmung von Getrieben 588
5.6.1 Verlustleistungsmessung 590
5.6.2 Leistungsdifferenzmessung 591
5.6.3 Reibkraftmessung im Analogieversuch 594
6 Simulationstechnik 615
6.1 Vorgehensweise zur Modellbildung 615
6.2 Fertigungssimulation 618
6.2.1 Grundlagen von Fertigungssimulationen 618
6.2.1.1 Werkzeug 620
6.2.1.2 Maschinenkinematik 621
6.2.2 Geometrieberechnung 624
6.2.3 Simulationsmethoden 626
6.2.3.1 Durchdringungsrechnung 627
6.2.3.2 FE-Simulation 629
6.2.4 Simulationsgestützte Modellierung 632
6.2.4.1 Spanungskenngrößen 632
6.2.4.2 Modellierung der Zahnspankraft 635
6.2.4.3 Modellierung der Spanverformung 639
6.2.4.4 Verschleißanalyse für die spanende Fertigung 640
6.2.4.5 Bestimmung von charakteristischen Fertigungsabweichungen 645
6.2.4.6 Bezogenes Zeitspanungsvolumen, Kraftberechnung und Energieeinbringung beim kontinuierlichen Wälzschleifen 646
6.2.4.7 Digitaler Zwilling in der Zahnradfertigung 655
6.3 Zahnkontaktanalyse 657
6.3.1 FE-basierte Zahnkontaktanalyse 659
6.3.1.1 Geometrievorgabe 660
6.3.1.2 Kontaktfindung und lastfreie Verzahnungskennwerte 661
6.3.1.3 FE-Strukturgenerierung 662
6.3.1.4 Verschiebungseinflusszahlen 662
6.3.1.5 Mathematisches Federmodell 664
6.3.1.6 Lastverteilung und Kennwerte unter Last 667
6.3.2 Auslegung mit der Zahnkontaktanalyse am Beispiel der Zahnfußoptimierung 670
6.3.3 Mikrogeometrische Kontaktanalyse mit realen Oberflächenstrukturen 673
6.4 Höherwertige Berechnungsverfahren für die Zahnradtragfähigkeit 676
6.4.1 Methode zur Berechnung der lokalen Zahnfußtragfähigkeit 679
6.4.1.1 Vergleichsspannung und Überlebenswahrscheinlichkeit für den Zahnfuß 680
6.4.1.2 Erweiterung der Methode um eine Fehlstellenanalyse 684
6.4.1.3 Validierung und Anwendung der Methode 686
6.4.1.4 Übertragung der Methode auf die Berechnung der Zahnflankenbruchtragfähigkeit 688
6.4.2 Methode zur lokalen Wälzfestigkeitsberechnung 690
6.4.2.1 Volumen- und Oberflächenbeanspruchung im Wälzkontakt 692
6.4.2.2 Werkstofffestigkeit im Wälzkontakt 693
6.4.2.3 Vergleichsspannung und Überlebenswahrscheinlichkeit für den Wälzkontakt 695
6.4.2.4 Validierung der lokalen Wälzfestigkeitsberechnung 697
6.5 Dynamik des Zahneingriffs 699
6.5.1 Mathematische Beschreibung der Anregungsmechanismen im Zahneingriff 700
6.5.1.1 Der Einmassenschwinger als vereinfachtes Ersatzmodell von Verzahnung und Zahnradpaar 701
6.5.1.2 Parametererregung 702
6.5.1.3 Weganregung 705
6.5.1.4 Stoßanregung 707
6.5.1.5 Reibkraftanregung 708
6.5.1.6 Kippmomente 709
6.5.1.7 Rechnerische Abbildung des Dämpfungsverhaltens 709
6.5.2 Aufbau von Schwingungsmodellen 710
6.5.2.1 Ziele und Aufgaben der Modellbildung 711
6.5.2.2 Abbildung von Strukturkomponenten 712
6.5.2.3 Dynamikmodell eines einstufigen Getriebes 715
6.5.3 Entwicklung und Berechnung der mathematischen Ersatzmodelle 719
6.5.4 Methoden der Körperschall- und Luftschallberechnung 721
6.5.4.1 Zahnkraftpegel 722
6.5.4.2 Methoden der Körperschallberechnung 723
6.5.4.3 Methoden der Luftschallberechnung 724
Index 741
| Erscheint lt. Verlag | 8.12.2023 |
|---|---|
| Zusatzinfo | Komplett in Farbe |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Technik ► Maschinenbau |
| Schlagworte | Getriebeentwicklung • Getriebefertigung • Getriebesimulation • Getriebeuntersuchung • Konstruktionselemente • Maschinenelemente • Zahnradauslegung • Zahnradberechnung • Zahnradgetriebe • Zahnradherstellung • Zahnraduntersuchung |
| ISBN-10 | 3-446-46976-1 / 3446469761 |
| ISBN-13 | 978-3-446-46976-1 / 9783446469761 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 98,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich