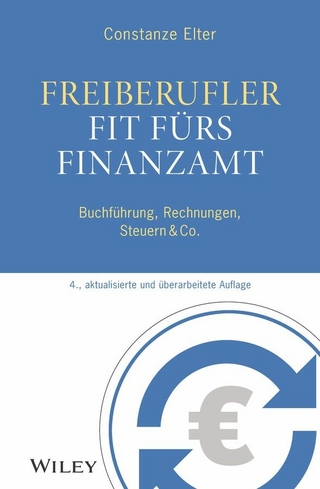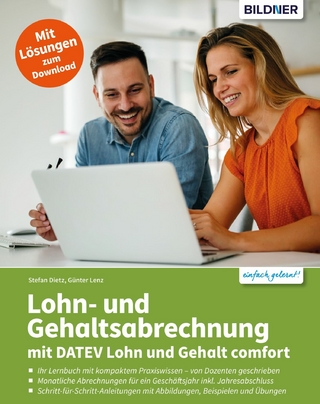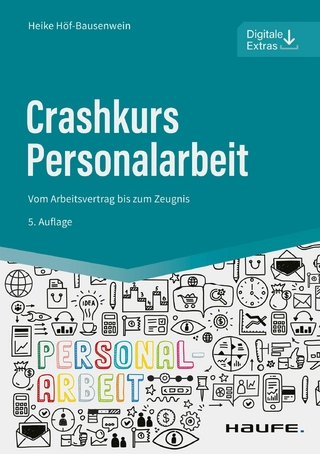Agile Personalauswahl - inkl. Arbeitshilfen online (eBook)
175 Seiten
Haufe Verlag
978-3-648-09601-7 (ISBN)
Tim Riedel ist Trainer und Berater für das Thema Personalgewinnung im Kontext von Globalisierung, Vielfalt und Innovation. Mit seinem Unternehmen interpool (interpool-hr.com) gestaltet er Personalauswahl- und Recruitingprozesse, Assessment- und Development-Center. Im Rahmen seines Studiums der Rechts- und Sozialwissenschaften verbrachte er über ein Jahr in Jordanien, was ihn auch heute noch sehr mit der Region des Nahen Ostens verbindet.
Tim Riedel Tim Riedel ist Trainer und Berater für das Thema Personalgewinnung im Kontext von Globalisierung, Vielfalt und Innovation. Mit seinem Unternehmen interpool (interpool-hr.com) gestaltet er Personalauswahl- und Recruitingprozesse, Assessment- und Development-Center. Im Rahmen seines Studiums der Rechts- und Sozialwissenschaften verbrachte er über ein Jahr in Jordanien, was ihn auch heute noch sehr mit der Region des Nahen Ostens verbindet.
1 Eine kleine Entwicklungsgeschichte der Eignungsdiagnostik
Warum wählen wir aus? Die Antwort scheint offensichtlich: Weil wir unter mehreren Bewerberinnen und Bewerbern diejenigen identifizieren möchten, die am besten auf eine Stelle passen. Im Auswahlgespräch versuchen wir darum Erkenntnisse über die Kandidaten zu gewinnen, die uns eine Prognoseentscheidung über das zukünftige Verhalten und die zukünftige Leistung der Person auf der Zielposition erlauben.
Hierfür benötigen wir allerdings eine Reihe von Informationen und wir müssen einige Annahmen treffen:
-
Wir müssen wissen, welche Anforderungen auf der Zielposition zu bewältigen sind und welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften man dazu benötigt.
-
Wir müssen uns fragen, anhand welcher Kriterien oder Verhaltensweisen wir im Auswahlprozess erkennen wollen, ob diese Fähigkeiten etc. vorhanden sind.
-
Wir müssen annehmen, dass diese Fähigkeiten usw. relativ stabil sind und nicht so einfach auf der Zielposition selbst erlernt werden können.
-
Und wir müssen schließlich die richtigen Fragen oder Aufgaben stellen, um damit ein realistisches und valides (d. h. vorhersagegenaues) Bild der vorhandenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften im Auswahlprozess zu erzeugen.
1.1 Vorstellungsgespräche 1.0: beliebig und intuitiv
In der frühen Phase der Personalauswahl und oft auch heute noch wurden und werden unstrukturierte und unvorbereitete Vorstellungsgespräche geführt, die eher einem persönlichen Kennenlernen als einer bewussten Evaluation der gesuchten Fähigkeiten etc. dienten. Man verlässt sich zunächst auf formale Qualifikationen (oder auch auf persönliche Empfehlungen) in Bezug auf die Eignung der Bewerber für die zu bewältigende Arbeit. Im Einstellungsgespräch versucht man dann lediglich, auf der Basis von allgemeiner Menschenkenntnis und Erfahrung ein Gefühl für die Integrität und für die menschliche Passung der Kandidaten zu gewinnen.
In der Praxis führt dies allerdings dazu, dass die Interviewer oft mehr reden als die Bewerber, dass die gestellten Fragen lückenhaft und ohne Bezug zur Zielposition sind, dass die Interviewer selber nicht wissen, warum sie bestimmte Fragen eigentlich stellen und dass die Auswahlentscheidung darum in der Regel unbewusst anhand sehr allgemein definierter Attribute wie „Angemessenheit der Reaktion auf die Interviewer (Responsiveness)“, „Zuverlässigkeit“, „Freundlichkeit“ und „Emotionale Kontrolle“ erfolgt (Dipboye et al., 2012). Letztlich haben die persönliche Chemie zwischen Interviewern und Kandidaten, Ähnlichkeitseffekte und oft auch Zufälle einen größeren Einfluss auf die Bewertung als die eigentlichen Kompetenzen und Potenziale der Bewerber. Die Validität, also die Prognosegenauigkeit solcher Gespräche in Bezug auf die spätere berufliche Leistung ist entsprechend gering.
1.2 Vorstellungsgespräche 2.0: strukturiert und objektiv
Um hier gegenzusteuern, entwickelte die Arbeits- und Organisationspsychologie seit den 1970er Jahren zunehmend ausgefeilte Konzepte, wie durch einen Zuwachs an Vorbereitung und Struktur die Treffsicherheit von Vorstellungsgesprächen erhöht werden kann. Hierzu gehört dann zum einen eine klare Ausrichtung der Fragen an einem im Vorfeld mit wissenschaftlichen Methoden generierten Anforderungsprofil. Darüber hinaus soll eine Standardisierung der Fragen (alle Kandidaten bekommen die gleichen oder fast die gleichen Fragen) genauso zu einer Vergleichbarkeit der Auswahlergebnisse beitragen wie eine Standardisierung der Antwortbewertungen (verschiedene Antwortalternativen werden im Vorfeld bewertet oder es werden zumindest Verhaltensbeschreibungen für die gewünschten Kompetenzen vorformuliert).
In diesem Kontext wurde und wird auch heute noch in der Wissenschaft diskutiert, ob z. B. Small Talk und ein bewusster Beziehungsaufbau („rapport building“) mit den Kandidaten das Auswahlergebnis verfälschen, weil dann unstrukturiert gewonnene Eindrücke in die Bewertung einfließen. Auch ob individuelle Nachfragen der Interviewer – oder Rückfragen durch die Kandidaten – während des strukturierten Einstellungsgesprächs erlaubt sein sollen, obgleich sie doch die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gefährden, ist in der Forschung noch umstritten (Levashina et al., 2014).
Die deutlich höhere Prognosekraft strukturierter Vorstellungsgespräche wurde inzwischen in so vielen Metaanalysen bestätigt, dass Autoren wie Hufcutt und Culbertson (2011) schon von „The Paramount Role of Structure“ im Interviewprozess sprechen: „Wenn man eine Auswahl an Wissenschaftlern und Praktikern fragen würde, welche einzelne Entwicklung den größten Einfluss auf den Interviewprozess und seine Ergebnisse gehabt hat, dann würde eine Mehrheit ohne Zweifel antworten, dass es die Strukturiertheit des Vorstellungsgesprächs ist“ (S. 194, eigene Übersetzung). Allerdings ist bis heute unklar, welche Elemente eines strukturierten Interviews die größte Relevanz für die Prognosegenauigkeit besitzen, und ob so viele Bestandteile wie möglich umgesetzt werden sollten, um eine möglichst hohe Validität zu erreichen. Hufcutt und Culbertson schreiben dazu: „Obgleich es keine magische Zahl an Komponenten der Strukturiertheit für ein ideales Vorstellungsgespräch gibt, und obwohl es unklar ist, welche, falls überhaupt, den größten Unterschied machen, darf man annehmen, dass es umso besser ist, je mehr Komponenten zum Einsatz kommen“ (S. 195).
Natürlich gibt es auch in diesem Modell der Personalauswahl 2.0 Abstufungen in der Lehre. So enthält das Konzept des „Multimodalen Interviews“ des deutschen Wissenschaftlers Heinz Schuler bewusst eine Kombination strukturierter und unstrukturierter Elemente. Die Validität des Vorstellungsgesprächs wird hier neben der Strukturiertheit des Prozesses durch die Verbindung verschiedener diagnostischer Zugänge erhöht (Schuler und Mussel, 2016, S. 53ff.3). Sein Kollege Werner Sarges lehnt eine weitgehende Standardisierung des Interviews mit Verweis auf die Unterschiedlichkeit der Bewerber sogar vollständig ab und fordert stattdessen eine sehr individuelle und ausdifferenzierte biografische Fragetechnik im Vorstellungsgespräch ein, um damit auch die Facetten in den Stärken und Schwächen der Kandidatinnen diagnostisch sichtbar machen zu können (Sarges, 2013).
Allen Ansätzen gemein ist aber der Wunsch, eine möglichst hohe Reliabilität (Wiederholbarkeit) und Objektivität (Unabhängigkeit von den Interviewenden) im Prozess dadurch zu erzeugen, dass man die Subjektivität der Beobachter durch ein Mehr an Struktur zurückdrängt. Je mehr sich die Auswählenden an einen im Vorfeld definierten Prozess halten, so der Gedanke, und je besser sie sich vorab auf einen gemeinsamen Bewertungsmaßstab für die gesuchten Fähigkeiten etc. geeinigt haben, desto weniger wird sich ihre subjektive und emotionale Betrachtung der Kandidatinnen als „schmutzende Störquelle“ (Obermann, 2013, S. 188) verfälschend auf ihre Auswahlentscheidung auswirken.
Dieses an sich schlüssige Motiv – und der damit einhergehende Kampf gegen die „sture Beharrung auf Intuition und Subjektivität“ in der Praxis (Highhouse, 2008) – hat allerdings dazu geführt, dass die Nachteile von zu viel Struktur im Auswahlprozess in der Literatur kaum diskutiert werden. In dem Bestreben, die Interviewenden in den Unternehmen endlich von ihren „unstrukturierten Interviews der alten Couleur“ abzubringen, deren Aussagekraft „kaum besser als ein Münzwurf“ ist (Kanning, 2015a), wird alles vermieden, was den Eindruck erwecken könnte, dass sich eine starre Struktur in der Personalauswahl auch problematisch auswirken kann. Doch es gibt neben einigen methodischen Fragezeichen (vgl. z. B. Riedel, 2016, Dipboye et al., 2012 oder van Iddekinge et al., 2006) vor allem vier Gründe, die ein Umdenken oder zumindest ein Weiterdenken in Bezug auf das Thema Struktur in der Eignungsdiagnostik nahelegen:
-
Ein zentrales Defizit der Personalauswahl 2.0 ist zunächst, dass sich die Praxis schlicht nicht daran hält. Der oben bereits zitierte Osnabrücker Wirtschaftspsychologieprofessor Uwe Kanning, der sich viel mit der Praxis in der Personalauswahl befasst hat (Kanning 2015a, 2015b), beschrieb dies zuletzt in der Zeitschrift Human Resources Manager mit den Worten: „Pro Jahr erscheinen mehr als 700 wissenschaftliche Publikationen zum Thema Personalauswahl, von denen so gut wie nichts in der Praxis ankommt.“ (Kanning, 2016).
Die Frage, warum die Praxis aber von so viel Strukturiertheit im Einstellungsinterview nichts wissen will und warum sie auf ihr Bauchgefühl als wichtige Entscheidungshilfe beharrt, damit befasst er sich nicht. In zwei qualitativen empirischen Studien dazu (Apelojg, 2002, Kleebaur, 2007) wurde deutlich, dass die Gründe hierfür keinesfalls nur Trägheit und Ignoranz sind. Stattdessen widerspricht zum einen eine solch mechanistische und vergleichsweise starre Form der Gesprächsführung schlicht der Lebenswelt der Interviewenden. Wie alle Menschen möchten sie in einem Gespräch mit anderen Menschen (d. h. in diesem Fall den Bewerbern) diese in einem sozialen Prozess kennenlernen, also sich näher kommen und auch emotional wahrnehmen können. Nicht zuletzt ist es ja auch die Form – und die Kompetenz – des sozialen Austauschs, die später mitentscheidend für den Integrationserfolg auf der Zielposition sein wird.
Zum anderen glauben die Interviewenden in den Unternehmen auch nicht daran, dass man in einem...
| Erscheint lt. Verlag | 11.5.2017 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Haufe Fachbuch |
| Verlagsort | Freiburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
| Schlagworte | Agilität • eBook • E-Book • e-pdf • epdf • E-Pub • EPUB • Globalisierung • Innovation • Personalauswahl • Stellenbesetzung • User Stories • Vorstellungsgespräch |
| ISBN-10 | 3-648-09601-X / 364809601X |
| ISBN-13 | 978-3-648-09601-7 / 9783648096017 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 736 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich