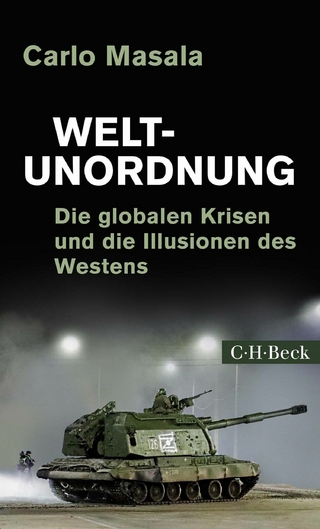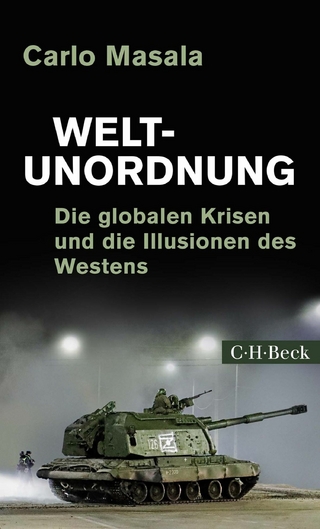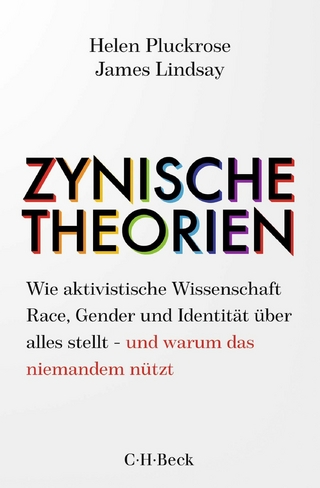Die kalte Wut (eBook)
360 Seiten
Büchner-Verlag
978-3-96317-942-6 (ISBN)
Jürgen Große (geb. 1963) ist promovierter Historiker und habilitierter Philosoph; er lebt als freier Publizist in Berlin. Sein Interesse gilt den dunklen Seiten der europäischen Geistesgeschichte, vor allem den Sonderwegen der Deutschen, so in »Der Tod im Leben. Philosophische Deutungen von der Romantik bis zu den ?life sciences?« (2008, 2017), »Philosophie der Langeweile« (2008), »Ernstfall Nietzsche. Debatten vor und nach 1989« (2010), »Fünf Zeitbilder. Geschichtsphilosophische Glossen« (2010), »Der beglückte Mann. Posterotische Meditationen« (2015, 2022), »Die Sprache der Einheit. Ein Fremdwörterbuch« (2019), »Der sterbende Gott. Agnostische Anmerkungen« (2020), »Der Glaube der anderen. Ein Weltbilderbuch« (2021), »Die kreative Klasse. Nachrichten aus Winkel, Szene und Betrieb« (2022).
Jürgen Große (geb. 1963) ist promovierter Historiker und habilitierter Philosoph; er lebt als freier Publizist in Berlin. Sein Interesse gilt den dunklen Seiten der europäischen Geistesgeschichte, vor allem den Sonderwegen der Deutschen, so in »Der Tod im Leben. Philosophische Deutungen von der Romantik bis zu den ›life sciences‹« (2008, 2017), »Philosophie der Langeweile« (2008), »Ernstfall Nietzsche. Debatten vor und nach 1989« (2010), »Fünf Zeitbilder. Geschichtsphilosophische Glossen« (2010), »Der beglückte Mann. Posterotische Meditationen« (2015, 2022), »Die Sprache der Einheit. Ein Fremdwörterbuch« (2019), »Der sterbende Gott. Agnostische Anmerkungen« (2020), »Der Glaube der anderen. Ein Weltbilderbuch« (2021), »Die kreative Klasse. Nachrichten aus Winkel, Szene und Betrieb« (2022).
PROLOG: Ressentiment-Alarm!
TEIL A: Theorie
I Französische Moralisten
II Friedrich Nietzsche
III Max Weber und Max Scheler
IV Ludwig Klages
V Emil Cioran
ZWISCHENBILANZ: Passion der gefährdeten Mitte?
TEIL B: Praxis
I Provinzverachtung und Metropolendünkel
1. Der Hof und die Stadt
2. Kopien des Zentrums
3. Antizentralismus
4. Zurück in die Provinz
5. Entwurzelung, Entgrenzung, Enthemmung
II Besitzgier und Statusneid
1. Egalitarismus versus Antiegalitarismus
2. Helmut Schoeck – Stardenker des Antiegalitarismus
3. Nach 1990
4. Sloterdijks Zornbankenthese und ihre Kritiker
5. Zangentheoreme
6. Mitte-Miseren oder: Zynismus versus Heuchelei
7. The End of History, revisited
8. Schelers Erbe
III Affektreaktion und Anarchokalkül
1. Ambivalenzen der Réaction
2. De Maistres Groll
3. Theodizee der modernen Geschichte
4. Renouveau catholique: Stolze Armut, grollender Stolz
5. Das deutsche Seitenstück: Carl Schmitt
6. Rechte Reaktionäre und linke Radikale
7. Christliche Repression und atheistische Revolte
8. Anarchie und Apologie der Affekte
9. "Die freie Gesellschaft"
10. Haß auf den Bürger, scheiternde Mitte, Antisemitismus
11. Karl Mannheims Analyse
IV Naturstolz und Kulturleid
1. Emanzipation, Feminismus, Gender
2. Deutungsvorschläge: Nietzsche und Scheler
3. Überdauernde Szenarien
4. Negative Andrologie
5. Die befreite Hausfrau
6. Häusliche Pflichten und bürgerliche Rechte
7. Autonomieverheißung: Entleiblichung und objektiver Geist
8. Simone de Beauvoirs "Welt des Ressentiments": eine Weininger-Reprise?
9. Reconstruction, Repression, Resentment
10. Teil-Ganzes-Ambivalenzen
11. Gleichursprünglichkeit von Gleichheit und Differenz
12. Affektbejahung und Männerhaß
13. Misandrie als sublimierte Christlichkeit
14. Rechtslinkes Ressentimentszenario um 'Gender'
15. Repräsentative Schwierigkeiten, zerbrechliche Synthesen
16. 'Allmachtsfeminismus'
17. Totalitarismus?
V Berufskunst und Bildungsphilisterium
1. Der abhängige Wirtschaftsbürger und der betrogene Berufsautor
2. Frühformen ressentimentaler Selbstreflexion
3. Der intellektuelle Gegenimpuls
4. Unbehagen am genialen Unverstandenen: Spätaufklärung
5. Von der Spätaufklärung zur Frühromantik
6. Philister überall
7. Empfindsame Selbstreflexion und Romantikkritik
8. Klassik, Ganzheit, Souveränität
9. Probleme bürgerlicher Mannwerdung: Von Hegel zu Heine
10. Weltschmerz und Philisterhaß
11. Unbehagen im Biedermeier
12. Kodifikation des Bürgerhasses
13. Flauberts Bekenntnis zur Wut
14. Politische Radikalisierung und poetische Fiktionalisierung der Antibürgerlichkeit: Baudelaire
15. Ein Spätling des Bürgerhasses
16. Der Fall Nietzsche – Musterkonflikt und Wendepunkt
17. Marxistischer Antinietzscheanismus
18. Nazistische Antibürgerlichkeit
19. Liberale Philisterapologie
20. Totalitäre Ressentimentkunst als soziale Anpassungsstörung
21. Stalinistischer Künstler- und Intellektuellenhaß
22. Von der Staatskunst zur Kulturrevolution
23. Sozialaussteiger, Bewußtseinsbefreier, Welterlöser
24. Revolutionäre
25. Umschichtungen
26. Yuppies
27. Expansion und Diffusion des Yuppietums
28. Art of Resentment, State of the Art: Bobo-Kapitalismus
29. Linke Spießer – rechte Ressentiments?
30. Ordnungsliebe
31. Mitteträume
32. Schöpfungsglaube
33. Exkurs: Gegenwartskunst und Publikumsressentiment
34. Triumph und Gefährdung
35. Ausblick
EPILOG: Gefühl zeigen
Literaturverzeichnis
Personenregister
Kapitel I: Französische Moralisten
Der Begriff ›Ressentiment‹ hat eine lange, teils turbulente Geschichte. Heute wird er überwiegend pejorativ wie in Nietzsches Genealogie der Moral benutzt. Doch Nietzsche war nicht der erste, der sich als Denker und Autor dem Ressentiment zugewandt hatte. Seine Vorläufer waren Schriftsteller der französischen Renaissance und Klassik gewesen. Erst durch den philosophischen Gebrauch, den Nietzsche vom Ausdruck ressentiment machen sollte, wurde dieser stark mit moralischen und metaphysischen Sinnkomponenten überformt und sein negativer Begriff etabliert. In klassischen Dramentexten wie denen von Corneille, Molière und Racine lautet der Wortgebrauch zumeist moralisch neutral. Selbst bei älteren Zeitgenossen Nietzsches wie Sainte-Beuve oder Balzac ist ressentiment nicht um die Gekränktheits- und Racheproblematik zentriert. Es kann auch nur einen besonders intensiven, nachwirkenden Schmerz bezeichnen. Zwar bedeutet den frankophonen Autoren ressentiment zumeist etwas Komplexeres denn spontanes sentiment. Dennoch bleibt der Übergang zwischen beiden psychologisch fließend. Auch ist das ressentir meist an einen konkreten Adressaten gebunden und daher mit gewissen anlaßüberdauernden Leistungen des Gedächtnisses assoziiert. Dies kann ein Gedächtnis für ungesühnten Frevel, aber ebenso positiver Verpflichtung, also Dankbarkeit sein. Was noch völlig fehlt, ist die Idee einer Ab- oder Umleitung des ressentimentalen Affekts in andersgerichtete, vielleicht sogar affektüberdauernde Ausdrucksformen. Begrifflich unbekannt ist folglich auch der ›Ressentimentmensch‹ Nietzsches, Schelers und vieler ihrer Nachfolger, wenngleich gerade die klassische europäische Moralistik gern mit Charaktertypen (der Neider, der Heuchler usw.) gearbeitet hat.
1 Die Anfänge bei Montaigne
Ein deutlich negativer Begriff des Ressentiments als eines ohnmächtigen Schmerzes, der sich mit Rachegedanken verbindet, findet sich in der Versdichtung von Théophile de Viau (1590–1626). Allerdings bleibt dies ohne psychologische Vertiefung. Zum Referenzautor Nietzsches in der Ressentiment-Psychologie wurde der Skeptiker Michel de Montaigne (1533–1592), der ungefähr zwei Generationen vor de Viau schrieb. In seinem Essay Couardise mère de la cruauté fragt Montaigne nach dem Ursprung einer Grausamkeit, die über Rachlust hinausgeht. Er findet ihn in der Feigheit gegenüber einem übermächtigen Gegner, letztlich in der Schwäche. Spontane Rache ist dann unmöglich, und durch ihren Aufschub entsteht ein bewußtes, ›kalt‹ anmutendes Verhalten. Es kann auch einer übergroßen Empfindlichkeit gegenüber Beleidigungen entspringen, die selbst durch Rache nicht zu kompensieren wären. All diese Punkte sind in die Ressentiment-Psychologie Nietzsches eingegangen. Doch gibt es Unterschiede in den Denkmotiven der beiden Autoren. Nietzsche gibt seine Beschreibungen im Rahmen einer breit ausgeführten Lebensmetaphysik, die in seiner Übermenschenlehre kulminiert. Zeit- und kulturkritische Anwendungen mittels Ressentimentpsychologie illustrieren seine These vom gesunden und vom kranken Machtwillen, ja letztlich vom starken und vom schwachen Leben. Montaigne ging von zeitgenössischen Beobachtungen aus.
Als unmittelbaren Zeugen der Konfessionskriege beschäftigen ihn der Verfall der ritterlichen Zweikampfmoral, die »unerhörten Grausamkeiten« des Folterns und Schlachtens, welche er dem Söldnerwesen zuschreibt. Hier gebe, so ein erster Erklärungsversuch Montaignes, der »Abschaum des Volkes« den Maßstab vor. Solche Menschen töteten zum Vergnügen oder ohne Gefühl, weil sie ohnehin außerhalb der sozialen Welt und ihrer moralischen Maßstäbe stünden. Ihr Töten und Foltern sei bestialisch oder gedankenlos, sei deswegen aber kaum plausibel als Befriedigung von Rachedurst. Es bleibt – gerade weil es nicht durch die Hitze des Kampfes motiviert ist! – psychologisch teilweise rätselhaft. Ja, es mutet fast absurd an: »Einen Menschen töten heißt ihn unserm Gegenschlag entziehn.« (344)21 Auch durch kalkuliert zugefügten »Schmerz zur Reue« bringen kann man den Gegner dann nicht mehr. In derartigen Gedanken Montaignes artikuliert sich eine christlich-chevalereske Gefühlswelt, die Nietzsche seelisch verschlossen war (und die erst wieder beim »katholischen Nietzsche« Max Scheler eminent wird). Das »kalte« Töten kann vernünftig sein: Wer als Tyrann alle möglichen Widersacher ausrottet, handelt zwar »der Ehre zuwider«, trägt so aber Sorge um »sein eigenes Leben« (ebd.). So fließend wie die Grenzen zwischen dem ›kalten‹, strategisch-kalkulierten Töten einerseits und strategieloser Grausamkeit andererseits sind auch ihre Beschreibungen bei Montaigne. Anscheinend ungeordnet überläßt er sich zeitgenössischen Berichten und Erlebnissen, Binsenweisheiten, Klassikerreminiszenzen und philosophischem Räsonnement. Am Ende des Essays stehen Referate antiker und moderner Folter des Leibes. »Alles, was über die einfache Tötung hinausgeht, scheint mir schiere Grausamkeit.« (347)
Hier spricht – zunächst – ein (früh)moderner Humanist. Montaigne beurteilt die am Leibe des Unterworfenen ausgekostete Rache genau konträr zur seelischen Folter. Seelische Folter durch Erweckung von Reue hält er weder für unritterlich noch für unchristlich. Montaignes Gedanken dazu umschreiben das gut evangelische Glutkohlensammeln auf dem Haupte des Widersachers, der aktuell an Macht überlegen sein mag, jedoch nicht an Moralität. Ebenso nüchtern wie die Vor- und Nachteile der Folter erwägt Montaigne aber auch Abweichungen von der ritterlichen Zweikampfmoral. »Lediglich im Kräfteverhältnis zu Beginn des Treffens ist eine etwaige Ungleichheit gebührend zu berücksichtigen; danach gilt: Nutze jeder sein Kriegsglück!« (344) Kämpfe, bei denen nicht mehr die eigene Ehre oder das eigene Leben betroffen ist, sondern in denen man als Söldner oder Sekundant agiert, dürften zwar noch dem Rachegedanken verpflichtet bleiben, doch sollte dieser nicht überschäumen. Das gebiete schon die militärische Vernunft. Man kann also grausam scheinen und doch kühlen Blutes, ja gemäß rationalen und moralischen Standards handeln!
Montaignes reflexive Unbefangenheit widerspiegelt ethische und religiöse Ambivalenzen der Frühneuzeit. Im Übergang von ritterlichen Ehrenhändeln zu konfessionellen und territorialen Staatenkonflikten schichtete sich auch das individuelle Vernunft-Affekt-Verhältnis um, differenzierte und hierarchisierte sich das Seelenleben neu. Selbstachtung, Respekt vor dem Feind und Bedenken des eigenen Vorteils zeigen sich bei Montaigne in ihrem neuen, beweglichen Gefüge. Sie werden durch diesen Autor kühl gegeneinander abgewogen. ›Ressentiment‹ bedeutet hierbei mehr als der Neid oder der Haß in christlichen Lasterkatalogen. Es hat, durch das freiere Bedenken moralischer und machtstrategischer Komponenten, an sachlicher Eigenart gewonnen. Ressentiment ist nicht länger nur unbeherrschbarer Affekt, sondern Gegenstand rationaler Erwägung. Das unterscheidet Montaignes Zugriff von jenem des spanischen Moralisten Balthazar Gracian (1601–1658), einem Autor zwischen chevaleresker Renaissance und höfischer Verhaltenslehre des Barock. Gracians Kunst der Weltklugheit enthält manche Hinweise, wie man Kränkungen des sozialen Selbstgefühls abfangen und sogar umleiten könne, resigniert jedoch hinsichtlich des Racheproblems. »Vergessen können« lautet der Rat des Spaniers.22
Bei Montaigne hingegen ist schon die Eskalationsspirale der Rachsucht mitbedacht: Wer sich umgehend rächen kann und das ohne weitere Erwägung tut, erweckt die dann vielleicht unwägbare Rachlust des ursprünglichen Angreifers (»le hazard de son ressentiment«)! Er bezahlt temporäre seelische Entlastung mit dem Risiko einer existenzbedrohenden Dauergekränktheit auf der Gegenseite. »Alles zu seiner Zeit!« heißt der Nachfolgeaufsatz in Montaignes Essais.
2 La Bruyère
Montaigne hatte das, was Spätere als ressentiment diskutieren werden, in einer Zwischenzone von Empfinden und Verhalten, von Handlung und Handlungsinterpretation gefunden. Augenscheinlich mußte dieser frühe französische Moralist hierfür nicht eine quälende Selbsterfahrung verarbeiten. Montaignes Beobachtungen am Ressentiment sind nicht primär diejenigen eines Intellektuellen, gar eines Berufsdenkers, der ständig mit dem Mißverhältnis zwischen geistigem Machtanspruch und faktischer Ohnmachtserfahrung zu ringen hat. Montaigne war Gelegenheitsdenker, ein Ämterbesitzer und Gutsherr, dem ésprit weder erst zu kulturellem Einfluß noch gar zu Selbstachtung, zu sozialem Stolz verhelfen mußte. Ein deutlicher Unterschied zu den Moralisten der folgenden Jahrhunderte! Jean de la Bruyère (1645–1696), der seelisch stabilste unter ihnen, ist gleichwohl eine erste Autorität in Sachen Ressentiment und Ressentimenterfahrung geworden. Die Rolle des Denkers nicht mehr als Häretiker einer geistlichen, sondern als Außenseiter der weltlichen Macht beginnt sich bei ihm abzuzeichnen, mithin auch ein zuvor nicht bekannter Komplex von Stolz, Frustration und Gekränktheit. La Bruyère schrieb als Zeitgenosse Ludwigs XIV., Bossuets, Malebranches, Racines, Boileaus, im siebzehnten, dem ›klassischen Jahrhundert‹ Frankreichs. Anders als der bittergewordene Frondeur La Rochefoucauld entstammte La Bruyère einer Bürgerfamilie, kannte das Gefühl sozialer Unterordnung bei sicherer geistiger Überlegenheit –...
| Erscheint lt. Verlag | 20.3.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | Marburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Abstiegsangst • Bobos • Bürgerliche Gesellschaft • Emil Cioran • Emotionstheorie • Feminismus • Friedrich Nietzsche • Gefühlspolitik • Gleichheitsideen • Identitätspolitik • Kulturlinke • Ludwig Klages • Max Scheler • Max Weber • Mentalitätsgeschichte • Michel de Montaigne • Modernisierungsverlierer • Nachbürgerlichkeit • Political Correctness • Provinzialismus • Reaktionäres Denken • Ressentiment • Simone de Beauvoir • Sozialneid |
| ISBN-10 | 3-96317-942-2 / 3963179422 |
| ISBN-13 | 978-3-96317-942-6 / 9783963179426 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 712 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich