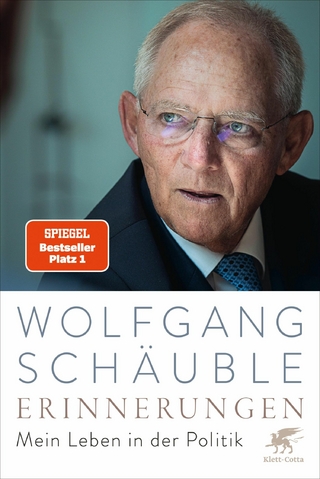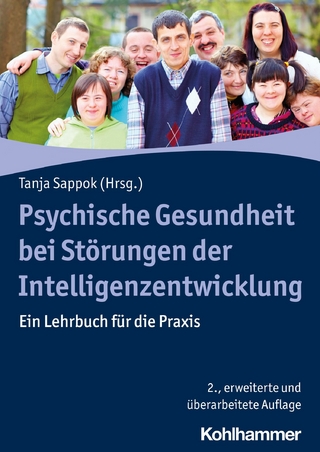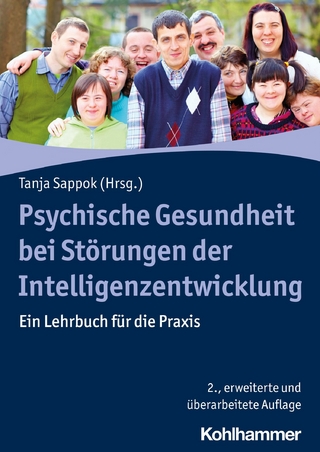Trotzdem sprechen (eBook)
224 Seiten
Ullstein (Verlag)
978-3-8437-3222-2 (ISBN)
Träume
Maryam Zaree
Seit fast vier Monaten sind meine Träume ein Ort der Trauer, der Verzweiflung und manchmal auch der Hoffnung gewesen. Ich bin mehrere Male tränenüberströmt aufgewacht, verstört und aufgelöst von der erträumten Erfahrung.
Träume miteinander zu teilen, bedarf immer auch Vertrauen und Überwindung. Umso mehr überrascht es mich, wenn Menschen ablehnend reagieren, sobald andere von ihren Träumen erzählen.
Sicher, der Psychoanalyse sind Träume das tägliche Brot, und anders als Freud fand C. G. Jung in ihnen sogar Einblicke in das kollektive Unbewusste. Ich erlebe aber viel häufiger, wie Menschen schnelle Einigung darüber finden, dass ihnen etwas zugemutet wird, das wirr, langweilig und letztlich privater Natur ist.
Ich hingegen freue mich, wenn man mit mir die eigenen Träume teilt. Ganz ohne religiöse oder spirituelle Einfühlungsgabe wird einem Eintritt gewährt in das Irrationale, Metaphysische, Ungefilterte, und manchmal finden sich darin sogar Symbole und Mythologisches wieder. Vor allem aber finde ich sie oft sehr lustig – und politisch sind sie meist auch.
Auf die Gefahr hin, dass die Leser:in dieses Textes zur Gruppe der Ablehnenden der Traum-Erzählung gehört, hier eine kleine Vorwarnung: Ich werde von zwei Träumen erzählen, die mich seit dem 7. Oktober aufgesucht haben. Ausgehend vom Subjektiven und Intuitiven werde ich mich auf die Suche nach kollektiven und politischen Zusammenhängen machen.
In meinem ersten Traum saß ich mit zwei Personen an einem Tisch. Wir waren an einer Uni und kurz davor, in eine Art Nebengebäude einzubrechen. In unserer Nähe hielt sich eine weitere Person auf. Die Person war deutsch, weiß und überprüfte, worüber wir sprachen. Wir saßen zunächst nur stumm da, bis mir das als zu auffällig erschien und ich ein Gespräch zu erfinden begann. Etwas Belangloses, was aber den Anschein machen sollte, als wären wir wirklich in ein Gespräch vertieft. Der Plan, den Verdacht von uns wegzulenken, gelang, und die uns beobachtende Person ging. Doch die improvisierte Unterhaltung nahm plötzlich eine unerwartete, ernste Wendung. Wir kamen auf die Shoah zu sprechen.
Meinem Freund, der in meinem Traum queer war und Eltern hatte, die aus demselben Land wie zwei meiner Eltern geflohen waren, war es ein Anliegen, mich darauf hinzuweisen, dass es im Holocaust auch andere Opfergruppen als nur die Juden gegeben habe. Der indirekte Vorwurf, dass ich das unterschlagen hätte, machte mich wütend. Es ist mir selbstverständlich klar, dass es auch andere Opfergruppen gegeben hat, und Teil meiner aktuellen Arbeit ist, fügte ich rechtfertigend hinzu, die Auseinandersetzung mit den sogenannten »Euthanasie«-Opfern. Es ist absurd, mir das vorzuwerfen, rief ich empört, denn es muss doch gleichzeitig möglich sein, anzuerkennen, dass der industrialisierte Massenmord an den europäischen Juden Kernziel der Naziideologie gewesen ist.
Mein Argument hatte leider nicht die erhoffte Wirkung und prallte an meinem Gegenüber ab. Wie mir schien, war ihm der Fokus auf diese größte Opfergruppe ein Dorn im Auge. Das Gespräch setzte sich noch ein wenig fort, und es gesellten sich immer mehr Leute dazu, die sich darin einig waren, dass es an der Zeit sei, sich nicht mehr so sehr mit den jüdischen Opfern zu beschäftigen.
Es ist schwierig, den folgenden Moment zu beschreiben, denn es gab keinen weiteren verbalen Auslöser für das, was jetzt aus mir herausbrach. Mein Freund und Gegenüber guckte mich nur an, siegesgewiss und mit einer Kälte im Blick, die mir das Blut gefrieren ließ. Ich fing an, haltlos zu weinen, und der Gedanke, der meine Tränen befeuerte, wiederholte sich: Es ist ihm egal, was diesen Menschen millionenfach angetan wurde. Für ihn tragen die Juden Schuld an dem fehlenden Erinnern an andere Menschheitsverbrechen, und die Zeit war gekommen, ihnen das heimzuzahlen. Ich wachte von meinem Schluchzen und dem Vibrieren meines Telefons auf.
Ich bin zurzeit in Los Angeles in der Künstler:innen-Residenz der Villa Aurora, im Haus von Lion und Marta Feuchtwanger, die ab 1943 bis zu ihrem Tod hier im Exil lebten. Lion, der deutsch-jüdische Schriftsteller, galt Joseph Goebbels als »der ärgste Feind des deutschen Volkes«, und nur durch eine geglückte Flucht konnten Marta und er in Los Angeles ein neues Zuhause finden. Fast genau achtzig Jahre später schlafe ich im Originalbett von Lion, was mich nach wie vor selbst ungläubig macht. Martas Bett steht im Zimmer nebenan. Über all die Jahre ihrer langen Beziehung hinweg unterstützte und arbeitete sie mit Lion als seine Lektorin und Kritikerin. Der Blick aus meinem Fenster ist überwältigend, man schaut über das Tal direkt auf die Weiten des Pazifiks.
Ich frage mich oft, wie es für die beiden hier nach ihrer Flucht gewesen sein muss. Umgeben von dieser Schönheit der Natur und so weit weg von ihren Familien und Freund:innen. Sicherlich auch in ständiger Sorge, ob sie denn überleben würden? Sie hatten kein Telefon, das nächste war unten am Strand, im heutigen Restaurant Gladstones. Wie müssen sie da immer wieder aufs Neue hingeeilt sein? Mit welchen Nachrichten liefen sie den Berg wieder hinauf? Was waren das für Gespräche, musste man sich schnell noch das Wichtigste sagen, und was ist überhaupt das Wichtigste in solchen Momenten? Hatten sie Zeit, einander Trost und Mut zuzusprechen? Sie waren hier ja völlig abgeschottet, und auch wenn andere Exilant:innen nicht weit weg wohnten, gehörten sie alle zu denjenigen, die es geschafft hatten zu fliehen, die überlebt hatten. Die Schuldgefühle müssen schwer gewogen haben. Gladstones, der Name lässt mich an die Steine denken, die man auf jüdische Gräber legt, um der Verstorbenen zu gedenken, und daran, wie viele keine Gräber hatten. »Glad to have survived, stones to remember those who didn’t«, reime ich mir zusammen.
Noch aufgewühlt von der Nacht, blicke ich auf mein Telefon. Darauf die Nachricht: »Heute ist der Tag der Befreiung von Auschwitz.« Zur Nachricht hinzugefügt: ein Zitat von Charlotte Delbo, die zu ihrer Befreiung aus dem Frauen-KZ Ravensbrück die unendlich traurigen Sätze schrieb: »Die Welt war schön, wieder gefunden worden zu sein. Schön und entvölkert.«
Zurück zu meinem Traum und dem Versuch einer Deutung: Mir scheint, die derzeitigen Diskussionen um die Singularität und Vergleichbarkeit des Holocausts, deutsche Erinnerungspolitik, das unerträgliche Massaker der Hamas und die noch immer festgehaltenen Geiseln sowie die andauernde, desaströse humanitäre Katastrophe in Gaza haben ihren Weg in meinen Traum gefunden. Die Themen haben sich verschoben, vermischt und liegen verknotet ineinander.
Ich will sie auseinanderfädeln, doch ich empfinde Widerstand dabei zu erwähnen, dass derjenige, mit dem ich in meinem Traum den Konflikt austrug, jemand war, mit dem ich gerade dabei war, gemeinsam etwas zu überwinden. Grenzen eines Raumes vielleicht, der für uns nicht vorgesehen war. Musste ich denn ausgerechnet träumen, dass er queer war, kein weißer Deutscher, und auch noch selbst Fluchterfahrung hatte? Was sollte das?
Es widerstrebt mir, das zu erzählen, denn es befeuert ein Narrativ, das ich zutiefst ablehne. Das von den guten, weißen, geläuterten Deutschen, die ihre Nazivergangenheit so großartig bewältigt haben, während »die Ausländer« auf der anderen Seite das Erbe der Shoah nicht so vorbildhaft wie die Nachfahren der Täter:innen begriffen haben. Vom Kuchen des Deutschseins sollen deshalb jetzt bitte schön nur diejenigen etwas abbekommen, die Sühne leisten für ihren »importierten Antisemitismus«.
Natürlich gibt es Antisemitismus, auch in nicht-weißen-deutschen Teilen der Gesellschaft. Als jemand, die sich lange mit der zutiefst antisemitischen, islamofaschistischen Ideologie des iranischen Regimes befasst hat, bin ich alles andere als naiv, was die Auslöschungsfantasien gegenüber Israel und den Judenhass seitens bestimmter Menschen, Länder und Terrororganisationen, auch hierzulande, betrifft. Dringend brauchen wir ernst zu nehmende Konzepte und langfristige Strategien, um dieser Menschenverachtung entgegenzuwirken.
Dennoch halte ich es für sehr gefährlich, das Problem des Antisemitismus in Deutschland immer wieder auf rassifizierte Menschen, die teils in zweiter oder dritter Generation in diesem Land zu Hause sind, abzuschieben. Zu oft steckt da eine Agenda dahinter, die keine Debatten oder echte Politik will, sondern Populismus betreibt auf dem Rücken von denen, die ohnehin schon von Ausgrenzung betroffen sind. Mit der Folge, dass man sich in der Mitte der Gesellschaft wieder ermutigt fühlt, althergebrachten rassistischen Ressentiments freien Lauf zu lassen, sich aber gleichzeitig im Dienste des Anti-Antisemitismus glaubt. Erschreckend ist, wie dabei die eigenen tradierten antisemitischen Stereotype weiterhin wirkmächtig bleiben, da man sich ja jetzt darauf verlassen kann, dass sie nur noch bei den »anderen« zu Hause sind.
Zur selben Zeit haben wir es aktuell mit einer rechtsextremen Partei zu tun, die mit dieser stigmatisierenden und entmenschlichenden Haltung Politik macht. Die davon fantasiert, Millionen von...
| Erscheint lt. Verlag | 25.4.2024 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung |
| ISBN-10 | 3-8437-3222-1 / 3843732221 |
| ISBN-13 | 978-3-8437-3222-2 / 9783843732222 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich