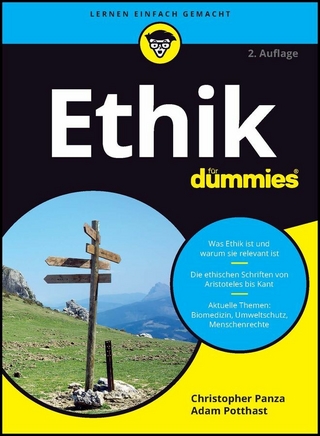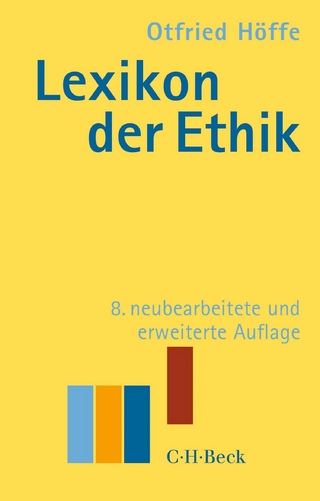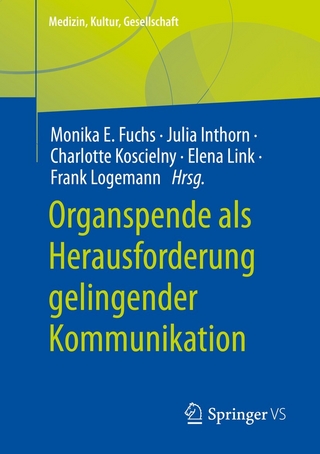Gerechte Freiheit (eBook)
350 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-74098-9 (ISBN)
<p>Philip Pettit, geboren 1945 in Ballygar, Irland, ist Philosoph und Politikwissenschaftler. Nach Stationen am University College in Dublin, an der Cambridge University und der Australian National University ist er heute Laurance S. Rockefeller University Professor of Politics and Human Values an der Princeton University. Er ist seit 2009 Mitglied der American Academy of Arts and Sciences, seit 2010 Ehrenmitglied der Royal Irish Academy und seit 2013 korrespondierendes Mitglied der British Academy. Zudem war Pettit unter anderem auch als Berater der spanischen Regierung unter José Luis Zapatero tätig. Für sein in viele Sprachen übersetztes Werk hat er zahlreiche Auszeichnungen und Ehrendoktorwürden erhalten.</p>
Kapitel 1
Vergangenheit und Gegenwart der Freiheit
Wann ist man frei?
Eine gängige Metapher suggeriert, dass man dann frei ist, wenn man bei seinen Entscheidungen freie Hand hat. Wenn man all die Spielräume oder Bewegungsfreiheit besitzt, die man sich nur wünschen kann, wenn man einen Freibrief hat, selbst zu bestimmen, wie man handeln will, dann genießt man nach dieser Vorstellung Freiheit im höchsten Maße. »Freie Hand lassen« oder im Englischen die Wendung »giving free rein« stammt vom Reiten her. Wenn ein Reiter die Zügel schießen lässt, kann das Pferd frei laufen: es kann in eine beliebige Richtung gehen. Wenn einem freier Lauf gegeben wird, so suggeriert die Metapher, kann man jeden Weg einschlagen, den man sich aussucht: Man untersteht niemandes wirksamer Kontrolle.
Ein wenig Überlegung legt allerdings nahe, dass »die Zügel schießen lassen« vielleicht das Beste verkennt, was wir von der Freiheit erwarten können, und zwar sowohl für das Pferd als auch für den Menschen. Wenn ich einem Pferd die Zügel freigebe, benutze ich sie nicht dazu, es zu lenken, und ich lasse die Zügel auch nicht deshalb locker, weil das Pferd zufällig in eine Richtung geht, die mir gefällt. Ich lasse das Pferd gehen, wie es will, weil ich keine Präferenz habe, was die Richtung angeht.2 Während ich dem Pferd seinen Willen lasse, indem ich die Zügel schießen lasse, bleibe ich weiter im Sattel, bin bereit, jederzeit die Zügel anzuziehen, sollten sich meine Wünsche ändern. Ich übe zwar keine wirksame Kontrolle über das Pferd aus, aber ich habe die Möglichkeit dazu oder einen Kontrollvorbehalt. Und was für den buchstäblichen Fall gilt, gilt auch für den metaphorischen Fall. Wenn ich jemandem freie Hand lasse, sehe ich wohl davon ab, wirksame Kontrolle auszuüben, aber das Äquivalent zur Kontrolle ist mir weiter vorbehalten. Ich nehme das Pferd nicht an den Zügel, nichtsdestoweniger bleibe ich im Sattel.
Denken wir an den Fall, den wir im Prolog erörtert haben. In Ein Puppenheim wird Nora genau so viel freie Hand gegeben, wie nötig ist, damit sie keiner wirksamen Kontrolle von Seiten Torvalds unterliegt. Nora ist aber nicht in dem Sinne einer Nichtbeherrschung frei, da sie weiter dem Kontrollvorbehalt ihres Ehemanns unterliegt. Sollte es bei Torvald zu einem Sinneswandel kommen oder sollte Nora plötzlich auf eine Weise handeln, die ihm missfällt, dann wird er die Zügel anziehen und ihr seinen Willen aufzwingen.
Wir müssen aber nicht erst ins Theater gehen, um Beispiele für einen solchen Kontrollvorbehalt oder Machtvorbehalt zu finden. Die Obdachlosen, die von der Wohlfahrt abhängen, um ein Bett für die Nacht zu finden, die schwer Erkrankten, die auf die medizinische Behandlung durch die unentgeltlichen Hilfsdienste von Ärzten oder Krankenhäusern angewiesen sind, die Angestellten, deren Weiterbeschäftigung von den Launen ihres Arbeitgebers abhängig ist: all diese Menschen sind in einer Lage, die der von Nora gleicht. Weil sie Glück haben, genießen sie ein Obdach, Arbeit und Auskommen – und sind sogar noch in der Lage, die Grundfreiheiten zu nutzen, die solche Güter voraussetzen –, aber dies verschafft ihnen keine Freiheit als Nichtbeherrschung. Ihnen ist lediglich freie Hand gegeben.
Es ist bezeichnend, dass »free rein«, die Gewährung freier Hand, als Metapher für Freiheit erst im 19. Jahrhundert aufkam und nicht früher. Bis dahin betonte das herrschende Denken über Freiheit, dass man nicht nur der wirksamen Kontrolle anderer entzogen sein müsse, um in jedem Bereich der Wahl frei zu sein, sondern dass auch deren Kontrollvorbehalt nicht bestehen dürfe. In dieser früheren Denkweise war das freie Pferd ein nicht aufgezäumtes Pferd, und nicht etwa eines, dem gerade die Zügel freigegeben waren. Der republikanische Gegner der Monarchie Richard Rumbold muss das im Sinn gehabt haben, als er 1685 in Edinburgh auf dem Schafott stand und auf seine Hinrichtung durch Erhängen wegen Verrats an der Krone wartete. Er erneuerte sein treues Festhalten an der Republik und erklärte: »Ich habe niemals daran geglaubt, dass uns die Vorsehung ein paar Männer in die Welt geschickt hat, die fertig gestiefelt und gespornt zum Reiten antreten, und Millionen fertig gesattelt und gezäumt sind, um geritten zu werden.«
In der älteren Denkweise, auf die sich Rumbold beruft, muss für Freiheit in einer Reihe von Wahlentscheidungen jedwede Form von Kontrolle durch andere ausgeschaltet werden. Die auszuschaltende Kontrolle kann die wirksame Form von Kontrolle sein, in der uns andere gern Beschränkungen auferlegen, sobald dies zur Befriedigung ihrer Wünsche notwendig werden sollte. Es kann sich bei der auszuschaltenden Kontrolle aber auch um die Form des Kontrollvorbehalts handeln, die in der Macht besteht, eine solche wirksame Rolle einnehmen zu können. Wenn ich jemandes Ermessen bei der Wahl einer Option begrenzen kann oder ihm meine Bedingungen vorschreiben kann, wie die Wahl zu treffen ist, habe ich ein gewisses Maß an Kontrollvorbehalt über das, was er tut. Seine Fähigkeit, diese oder jene Option zu wählen, wird vom Stand meines Willens abhängen, ob er so wählen sollte, wie er es wünscht. Wenn ich möchte, dass jemandem sein Ermessen erhalten bleibt, wird er wählen, wie er selbst es will; möchte ich dies nicht mehr, wird er es nicht. In beiden Fällen bleibt er jedoch meinem Willen unterworfen und in diesem Sinne unfrei. Ich bleibe die ganze Zeit im Sattel.
Nach dieser Denkweise kann man nur in dem Grade als freie Person oder freier Bürger gelten, in dem man bei einer Reihe von Wahlentscheidungen, die schon zu Rumbolds Zeit als die fundamentalen oder Grundfreiheiten bekannt waren, sein eigener Herr ist – sui juris, wie es im römischen Recht heißt (Lilburne 1646). Diese Wahlentscheidungen, die im Prinzip jedem Bürger zustanden, schlossen im allgemeinen Verständnis die Entscheidung darüber ein, welche Religion man praktiziert, für was man sich einsetzen will, welchen Vereinigungen man angehören will, wo man wohnen will, wie man seinen Lebensunterhalt bestreiten will und so fort. Dazu werden wir im dritten Kapitel noch einiges zu sagen haben.
Wenn man sich wie Rumbold Freiheit im traditionellen Sinne zu eigen macht und jede Kontrolle von Seiten anderer ablehnt, strebt man die Stellung einer unabhängigen Person an, die keinen Herrn oder dominus in ihrem Leben kennt. Freiheit besteht aus dieser Sicht darin, Wahlentscheidungen treffen zu können, ohne die Erlaubnis eines anderen einholen zu müssen. Diese Art, Freiheit zu artikulieren, lässt sich mindestens bis zu den Römern zurückverfolgen, die mit der Institution vertraut waren, durch die ein Herr oder dominus Macht über seine Sklaven hatte. Sie argumentierten, in potestate domini zu leben, unter der Macht eines Herrn zu leben, reiche an sich schon aus, um eine Person unfrei zu machen. Einen freundlichen Herrn zu haben mochte in anderen Hinsichten ein Segen sein, gab einem aber nicht die Freiheit.
Im Unterschied zum Sklaven ein liber zu sein – ein freier Mann oder »a freeman«, wie die maßgebliche englische Übersetzung lautete – hieß, im Bereich der Grundfreiheiten sicher zu sein vor der Macht irgendeines Herrn. Man war in dieser Sphäre beim Handeln nach eigenem Ermessen vor der dominatio oder Beherrschung durch andere geschützt. Die Sache, die einem solche Sicherheit verlieh – die Sache, die einem Freiheit als Nichtbeherrschung verschaffte –, war der Status eines civis oder Bürgers, der hinreichend und gleichmäßig durch das Recht geschützt war. Und insbesondere das Innehaben des Status eines Bürgers, der von einem Recht geschützt wird, dessen Kontrolle der Bürgerschaft selbst obliegt und kein Recht ist, das von einem übermächtigen Herrn wie einem König oder einer Aristokratie angeordnet wird. Nach dieser römischen Denkweise ist »vollständige libertas deckungsgleich mit civitas«, wie sich ein Autor ausdrückt (Wirszubski 1968, S. 3); frei sein und ein Bürger sein, sind im Wesentlichen gleichbedeutend.
Wie sollten wir eine politische Philosophie nennen, die sich auf dieses Ideal von Freiheit als Nichtbeherrschung gründet? Weil sie ihre Ursprünge im republikanischen Rom hat und weil sie stets mit der Ablehnung der Monarchie – oder zumindest einer nicht konstitutionell verfassten Monarchie – verbunden blieb, ist der passendste Ausdruck wahrscheinlich »Republikanismus« oder vielleicht »bürgerlicher Republikanismus« (Honohan 2002). Ein Republikanismus in diesem Sinne läuft allerdings auf weit mehr hinaus als bloß auf eine Ablehnung der Monarchie. Und trotz seines Einflusses bei der Gründung der Vereinigten Staaten unterscheidet er sich deutlich von der politischen Partei, die in den USA den Namen »republikanisch« für sich beansprucht.3
Der hier umrissene Republikanismus ist zwangsläufig eine Philosophie, die heutigen Anliegen anspricht, und er gibt die Beiträge einer ganzen Reihe zeitgenössischer Autoren wieder.4 Doch da er versucht, auf einer Idee aufzubauen, die eine lange Geschichte hat, hat er unweigerlich Verbindungen zum republikanischen Denken der Vergangenheit. An verschiedenen Stellen des Buchs werde ich auf die früheren republikanischen Autoren verweisen, und in diesem Kapitel liefere ich zunächst eine kurze Skizze der Entwicklung und des schließlichen Verschwindens dieser Tradition.5 In den nächsten zwei Kapiteln werde ich die Geschichte...
| Erscheint lt. Verlag | 9.5.2015 |
|---|---|
| Übersetzer | Karin Wördemann |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Just Freedom. A Moral Compass for a Complex World |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Ethik |
| Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Philosophie der Neuzeit | |
| Schlagworte | Demokratie • Freiheit • Freiheitsbegriff • Freiheitsverständnis • Gesellschaft • Moral • Sozialphilosophie • STW 2206 • STW2206 • suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2206 • Theorie der Gerechtigkeit • Wahlen |
| ISBN-10 | 3-518-74098-9 / 3518740989 |
| ISBN-13 | 978-3-518-74098-9 / 9783518740989 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich