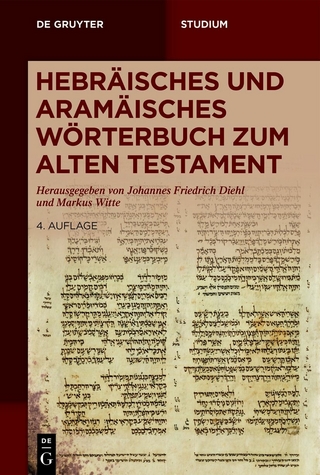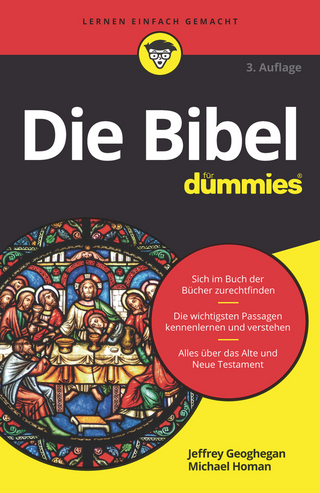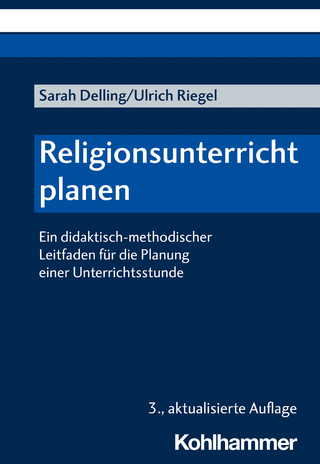Geist & Leben 3/2019 (eBook)
114 Seiten
Echter Verlag
978-3-429-06429-7 (ISBN)
Christoph Beneke, geb. 1956, Dr. theol., Priester der Erzdiözese Wien, in der Studentenseelsorge tätig.
Christoph Beneke, geb. 1956, Dr. theol., Priester der Erzdiözese Wien, in der Studentenseelsorge tätig.
Samuel Lutz | Bern
geb. 1944, Dr. theol., Gemeindepfarrer im Berner Oberland, später Synodalratspräsident der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn
samuel.lutz@bluewin.ch
Zwinglis spiritueller Werdegang
Zum 500. Jubiläum seines Amtsantritts in Zürich
Es gab eine Zeit, da beschäftigte sich die Zwingliforschung intensiv mit der Frage nach der reformatorischen Wende bei Zwingli. Die einen gingen davon aus, dass von einer solchen nicht früher gesprochen werden könne, als ab dem Zeitpunkt, an dem Zwingli zur Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben durchgedrungen sei. Dies aber könne erst erfolgt sein, nachdem Martin Luthers entscheidende reformatorische Schriften im Jahr 1520 erschienen sind: Von des christlichen Standes Besserung – Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche – Von der Freiheit eines Christenmenschen. Unter der Voraussetzung, dass Zwingli seine geistlichen und theologischen Impulse von Martin Luther empfangen habe, wird der zwinglische Durchbruch zur Reformation in die ersten Jahre seiner Tätigkeit als Leutpriester in Zürich gelegt, dies allerdings entgegen Zwinglis eigenen Beteuerungen, er sei unabhängig von Luther zu den für ihn entscheidenden und zur Erneuerung von Kirche und Gesellschaft führenden Erkenntnissen gekommen.
Für die Befürworter einer früheren, unabhängig von Luther erfolgten reformatorischen Wende stand die Frage nach dem Übergang Zwinglis vom Humanismus zur Reformation und damit der Weg Zwinglis in die theologische Eigenständigkeit im Vordergrund. Von Interesse war dabei sein Verhältnis zu Erasmus von Rotterdam, dem er den Zugang zum griechischen Neuen Testament und wesentliche Elemente seiner späteren Christologie zu verdanken hatte, von dem er sich dann aber allmählich zu distanzieren begann. Beide Seiten gingen davon aus, dass es im Werdegang Zwinglis zum Reformator irgendwann einmal, ob früher oder später, zu einem befreienden Durchbruch gekommen sei.
Betrachtet man indessen die Anfänge von Zwinglis Theologie weniger unter den Gesichtspunkten von äußerem Einfluss und innerer Loslösung, sondern spürt Zwinglis spirituellen Erfahrungen nach, so zeigt sich das Entscheidende seines Werdegangs der frühen Jahre nicht als Wende, sondern als Weg einer kontinuierlichen inneren Entfaltung. Diesem spirituellen Werdegang des frühen Zwingli bis zu seinem Amtsantritt vor 500 Jahren als Leutpriester am Großmünster in Zürich soll im Folgenden nachgegangen werden. Es geschieht dies auf Grund von drei auf seine früheren Jahre zurückblickenden Selbstzeugnissen. Das eine bezieht sich auf Zwinglis Amtsjahre als Gemeindepfarrer von Glarus, die beiden andern blicken zurück auf die kurzen drei Jahre, in denen er Leutpriester war im Kloster Maria Einsiedeln. Freilich gilt es dabei zu bedenken, dass Selbstzeugnisse als biographische Quellen mit Vorbehalt zu betrachten sind. Immerhin aber lassen sie Einblick gewinnen in Zwinglis subjektive Sicht, wie er sich selber und seinen spirituellen Werdegang verstanden wissen wollte.
Herkunft und Studium
Zwingli, getauft auf den Namen Ulrich, stammt aus dem oberen Toggenburg, damals Untertanengebiet des Klosters St. Gallen. In Wildhaus auf 1100 Metern über dem Meeresspiegel wird er am 1. Januar 1484 geboren als dritter Sohn des Johann Zwingli und der Margaretha Meili, geborene Bruggmann. Die Zwinglis waren eine wohlhabende und einflussreiche Familie, ein Milieu von Bauernstand, Politik und Gelehrsamkeit in gut kirchlich-katholischer Spiritualität, aber nicht streng-konservativer Tradition.
Als noch nicht ganz sechsjähriger Knabe kommt Ulrich zu seinem Onkel Bartholomäus nach Weesen an den Walensee, Pfarrer und Dekan daselbst. Dieser bringt seinem Neffen Lesen und Schreiben bei und auch schon die ersten Brocken Latein. Ulrich sollte, wie drei seiner Brüder auch, ein Gelehrter werden. Nach fünf Jahren im Pfarrhaus von Weesen wird Zwingli Lateinschüler in Basel. Schon nach zwei Jahren aber schickt sein Lehrer, Gregor Bünzli, den Elfjährigen wieder nach Hause und ermuntert den Vater, er solle seinen Sohn entsprechend seiner Begabung anderweitig unterrichten lassen. Dies geschieht zunächst in Bern, wo Zwingli erstmals mit den lateinischen Klassikern bekannt wird. Wie schon in Basel fällt auch in Bern Zwinglis Musikalität sofort auf. Die Dominikaner wollen ihn als Novizen ins Kloster aufnehmen seiner schönen Stimme wegen. Von einem Klostereintritt jedoch will Zwinglis Vater nichts wissen. Er ruft seinen Sohn aus Bern zurück und entsendet ihn an die damals als Hochburg des Humanismus berühmte Universität Wien zum Studium der Philosophie.
Der Humanismus bedeutete für die akademische Jugend nördlich der Alpen nicht weniger als die Renaissance in Italien: Eine Bewegung mit einem ganz neuen Menschenbild und Selbstbewusstsein. Das klassische Altertum war im Mittelalter zwar nie in Vergessenheit geraten. Man begann nun aber, die griechischen und römischen Klassiker mit neuen Augen zu lesen, indem man sich mit der griechischen Philosophie und der römischen Geschichtsschreibung und Rhetorik identifizierte. Das gab der Generation, die in diesem Humanismus aufwuchs, ein ganz neues Lebensgefühl, emanzipiert von bisherigen Autoritäten, wie es ein Pico della Mirandola zum Ausdruck gebracht hatte in seiner berühmten Rede über: Die Würde des Menschen, und darin erklärte: „Dem Menschen ist gegeben, das zu sein, was er will.“1 Auch Zwingli hatten den Pico della Mirandola in seiner Bibliothek stehen. Zu einem akademischen Abschluss Zwinglis in Wien kommt es allerdings noch nicht. Er kehrt zurück nach Basel an die Artistenfakultät, wo er anfangs 1506 zum Magister Artium promoviert wird. So ist aus dem Toggenburger Ueli, dem Bauern- und Hirtenbuben, der 22-jährige Meister Ulrich geworden, ein aufgeweckter, weltoffener junger Mann.
Erst nach der Erlangung des Meistertitels nimmt Zwingli das Theologiestudium auf, vornehmlich bei Thomas Wyttenbach, der in Basel zu jener Zeit die scholastische Theologie der via antiqua lehrte im Sinne des Thomas von Aquin. Aus welchen Gründen Zwingli dann allerdings nach nur eineinhalb Jahren das Theologiestudium in Basel abbricht, ist nicht mehr klar ersichtlich. „Je mehr er sich der Theologie widmet“, berichtet Bullinger in seiner Chronik, „desto mehr drängte es ihn zum priesterlichen Amt um zum Volk predigen zu können.“2 Jedenfalls bewirbt sich Zwingli bei seinem Bischof, Hugo von Hohenlandenberg in Konstanz, um die Ordination, wird zum Priester geweiht und liest 1506 in Wildhaus, dem Dorf seiner Herkunft und Familie, erstmals die heilige Messe.
Ebenfalls 22-jährig, nur ein Jahr zuvor, trat Martin Luther in Erfurt den Augustinern bei. Der eine, von Sündenlast und Höllenangst bedrückt, geht ins Kloster, der andere, weltoffen und voll Tatendrang, ins Pfarramt.
Pfarrer in Glarus
Im Herbst 1506 kommt Zwingli als junger Priester nach Glarus und trägt als Ortspfarrer der Gemeinde den Titel des Kilchher zuo Glaris. Glarus, der Hauptort eines der dreizehn Orte der alten Eidgenossenschaft, bestand zur damaligen Zeit aus ungefähr 136 Häusern mit rund 1300 Einwohnern. Man könnte die zehn Jahre des Glarner Pfarreramtes für Zwingli als eine Zeit des Suchens bezeichnen, ganz im Sinne, wie Papst Johannes Paul II. schrieb: „Die Suche nach dem Glauben ist selbst eine implizite Form des Glaubens“3, oder wie es Zwingli selbst erlebt: „Die Verlangen danach haben, Gott zu erkennen, denen entzieht Gott sich nicht.“4 Seinen seelsorgerlichen Verpflichtungen kommt Zwingli treu, verlässlich und von der Bevölkerung her betrachtet auch erfolgreich nach. Jedenfalls lässt man zu seinen Ehren und gleichzeitig seiner Verabschiedung auf den silbernen Messbecher Zwinglis Namen eingravieren, in Glarus noch heute zu bewundern: Calix Uly Zwingli 1516.
Das Pfarramt insgesamt versteht und versieht Zwingli im Sinne der traditionell katholischen Frömmigkeit mit allem, was dazugehört, ohne dabei Probleme zu bekommen. Für die zahlreichen Reliquien, die in Glarus’ Besitz waren, trägt er Sorge, er führt Bittprozessionen durch um gutes Wetter, mit den Einnahmen aus einem päpstlichen Sonderablass lässt er eine Kapelle bauen, kurz: Er ist und wird geschätzt als ein guter, volksverbundener Priester.
Innerlich allerdings treiben ihn philosophische und theologische Fragen um, die ihn im Blick auf seine Gemeindeglieder seelsorgerlich, auf Grund intensiv betriebener theologischer und philosophischer Studien aber auch persönlich beschäftigen. Er beschreibt sechs bis acht Jahre später in einer seinem Bischof in Konstanz gewidmeten, erstmals recht umfangreichen lateinischen Schrift, dem sogenannten Archeteles von 1522, wie es ihm seinerzeit ergangen, was ihn geistlich beschäftigt und wie er zu den Erkenntnissen und Erfahrungen gekommen sei, die für ihn prägend geworden sind.
Er habe die Beobachtung und Feststellung gemacht, berichtet Zwingli rückblickend5, dass die Menschen, auch seine Leute in Glarus, selig werden und ihrer Seligkeit gewiss sein wollten. Darum bemühten sie sich, aus Angst vor Fegefeuer und Hölle, alles zu erfüllen, was die Kirche anbietet und fordert. Wer aber kann sagen – dies wird Zwingli mehr und mehr zum Problem –, dass wir als Kirche, auch ich als Pfarrer von Glarus, mit unseren Angeboten und Forderungen, wenn sie denn erfüllt werden, den Menschen die ewige Seligkeit auch garantieren können? „Wir sehen“, schreibt er bekümmert und besorgt, „wie das Menschengeschlecht sich sein ganzes Leben lang um die Erlangung der Seligkeit nach dem Tod ängstigt und sorgt, dass es aber keineswegs allenthalben am Tage liegt, auf welche Weise sie zu finden ist.“ Auf der...
| Erscheint lt. Verlag | 3.7.2019 |
|---|---|
| Verlagsort | Würzburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie ► Christentum |
| Schlagworte | Ignatianisch • jesuitisch • Kontemplation • Mystik • Orden • Spiritualität |
| ISBN-10 | 3-429-06429-5 / 3429064295 |
| ISBN-13 | 978-3-429-06429-7 / 9783429064297 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich