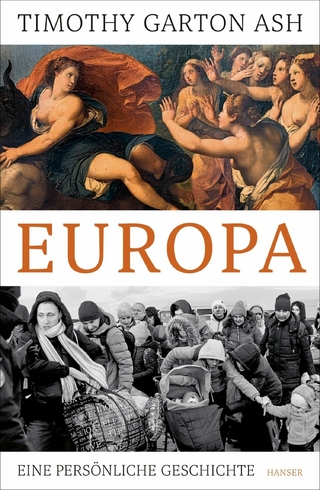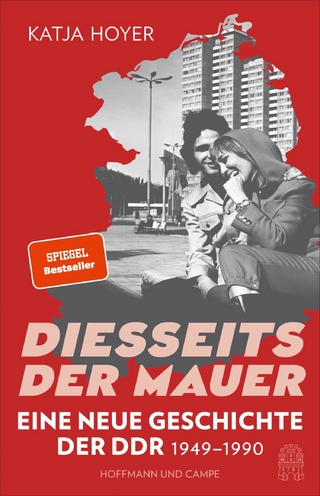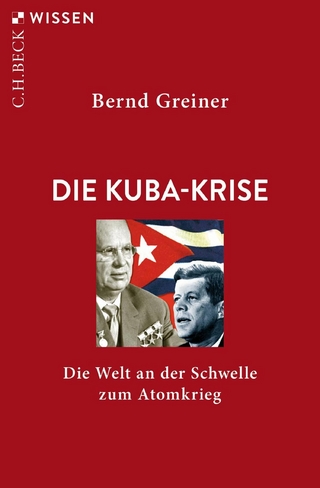Die Kirchen in der DDR (eBook)
129 Seiten
C.H.Beck (Verlag)
978-3-406-76413-4 (ISBN)
Andreas Stegmann ist Privatdozent für Kirchengeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Reformationsgeschichte und der kirchlichen Zeitgeschichte. 2014 wurde er mit dem Martin-Luther-Preis für den wissenschaftlichen Nachwuchs ausgezeichnet.
Einleitung
Die Geschichte der Neuzeit scheint mit einer Entzauberung der Welt einherzugehen, die kaum noch Raum für Religion lässt. Ein Strang der neuzeitlichen Geschichte macht das besonders deutlich: die Geschichte der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts. Gleich ob links- oder rechtstotalitär, gleich in welcher Spielart oder Entwicklungsphase, die Totalitarismen waren religionskritisch und betrachteten die Kirchen als Hindernis auf dem Weg zur gänzlichen Erfassung und Umgestaltung der Gesellschaft. Das zeigte sich in der Sowjetunion seit 1917, im italienischen Faschismus der dreißiger Jahre und im deutschen Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 – und auch in der Sowjetsatrapie auf deutschem Boden, die von 1945 bis 1990 bestand. Wie überall im sowjetischen Machtbereich verbanden sich auch in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) ideologische Religionskritik und Unterdrückung der Kirchen, gehörten doch am Ende des Zweiten Weltkriegs etwa neun Zehntel der Bevölkerung zu einer Kirche und waren die Kirchen und ihre Mitglieder ein ernstzunehmendes Hemmnis bei der Durchsetzung der Diktatur der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED).
Tatsächlich waren die Kirchen die einzigen gesellschaftlichen Akteure in der DDR, die institutionell selbständig und überall präsent waren. Sie hemmten damit den Aufbau und die umfassende Durchsetzung des Sozialismus, die die SED mit großer Energie vorantrieb. Und sie blieben während der ganzen Zeit der SED-Herrschaft ein hemmender Faktor. Gerade in dem Jahrzehnt, als der SED-Staat endlich die Oberhand zu gewinnen und die meisten Kirchen auf eine staatsloyale Linie gebracht zu haben schien, gab es einen kirchlichen Aufbruch, der seinen Teil zur Friedlichen Revolution beitrug. Obwohl die Kirchen in der DDR in den mehr als vierzig Jahren ihrer Konfrontation mit dem Totalitarismus stark geschwächt wurden, haben sie am Ende geholfen, die Geschichte in neue Bahnen zu lenken.
Wenn im Folgenden von den Kirchen der DDR die Rede ist, dann wird damit ein weites und buntes religiöses Feld in den Blick genommen. Die Gesamtzahl an christlichen Religionsgemeinschaften lässt sich nicht genau bestimmen, sind die staatlichen Listen mit gemeldeten Gemeinschaften doch unvollständig, gab es immer wieder Spaltungen und Zusammenschlüsse und lösten sich einige kleinere Gruppierungen im Laufe der Zeit auf. Das Feld der etwa dreißig christlichen Religionsgemeinschaften auf dem Gebiet der DDR wurde vom landeskirchlichen Protestantismus dominiert, zu dem 1945 mehr als vier Fünftel der Bevölkerung und 1990 noch ein Viertel zählten. Die römisch-katholische Kirche war in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR Diasporakirche. Anfangs umfasste sie etwa ein Zehntel der Bevölkerung, später ein Zwanzigstel. Daneben gab es zahlreiche Freikirchen. Die größten unter ihnen mit jeweils mehreren zehntausend Mitgliedern waren die Methodisten und die Baptisten, während die meisten anderen Freikirchen nur auf wenige tausend oder hundert Mitglieder kamen. Ferner gab es noch christliche Sondergemeinschaften, die sich weder als Mitglieder noch als Gäste der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen anschlossen und Distanz zu ihrer Umwelt hielten – eben damit aber auch Menschen anzogen. So hatte die Neuapostolische Kirche mehrere zehntausend Mitglieder und die staatlich verbotenen Zeugen Jehovas mehrere tausend. Auch die Johannische Kirche, die Mormonen oder die Christengemeinschaft zählten zu den größeren Sondergemeinschaften.
Dieses religiöse Feld, zu dem als einzige nichtchristliche Religionsgemeinschaft die nach dem Holocaust stark zusammengeschrumpften jüdischen Gemeinden gehörten, umfasste einen im Laufe der Zeit kleiner werdenden Teil der Bevölkerung: Der Anteil der Konfessionslosen stieg bis zum Ende der DDR von etwa 5 auf fast 70 Prozent. Für die vorliegende Darstellung ergibt sich schon allein aus den Mitgliederzahlen, dass vor allem die Geschichte des landeskirchlichen Protestantismus zu erzählen ist.
Bei jeder Beschäftigung mit der DDR-Geschichte muss man sich klarmachen, dass die «kurzlebige DDR […] nur ‹eine Fußnote der Weltgeschichte› [Stefan Heym]» war, wie der Historiker Hans-Ulrich Wehler zu Recht feststellt (Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 5, 2008, 361). Das gilt auch für die Geschichte der Kirchen in der DDR, die sich unter so besonderen Umständen abgespielt hat, dass sie zwar interessant und lehrreich sein mag, aber eben nur einen Nebenstrang der neuzeitlichen Christentumsgeschichte bildet. Dennoch hat gerade die Geschichte der Kirchen in der DDR großes Interesse auf sich gezogen und ist mittlerweile gut erforscht. Das erklärt sich vor allem dadurch, dass sich aus der Konfrontation des politischen und des religiösen Anspruchs auf den ganzen Menschen viel lernen lässt, nicht nur über das moderne Christentum, sondern auch über den Totalitarismus.
In der Wissenschaft ist umstritten, was unter «Totalitarismus» zu verstehen ist, welche Herrschaftsgebilde man als totalitär bezeichnen soll und welchen Erkenntnisgewinn der Begriff erbringt. Am Beispiel des italienischen Faschismus hat der Historiker Emilio Gentile die in den 1950er Jahren entwickelte Theorie des Totalitarismus aktualisiert, und zwar so, dass sie auch die nationalsozialistische und die sowjetkommunistische Herrschaft erklären hilft:
Als «Totalitarismus» möchte ich […] definieren: ein Experiment politischer Herrschaft, das von einer revolutionären Bewegung begonnen und von einer streng hierarchischen Partei organisiert wird, einer integralistischen Konzeption von Politik folgt, auf das Machtmonopol zielt und nach dessen Erwerb auf legalem oder außerlegalem Weg die zuvor bestehende Herrschaft zerstört oder umgestaltet und einen neuen Staat errichtet, der auf Einparteienherrschaft basiert und als Hauptziel die Gewinnung der Gesellschaft verfolgt, das heißt die Unterwerfung, Eingliederung und Vereinheitlichung der Beherrschten aufgrund des Prinzips der politischen Bedeutsamkeit der individuellen und kollektiven Existenz, die mit den Kategorien, Mythen und Werten einer palingenetischen [= die nationale Wiedergeburt verheißenden] Ideologie interpretiert und in Form einer politischen Religion sakralisiert wird. Ziel ist, das Individuum und die Massen mittels einer anthropologischen Revolution zu formen und so das menschliche Wesen wiederherzustellen, ja einen neuen Menschen zu schaffen, der sich mit Leib und Seele für die Verwirklichung der revolutionären und imperialen Politik der totalitären Partei einsetzt, um so eine neue Zivilisation supranationalen Charakters zu begründen. (E. Gentile, La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo stato nel regime fascista, 22018, 18; Übersetzung durch den Verf.).
Auf den SED-Staat passen manche Elemente dieser Definition nicht oder bedürfen der Anpassung. Für die Beschäftigung mit der DDR-Kirchengeschichte erweist sie sich allerdings als hilfreich, weil sie den Punkt benennt, wo der SED-Staat unweigerlich in Konflikt mit den Kirchen kam: die Schaffung des neuen Menschen. Die «anthropologische Revolution» war von Anfang an eine Verheißung des Christentums. So schreibt der Apostel Paulus um das Jahr 55 an die von ihm gegründete christliche Gemeinde in Korinth: «Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden» (2 Kor 5,17). In der Kirche, so der Anspruch, werde das mit Christus anhebende Neue in der vergehenden alten Welt anschaulich. Dass es der christliche Glaube sei, der die anthropologische Revolution bewirke, und dass diese grundlegende Erneuerung des Menschen ihre soziale Organisationsform in der christlichen Kirche finde, wurde vom Totalitarismus gleich welcher ideologischen Prägung bestritten. Dagegen wurde der Anspruch gesetzt, dass die Erneuerung von der revolutionären Bewegung und der von ihr getragenen Partei ausgehe. Das galt auch in der DDR: Nicht ohne Grund wurden die Kulturhäuser in Borstendorf im Erzgebirge und in Lübbenau in der Niederlausitz in den 1950er Jahren «Neues Leben» benannt, das Zwickauer Kulturhaus hieß «Neue Welt», und die 1958 von der SED verkündeten «Zehn Gebote der sozialistischen Moral» waren «für den neuen sozialistischen Menschen» bestimmt (Schroeder: Der SED-Staat, 972, Dok. 12). Den damit verbundenen Anspruch, die kollektive und die individuelle Existenz im Sinne einer politischen Ideologie gänzlich umzugestalten, hatte wenige Jahre zuvor schon der Nationalsozialismus propagiert. Dagegen hatte die 1934 in Wuppertal-Barmen versammelte Synode der Bekennenden Kirche...
| Erscheint lt. Verlag | 18.3.2021 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Beck'sche Reihe |
| Zusatzinfo | mit 2 Karten |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Zeitgeschichte ab 1945 |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Schlagworte | Avantgarde • DDR • Diktatur • Evangelismus • Friedensbewegung • Geschichte • Kirche • Kommunismus • Opposition • Politik • Regime • Religion • Schwerter zu Pflugscharen • SED • Sozialismus • Staat • Totalitarismus • Umweltbewegung • Unterdrückung |
| ISBN-10 | 3-406-76413-4 / 3406764134 |
| ISBN-13 | 978-3-406-76413-4 / 9783406764134 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich