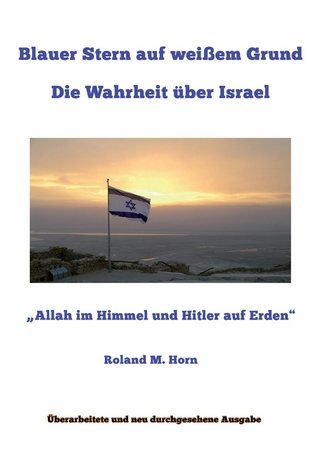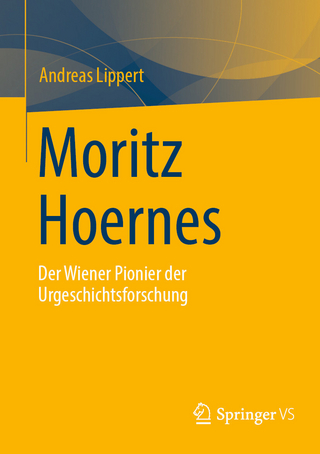Die Geschichte des Alten Ägypten Teil 2: Das Neue Reich und die Spätzeit (eBook)
748 Seiten
Books on Demand (Verlag)
978-3-7568-1646-0 (ISBN)
Dr. Michael E. Habicht, studierte Klassische Archäologie und Ägyptologie den Universitäten Zürich und Basel. Er hat sich auf das Neue Reich, die Königsgräber und Unterweltsbücher, sowie auf die Zeit von Echnaton, Nofretete und Tutanchamun spezialisiert. Er hat zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten zum Alten Ägypten, Mumien und Paläopathologie publiziert (Lancet, PLoS One, Circulation Research). Er ist Senior Research Fellow an der Flinders University, Adelaide (Australien) und wissenschaftlicher Experte am FAPAB Research Center in Avola (Italien).
Die 17. Dynastie: Die Vertreibung der Fremdherrscher
Das Mittlere Reich war eine Zeit der kulturellen Blüte (11. und 12. Dynastie). Diese politische und wirtschaftliche Stabilität neigte sich unter den letzten Herrschern, König Amenemhet IV. und der nachfolgenden dreijährigen Regentschaft der Königin Neferu-Sebek dem Ende zu. Nun folgten nach dem antiken Geschichtsschreiber Manetho rund 60 verschiedene Könige mit kurzen Regierungszeiten, die als die 13. Dynastie gezählt werden. Der gut gefestigte Verwaltungsapparat konnte die Einheit des Landes trotz dieser schwachen Könige noch etwa 80 Jahre lang aufrechterhalten.
Um 1715 v. Chr. begann die Einheit des Landes zu zerfallen, als sich einige Gebiete im Delta loslösten und eigene kleine Lokalkönigreiche bildeten. Diese unbedeutenden Kleinkönige werden als 14. Dynastie gezählt. Diese kleinen Stadtkönigtümer waren nicht in der Lage, sich gegen die Angehörigen von asiatischen Zuwanderern, welche sich im Delta ansiedelten, durchzusetzen. Diese Westsemiten waren einst aus der Levante eingewandert. Ihre ethnische Herkunft ist unklar, es können auch verschiedene semitische Völkerschaften gewesen sein (Vorgeschlagen wurden unter anderem Amoriter, Kanaaniter oder Huriter). Ihnen gelang es im Delta die Königsmacht an sich zu reißen. All diese Könige der 13. und 14. Dynastie wurden ebenso wie die Hyksos vom Neuen Reich als nicht rechtmäßige Könige eingestuft und in den Königslisten von Abydos und Sakkara überhaupt nicht gelistet. Daher ist auch die Reihenfolge dieser Könige umstritten. Die Fremdherrscher sind unter der griechischen Bezeichnung „Hyksos“ bekannt, welches sich vom ägyptischen Begriff Heka-Khasut („Herrscher der Fremdländer“) abgeleitet ist. Sie selbst legten sich diesen Titel zu, den einst asiatische Nomadenhäuptlinge im Mittleren Reich benutzt hatten. Die Hyksos übernahmen die ägyptischen Königstitulaturen. Während ihrer Herrschaft wurden auch die Literatur und Wissenschaft der Ägypter gepflegt. Aus ihrer Zeit stammt der mathematische Papyrus Rhind, und die einzige erhaltene Abschrift des aus dem Mittleren Reich stammenden, bekannten Papyrus Westcar mit den Wundergeschichten vom Hof des Königs Khufu (Cheops). Für Statuen interessierten sich die Hyksos weniger und machten sich kaum die Mühe, eigene Statuen meißeln zu lassen, sondern usurpierten Statuen der früheren Könige des Mittleren Reiches. Im Gegenzug brachten die Fremdherrscher einige wichtige Erfindungen ans Niltal: Neben der schnelldrehenden Töpferscheibe und dem Kompositbogen waren es vor allem das Pferd und der leichte Streitwagen. In der Ägyptologie gibt es zwei Theorien, wie die Hyksos die Macht ergreifen konnten. Die klassische Theorie geht von einem gewaltsamen Eindringen aus dem Ausland her aus. Die Semiten haben das Machtvakuum genutzt. Eine andere Theorie geht davon aus, daß das Gebiet im Ostdelta schon seit längerer Zeit von semitischen Ausländern unterwandert war, welche den Zerfall der Zentralmacht nutzten, um den ägyptischen Staat von innen her gewaltsam zu übernehmen (Höber-Kamel 2003, 6). Wie auch immer, die Semiten wurden als Fremdlinge wahrgenommen und schürten eine ausländerfeindliche Einstellung der Ägypter. Aus dieser Abwehrhaltung erklärt es sich, warum die Ägypter in der Folge durch Eroberungen ihr Reich vergrößerten und an den Grenzen Pufferstaaten errichteten. Nie wieder sollte das Reich am Nil von Fremden regiert werden.
Manetho überlieferte für die 15. Dynastie der Hyksos insgesamt sechs Könige. Der erste Hyksosherrscher war Sechai-en-Ra (Salitis bei Manetho), welcher etwa 15 Jahre lang regierte und die Stadt Memphis eroberte. In ihrer Hauptstadt Avaris im Ostdelta verehrten die Hyksos den Wüsten- und Chaosgott Seth, der mit dem kanaanitischen Gott Baal vermischt wurde und so teilweise auch asiatische Charakteristika bekam. Damit stellten sich die Hyksos in einen kulturell-religiösen Gegensatz zu den ägyptischen Königen, welche sich als Sohn des Ra und als irdische Inkarnation des Horus (dem mythischen Gegenspieler des Seth) sahen. Auch die Vorfahren der Ramessiden (19. Dynastie) scheinen aus Avaris zu stammen und waren eifrige Sethanhänger. Danach herrschte ein Hyksos namens Bnon während rund 14 Jahren. Ihm folgte Seweser-en-Ra Chajan und er führte das Hyksosreich zu seiner größten Machtfülle. Funde mit seinem Namen wurden auch in Knossos (Kreta) und Bagdad und Boghasköi (Anatolien) gefunden. Er herrschte rund 20 Jahre.
Der für die Geschichte des Neuen Reiches wichtigste Hyksoskönig ist Apophis (1573-1533 v. Chr.). Unter seiner Herrschaft entstand der schon erwähnte Papyrus Rhind, sowie die medizinischen Papyri Ebers und Smith. Apophis herrschte über weite Gebiete von Palästina und bis nach Oberägypten hinauf. Sein Name Apophis (ägyptisch Apepi) erinnert an die Chaosschlange Apophis in den Unterweltsbüchern des Neuen Reiches. Dort überwinden die Götter dieses unterweltliche Wesen, das die Schöpfung bedroht. Das Herrschaftssystem der Hyksos war kein Zentralstaatmodell, sondern ein feudalistisches System mit lokalen Herrschern in den Stadtstaaten, welche dem Oberkönig unterstanden und diesem tributpflichtig waren. Diese Vasallen werden als die 16. Dynastie zusammengefasst. Tief im Süden, in der Stadt Theben, wo der lokale Gott Amun immer bedeutender wurde bildete sich die 17. Dynastie, welche weitgehend unabhängig von den weit entfernten Hyksos agieren konnte (Lalouette 1986; Dodson 1991). Von ihr ging die Initiative aus, welche zur Vertreibung der Fremdkönige führen sollte.
Gegen Ende der Regierungszeit des Apophis erhob sich die 17. Dynastie unter dessen Gegenkönig Seqenenre Taa II., der als 14. Herrscher dieser Dynastie regierte. Er war der Sohn von Senachet-en-Ra und der Königin Teti-scheri. Sein Name Seqenenre Taa (ägyptisch Sek-en-en-Ra „Der von Ra gestärkte“) enthält eine geheime Formel: Der Zusatz Taa oder Taao ist gemäß Grimm und Schoske: „Sein Eigenname Taao ist sehr wahrscheinlich eine verschlüsselte Schreibübung für den Götternamen Djehuti-aa (Thot-Der-Grosse). Hinter Taao verbirgt sich somit ein geheimer, nur Eingeweihten verständlicher Name für den Gott Thoth.“ (A. Grimm and Schoske 1999, 37).
Dieses Herrscherpaar hatte den Widerstand initiiert. Seqenenre Taa eröffnete den offenen Kampf gegen die Hyksos, welcher in einem, leider nur fragmentarisch erhaltenen Papyrus Sallier I. als unterhaltsame Wundergeschichte erzählt wird. Sie wurde in der Herrschaftszeit von Merenptah (19. Dynastie) niedergeschrieben und ist nicht nur lückenhaft, sondern auch voll von Schreibfehlern, so daß eine Schülerübung vermutet wird. Die Einleitung mit „so geschah es“ gibt der Geschichte einen märchenhaften Anstrich:
„So geschah es, daß das Land Kemet im Elend war, weil es dort keinen Herrn gab, der König des ganzen Landes war. Da war König Sekenenre als Herrscher der Südlichen Stadt (Theben), aber das Elend war in der Stadt der Asiaten von König Apophis, Avaris. Er hatte die Herrschaft über das ganze Land ergriffen und seine Tribute, und ebenso den Norden und alle guten Produkte vom nördlichen Land. Nun machte König Apophis Seth zum Gott und diente nicht länger einem der Götter, welche im ganzen Land waren, außer dem Seth. Er bildete ihm sogar einen Tempel als Symbol von gutem und ewigem Götterdienst, eben dem Palast von König Apophis und am Morgen erschien er dort um täglich Opfergaben an Seth zu geben. Die Höflinge führten [...] genau wie es gemacht wurde im Tempel des Ra-Harachte. Nun wünschte König Apophis einen beleidigenden Brief an König Seqenenre, den Fürsten der Südlichen Stadt zu schicken.
Danach folgt eine stark beschädigte Passage, deren Reste darauf deuten, daß sich Apophis über den Lärm der Nilpferde ärgert, welche in Theben gehalten werden. Weil die Städte rund 600 Kilometer voneinander entfernt sind, ist die Fadenscheinigkeit besonders offensichtlich. Dahinter steckt aber auch eine religiöse Aussage. Denn die Nilpferde galten als Symboltier des Seth, welche in Theben offenbar gehalten wurden, um diese in Ritualen zu töten. Daher missfiel den Hyksos dies.
Und nun, nachdem einige Tage nach diesem verstrichen waren, sandte König Apophis die Botschaft, die er mit seinen weisen Schreibern besprochen hatte, an den Prinzen der Südlichen Stadt. Als der Bote des Königs Apophis den Fürsten der Südlichen Stadt erreicht hatte, wurde er vor den Fürsten der Südlichen Stadt gebracht. Da sagte man zu dem Boten des Königs Apophis: Was hast du zur Südlichen Stadt gebracht. Warum hat dieser Reisende mich erreicht?“
Und der Bote sagte zu ihm: „Es ist König Apophis, der mich sendet, dir zu sagen „Du sollst ein Ende machen dem Teich mit den Flußpferden welcher im See der Stadt ist, weil diese es nicht zulassen daß der Schlaf zu mir kommt, Tag oder Nachts, ihr Lärm ist in den Ohren der (ganzen) Stadt. Nun war der Fürst der Südlichen Stadt so erstaunt über diese große Beleidigung, daß es geschah, daß er nicht wußte, was der dem Boten von König Apophis antworten sollte. Nun sprach der Prinz der Südlichen Stadt zu ihm: „Laß deinen Herrn diese Worte hören [...] im See der Südlichen Stadt. Nun (sprach) der Bote: [...] die Worte welche er dir gesendet hat.“
Nun bereitete der Prinz der Südlichen Stadt Reiseproviant für den Boten von König Apophis, gute Dinge. Fleisch, Getreide [...] „Wie zu jedem, wirst du ihm sagen, was ich getan habe [...] Nun machte sich der Bote des Königs Apophis auf, zu seinem Herrn zu reisen. Der Fürst der Südlichen Stadt rief seine großen Beamten als auch seine vorderen und niedrigsten Offiziere zu sich und wiederholte vor ihnen die ganze Botschaft, welche König Apophis ihm geschickt hatte. Sie waren alle stumm bei dieser...
| Erscheint lt. Verlag | 10.9.2022 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Archäologie |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| ISBN-10 | 3-7568-1646-X / 375681646X |
| ISBN-13 | 978-3-7568-1646-0 / 9783756816460 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 42,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich