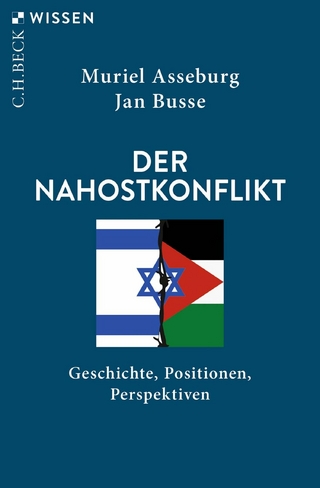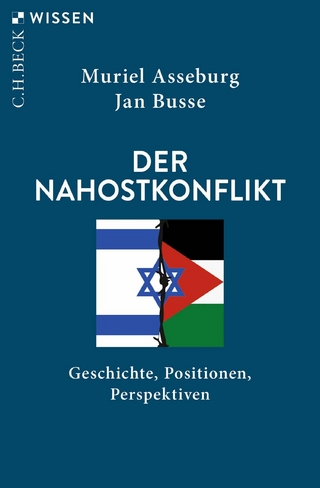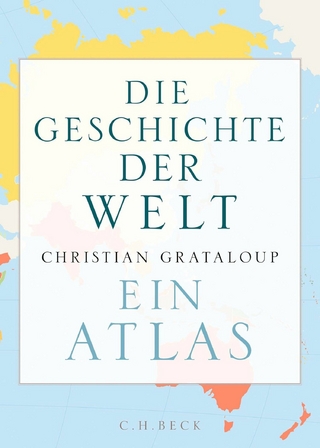Das jüdische Frankfurt – von der Emanzipation bis 1933 (eBook)
395 Seiten
De Gruyter (Verlag)
978-3-11-079252-2 (ISBN)
Die Stadt Frankfurt nimmt in der deutsch-jüdischen Geschichte einen einzigartigen Platz ein. Ihre Geschichte wurde - wie die wohl keiner anderen Stadt in Deutschland - geprägt durch ihre jüdischen Bürgerinnen und Bürger. Diese hatten einen wesentlichen Anteil daran, dass Frankfurt zu einer der bedeutendsten Metropolen Deutschlands aufstieg. Frankfurt war aber auch die erste Stadt in Deutschland, die Juden zwang, in einem Ghetto zu leben, und eine der letzten, die diesen Zwang aufhob. Von den etwa 30.000 Juden, die 1933 in Frankfurt lebten, haben nur etwas mehr als 100 den Nationalsozialismus in der Stadt überlebt. Tausende wurden in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet, viele weitere mussten fliehen. Der Band widmet sich der Geschichte der Juden in Frankfurt von der Emanzipationszeit bis 1933 und untersucht Frankfurt als herausragendes Beispiel und als zentraler Ort für die deutsche und europäische jüdische Geschichte, für deren kulturelle, soziale und religiöse Entwicklung und für die Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich Frankfurt zu einer so bedeutenden jüdischen Stadt entwickelt hat, aber auch wie es zu einem Ort der Ausgrenzung und Verfolgung wurde.
Christian Wiese, Stefan Vogt, Uni Frankfurt/M.; Mirjam Wenzel; Jüdisches Museum Frankfurt/M.; Doron Kiesel; Gury Schneider-Ludorff.
Einleitung
Perspektiven zur Erforschung der Geschichte des „jüdischen Frankfurt“ vor 1933
In vielerlei Hinsicht lässt sich die jüdische Geschichte der Stadt Frankfurt am Main vom Beginn der Emanzipation am Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Zusammenbruch der Weimarer Republik als eine spektakuläre Erfolgsgeschichte erzählen. Innerhalb weniger Generationen gelang einem Großteil der jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt der Aufstieg ins Bürgertum, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren sie nicht nur fester Bestandteil der bürgerlichen Stadtgesellschaft, sondern auch demographisch ein maßgeblicher Faktor: Die jüdische Gemeinde Frankfurts, nach Berlin die zweitgrößte in Deutschland, zählte nach dem Ersten Weltkrieg 30.000 Mitglieder oder sechs Prozent der Gesamtbevölkerung.1 Die Entwicklung Frankfurts zur modernen Großstadt verdankt viel seinen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern, die als Stifterinnen und Stifter, als Unternehmerinnen und Unternehmer, als Kommunalpolitiker und Vorreiterinnen städtischer Sozialpolitik oder durch vielfältiges zivilgesellschaftliches Engagement wesentlich zum Aufbau ihrer Institutionen beigetragen haben. Ein herausragendes Beispiel dafür ist die Frankfurter Universität, deren Gründung im Jahr 1914 maßgeblich auf Stiftungen Frankfurter Jüdinnen und Juden zurückgeht.2 Auch im intellektuellen und kulturellen Leben der Stadt waren ihre jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner in hohem Maße präsent. So war die wichtigste Tageszeitung der Stadt, die Frankfurter Zeitung, die auch überregional große Bedeutung erlangte, von dem Politiker, Verleger und Mäzen Leopold Sonnemann und dem Bankier Heinrich Bernhard Rosenthal gegründet worden, und die Brüder Martin und Ernst Flersheim unterhielten zwei der bedeutendsten privaten Galerien Frankfurts.3 Die Frankfurter Universität bot jüdischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gleichberechtigte Wirkungs- und Karrieremöglichkeiten, die ihnen im deutschen akademischen Kontext ansonsten verwehrt waren und Frankfurt damit zu einem Zentrum des wissenschaftlichen Fortschritts machten. Gleichzeitig entwickelte sich Frankfurt zu einem Brennpunkt für die Kultur- und Geistesgeschichte des deutschen Judentums insgesamt. Hier blühte die jüdische Reformbewegung und entstand zugleich die Bewegung der Neo-Orthodoxie, beides jüdische Antworten auf die Herausforderungen der Moderne. Hier wurden wegweisende jüdische Bildungsinstitutionen wie das Philanthropin und das Freie Jüdische Lehrhaus geschaffen, und hier wirkten bedeutende jüdische Gelehrte, von Abraham Geiger und Samson Raphael Hirsch bis Martin Buber und Franz Rosenzweig. Bis 1933, so lässt sich zusammenfassen, war Frankfurt eines der wichtigsten Zentren jüdischen Lebens in Europa, und umgekehrt prägte dieses jüdische Leben Frankfurt wie kaum eine andere Stadt in Deutschland.
Doch mit einem solchen Narrativ wäre die Geschichte des jüdischen Frankfurt vor 1933 nur unvollständig erzählt. Zu ihr gehören – selbst vor der Zäsur der Etablierung des nationalsozialistischen Regimes – vielfältige Erfahrungen der Exklusion und der Entrechtung. Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, in der sich die Frankfurter jüdische Gemeinschaft endgültig zu einem Zentrum jüdischen Lebens im deutschsprachigen Raum entwickelt hatte,4 waren Jüdinnen und Juden immer wieder Opfer von Diskriminierung, Verfolgung und versuchten Vertreibungen geworden. Seit 1462 waren sie gezwungen, in einem Ghetto am damaligen Stadtrand, in der Judengasse, zu leben.5 Dieser Zwang entfiel erst mit den Auswirkungen der Französischen Revolution. Wie überall waren die Frankfurter Jüdinnen und Juden aus der christlichen Stadtgesellschaft ausgeschlossen, auch wenn es in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht viele Berührungspunkte und eine intensive Interaktion zwischen der jüdischen Minderheit und der christlichen Mehrheitsgesellschaft gab. Die Aufhebung der durch Jahrhunderte der Diskriminierung verfestigten Grenzen und die rechtliche Gleichstellung im Laufe des 19. Jahrhunderts verliefen in Frankfurt noch stockender als an vielen anderen Orten. Symbolisch für die dadurch verursachte Desillusionierung steht die Konversion des Feuilletonisten und Literaturkritikers Ludwig Börne zum Protestantismus im Jahr 1818. Die mit der Revolution von 1848 und der Nationalversammlung verbundenen Hoffnungen zerschlugen sich rasch, und 1852 versagte der Frankfurter Rat der jüdischen Bevölkerung die Gleichberechtigung und hob die erkämpften Rechte wieder auf. Erst mit dem „Organischen Gesetz“ vom 7. Oktober 1864 wurden die Beschränkungen der staatsbürgerlichen Rechte der Jüdinnen und Juden dauerhaft aufgehoben.6 Doch auch danach bestanden in Frankfurt antijüdische Haltungen und Praktiken weiter fort, und mit der Entstehung des politischen Antisemitismus seit den 1870er Jahren kamen neue Formen hinzu.7 Die Angriffe auf die Position der Jüdinnen und Juden in der deutschen Gesellschaft, die im Laufe der Weimarer Republik immer heftiger geführt wurden und schließlich zu ihrem erneuten Ausschluss sowie daran anschließend zu ihrer Verfolgung und Ermordung führten, kamen also auch in Frankfurt keineswegs aus dem Nichts.8
Dass Frankfurt dennoch im Gefolge jüdischer Emanzipationsbestrebungen, einer dynamischen religiös-kulturellen Pluralisierung, der zunehmenden Öffnung gegenüber der nichtjüdischen Kultur und der sich allmählich verbessernden Chancen zur Partizipation im 19. Jahrhundert zu einem „Laboratorium für die Entwicklung des modernen Judentums“ wurde,9 lässt sich insbesondere an den kontroversen Debatten über eine Reform des Judentums im frühen 19. Jahrhundert ablesen. Jüdische Institutionen und Intellektuelle in Frankfurt spielten in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Mit Recht bemerkt Robert Liberles: „Keine jüdische Gemeinde spiegelte die im Wandel begriffenen Strömungen religiösen Lebens in Deutschland besser wider als Frankfurt, und wenige Gemeinden waren so aktiv daran beteiligt, diese Veränderungen herbeizuführen.“10
Am Anfang der Entwicklung stand 1804 – noch in der Judengasse – die auf Anregung von Mayer Amschel Rothschild erfolgte Gründung des von den Ideen der Haskala beeinflussten Philanthropin, das als jüdische Schule bis zu seiner Schließung durch die Nationalsozialisten 1942 ein weithin sichtbares Element der Frankfurter jüdischen Kultur blieb.11 Die Bildungsziele des Philanthropin in seiner Frühphase hingen mit dem Bestreben vieler seiner Mitglieder, darunter des ersten Direktors, Michael Hess, zusammen, mittels einer modernen Bildung die Integration der jüdischen Gemeinschaft in die allgemeine Gesellschaft zu fördern und somit ihre Emanzipationswürdigkeit nachzuweisen.12 Demselben Ziel diente auch die Schaffung der reformorientierten „Loge zur aufgehenden Morgenröthe“ im Kontext Frankfurter Freimaurerkreise.13 Noch bevor sich in Berlin 1845 die „Genossenschaft für Reform im Judenthume“ konstituierte, aus der fünf Jahre später unter der Führung von Samuel Holdheim mit der „Jüdischen Reformgemeinde zu Berlin“ eine Gemeinde entstehen sollte, die sich radikal von tradierten Riten und Formen distanzierte,14 sorgte in Frankfurt eine radikale, von Laien geprägte Strömung der Reform für erbitterte Auseinandersetzungen. Ausgelöst wurden sie durch das Programm des „Vereins der Reformfreunde“, das Frankfurt vorübergehend ins Zentrum der Aufmerksamkeit der gesamten Reformbewegung rückte.15
Maßgeblich bestimmt wurden die Ideen des Vereins von dem Literaturhistoriker Theodor Creizenach, der als Erzieher im Hause Anselm Salomon von Rothschilds und als Lehrer am Philanthropin wirkte. 1843 veröffentlichte die kleine, kurzlebige Bewegung intellektueller Laien eine Grundsatzerklärung, die, abgesehen von der Ablehnung einer auf Palästina ausgerichteten persönlichen Messiaserwartung, jegliche dogmatische wie praktische Autorität des Talmud bestritt und die Möglichkeit einer „unbeschränkten Fortbildung“ der „mosaischen Religion“ postulierte, damit aber implizit zugleich auch den Offenbarungscharakter wie die autoritative Gültigkeit der Bibel infrage stellte.16 Hinter dem Begriff des „Mosaismus“, der unter dem Einfluss der in der protestantischen Bibelwissenschaft der Zeit gängigen Unterscheidung zwischen einer früheren prophetischen mosaisch-israelitischen und einer späteren, priesterlich-rabbinischen Religion aufkam, verbargen sich eine bewusste oder unbewusste Verinnerlichung der negativen nichtjüdischen Wahrnehmung der rabbinischen Tradition und das Anliegen nachzuweisen, dass das Judentum zu einer Rückkehr zum tief in seiner Geschichte verwurzelten Universalismus fähig sei. Zeitgleich fand eine heftige Debatte über die judenfeindlichen Thesen des Junghegelianers Bruno Bauer statt, der die Emanzipation ablehnte, weil das Judentum aus seiner Sicht keine vernunftgemäßen universalen Gesetze besaß, sondern zwangsläufig,...
| Erscheint lt. Verlag | 6.6.2023 |
|---|---|
| Zusatzinfo | 30 b/w ill. |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Regional- / Ländergeschichte |
| Schlagworte | Antisemitism • Antisemitismus • Frankfurt am Main • Jewish Life • Jüdisches Leben • Stadtgeschichte • Urban History |
| ISBN-10 | 3-11-079252-4 / 3110792524 |
| ISBN-13 | 978-3-11-079252-2 / 9783110792522 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 10,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich