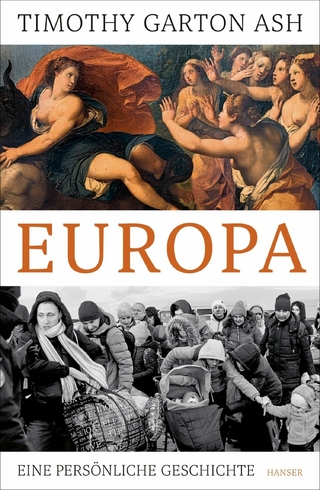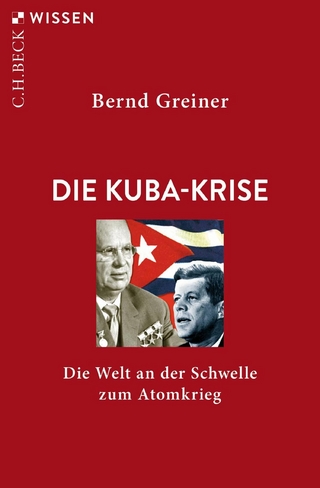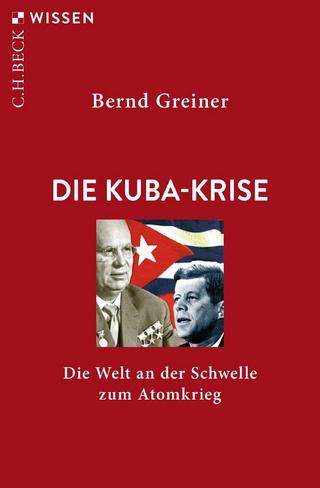Das Schattenregime (eBook)
320 Seiten
Ullstein (Verlag)
978-3-8437-3174-4 (ISBN)
Christian Neef, geboren 1952 im brandenburgischen Perleberg, studierte in Leipzig Journalistik und Geschichte. Der ausgewiesene Experte für Russland, Osteuropa und Afghanistan lebte 16 Jahre in Moskau. U. a. war er zehn Jahre stellvertretender Auslandschef des Spiegel. Heute arbeitet er als freier Autor zu Themen über Russland und Osteuropa. Er veröffentlichte mehrere Bücher zur russischen Geschichte, zuletzt über den Untergang der deutschen Gemeinde von St. Petersburg nach 1917.
Christian Neef studierte in Leipzig Journalistik und Geschichte. Der ausgewiesene Experte für Russland, Osteuropa sowie Afghanistan lebte 16 Jahre in Moskau. U.a war er zehn Jahre der stellvertretende Auslandschef des "Spiegel". Neef veröffentlichte mehrere Bücher zur russischen Geschichte, zuletzt "Der Trompeter von St. Petersburg".
1
Die Tragödie der Nachkriegszeit
Ich bin mit einer Mauer aufgewachsen. Nicht in Berlin, wo es sie zu der Zeit noch gar nicht gab, sondern in einer kleinen Stadt im Brandenburgischen. Bei meiner Geburt war der Krieg fast sieben Jahre vorbei. Mein Heimatort ist eine ehemalige Hansestadt, sie liegt malerisch auf einer Flussinsel: überall Fachwerk, das prächtige Rathaus, ein Werk der Berliner Architekten Carl und August Stüler, selbstbewusst vor die gotische Kirche gestellt, den Markt bewacht ein stattlicher Roland. Eine fast 800 Jahre alte Idylle.
Wenige Schritte vom alten Zentrum entfernt jedoch, in einem Villenviertel aus der Gründerzeit, stand eine Mauer. Man hatte sie nur grob hochgezogen und nachlässig verputzt, um Schönheit ging es hier nicht. Hinübersehen war unmöglich und auch nicht erwünscht.
Als Kind hielt ich diese Mauer für ganz selbstverständlich, näher über sie nachgedacht habe ich nicht. Dabei zog sie sich mehrere Kilometer durch die Stadt, von den Kasernen des ehemaligen Kurmärkischen Feldartillerieregiments Nr. 39 am Amtsgericht und dem Gemeindehaus der Evangelischen Kirche vorbei bis zum Gelände einer alten Brauerei. Hinter der Mauer, das wusste man, wohnten »die Russen«, jene Rotarmisten, die 1945 in die Stadt gekommen und in ihr geblieben waren. Sehr zum Entsetzen der Einwohner – die von ihnen herbeigesehnten Amerikaner waren wenige Kilometer vor der Stadt stehen geblieben.
Die Russen übernahmen die früheren Kasernen und ließen die Häuser und Villen in den angrenzenden Vierteln räumen. Es waren weit über hundert. Eine Parallelwelt entstand, die fast fünfzig Jahre lang existieren sollte. Auf die Mauern der Russen stieß man auch außerhalb der Stadt: am Flugplatz, den sie für die Einrichtung eines weiteren Militärstädtchens beschlagnahmt hatten, und im schier endlosen Kiefernwald auf der anderen Seite der Fernverkehrsstraße, die Richtung Elbe führte. Dort betrieben sie einen Schießplatz nebst Panzerrollbahn.
Damals fiel mir auf, dass meine Mutter in zwei Zeitrechnungen dachte. »Das war im Frieden«, sagte sie, wenn sie von einem Ereignis in den 1930er-Jahren sprach. Woraus ich schloss, dass die 1950er für sie noch keinen Frieden bedeuteten.
Als Kind gefiel es mir, wenn im Sommer die Sirene ging und die Männer der Freiwilligen Feuerwehr von der Arbeit weg zum Depot hasteten, um die Löschfahrzeuge zu holen – das Depot war nicht weit von unserem Haus entfernt. Oft hatten die Russen den Wald vor der Stadt in Brand geschossen. Wir sahen sie nur, wenn sie in langen Kolonnen zur Übung ausrückten oder wenn Offiziere in unserem Teil der Stadt nach Soldaten fahndeten, die auf der Suche nach Lebensmitteln oder Alkohol über die Mauer geklettert waren. Oder wenn wir im »Russenmagazin« einkauften, einem kleinen Warenhaus am Eingang zur »Verbotenen Stadt«. Ansonsten gab es mit den Besatzern keine Berührungen, keine Gespräche, keinen Kontakt. Dafür kursierten unter den Erwachsenen Gerüchte und Erzählungen von tödlichen Zwischenfällen, es gab Geraune von Festnahmen und Enteignungen.
Dass in meiner Heimatstadt nicht nur Moskaus Streitkräfte Einzug gehalten hatten, sondern auch ein Kommando des sowjetischen Geheimdienstes – einer seiner letzten Chefs vor Ort hieß Daniil Popowitsch –, wusste ich natürlich nicht, es hätte mir damals ohnehin nichts gesagt. Genauso wenig wusste ich, dass eine meiner späteren Lehrerinnen noch 1952 von eben diesem Geheimdienst abgeholt und in ein Lager im russischen Workuta gebracht worden war (eines der härtesten Zwangsarbeitslager des Gulag), während ihr Mann kurz darauf erschossen wurde. Bis zum Mauerfall blieb das geheim. Auch hatte uns niemand aufgeklärt, dass rund um unsere kleine Stadt Truppen fast in Armeestärke in Stellung gegangen waren.1
1983 – die Russen saßen noch immer in meiner Heimatstadt – ging ich als Korrespondent in die Sowjetunion. Ihr stand zu jener Zeit Juri Andropow als Parteichef vor, er war wenige Monate zuvor noch Vorsitzender des sowjetischen Geheimdienstes KGB gewesen. Mit einigen Unterbrechungen lebte ich fast zwanzig Jahre lang in Moskau. Als ich die Stadt nach meinem letzten Einsatz verließ, schrieb man das Jahr 2017. Die Sowjetunion hieß nun wieder Russland, und dessen Führer war seit Langem Wladimir Putin. Dass dieser bald einen Krieg entfesseln würde – den ersten seit 1945 in Europa –, hätte ich damals nicht für möglich gehalten, obwohl ich mir über sein Weltbild und seine Rücksichtslosigkeit keine Illusionen machte, denn ich hatte ihn oft genug aus nächster Nähe erlebt. So wie Andropow war auch Putin bis kurz vor seinem Amtsantritt Chef des Geheimdienstes gewesen.
Was ist das für ein Land, das sich seine Führer aus den Reihen des Geheimdienstes zu holen pflegt? Und warum macht es das?
Geheimdienste sind Einrichtungen, denen aus der Sicht des einfachen Bürgers etwas Unheimliches, Unberechenbares, ja Schmutziges anhaftet. Es sind Dienste, die Verdächtige und Andersdenkende bespitzeln, Putsche anzetteln und Gegner umbringen, die Misstrauen gegenüber den Mitmenschen für ihr oberstes Gebot halten, allerorten Verschwörungen wittern und bereit sind, verbrecherische Handlungen mit angeblichen Staatsinteressen zu rechtfertigen. Wer wie Wladimir Putin im Geheimdienst groß geworden ist, misstraut anderen und unterstellt auch ihnen jene Skrupellosigkeit, ja Gewaltbereitschaft, zu denen er selbst fähig ist. Auf dieser anerzogenen Form von Paranoia fußt Putins Unfähigkeit zum Kompromiss, die er als Präsident so oft zeigt.
In Russland und der Sowjetunion war der Geheimdienst immer auch politische Polizei – eine Polizei, die für die Sicherheit des Systems und seiner Führung zu sorgen hatte. Sie tat und tut das mit den ihr eigenen Methoden: Denunziation und Verleumdung, Stigmatisierung und Ausgrenzung, Willkür und Entrechtung. »Die eigentliche Schöpfung, die aus der sogenannten Russischen Revolution hervorgegangen ist«, sagt der Philosoph Peter Sloterdijk sehr treffend, »ist die Gleichsetzung eines geheimdienstlichen Unternehmens, eines Komplotts mit dem ganzen Staatswesen.«2
Je mehr ich in Russland in die Geschichte eintauchte, umso öfter stieß ich auf das Wirken des Geheimdienstes. Man hatte ihm in den vergangenen Jahrhunderten die unterschiedlichsten Namen gegeben. Russlands erste politische Polizei waren die Opritschniki, Iwan der Schreckliche hatte sie 1565 als brutale Leibgarde und Terrorarmee aufgestellt. Unter den letzten Zaren war sie Ochrana genannt worden, von den Bolschewiki Tscheka, was nichts weiter hieß als »Außerordentliche Kommission«. Aus der Tscheka wurde die OGPU, daraus das NKWD, dann das Ministerium für Staatssicherheit MGB und schließlich das KGB – ein Kürzel, mit dem meine Generation aufgewachsen ist im Kalten Krieg. Wladimir Putins Inlandsgeheimdienst heißt FSB.
Während die Verfolgungsbehörden früher meist im Verborgenen wirkten, zählen jene, die heute in diesen Diensten arbeiten, ganz offen zur Elite des Landes. Keine andere Gruppe in Russland hat eine solche Macht erlangt wie das Militär, die Polizisten, Nationalgardisten und Geheimdienstler. Dass Wladimir Putin – zu der Zeit seit vier Monaten Regierungschef – am 20. Dezember 1999 auf einer Versammlung von Geheimdienstlern vermeldete, »die Gruppe von Mitarbeitern des FSB, die zur Arbeit in die Regierung abkommandiert wurde, hat die erste Etappe ihres Auftrages erfolgreich erfüllt«3, sollte zwar scherzhaft klingen. Aber im Grunde war es bitterernst. In den vergangenen mehr als zwanzig Jahren unter Putin haben die Sicherheitsorgane das gesamte Land übernommen. Vertreter und Vertrauensleute dieser Organe sitzen an den Schaltstellen des Parlaments und der Regionalverwaltungen, des Justizapparates und der Polizei. Darüber thront das Untersuchungskomitee, die wichtigste föderale Ermittlungsbehörde Russlands, die bis hin zur Presse alle Ebenen überwacht und von der Präsidialadministration gesteuert wird.
Wie der sowjetische Geheimdienst nach dem Krieg in Deutschland wirkte, ist den meisten jedoch unbekannt. Seine Truppen und Operativgruppen waren 1945 gemeinsam mit denen der Roten Armee im Osten Deutschlands einmarschiert. Das hatten die Deutschen erst gar nicht bemerkt. Den Unterschied zwischen Soldaten und Geheimdienstlern sahen sie nicht, schließlich trugen beide in Deutschland die gleichen Uniformen. Erst nach und nach wurde ihnen bewusst, dass neben den Militärs eine Institution ins Land gekommen war, die weit mehr zu sagen hatte als die Armee und die hinter den Kulissen der Aufbauzeit ihre eigene Schreckensherrschaft errichtete, um das Land zu sowjetisieren. Denn die sowjetischen Geheimdienstler setzten im besiegten Deutschland jene Praktiken fort, die sie in der Sowjetunion erprobt hatten. Dort hatten sie in den 1920er- und 1930er-Jahren jede vermeintliche Opposition niedergeschlagen und Hunderttausende Unschuldige hingerichtet. Es war staatlich gewollter Terror.
Der sowjetische Geheimdienst gab sich auch in Deutschland selbstherrlich und gnadenlos. Wenn er es für nötig hielt, unterlief er die Politik der eigenen Militärregierung, mitunter sabotierte er deren Kurs ganz bewusst. Nach Aussagen...
| Erscheint lt. Verlag | 29.2.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Zeitgeschichte ab 1945 |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Schlagworte | AfD • Besatzung • BRD • DDR • KGB • Ostdeutschland • Russland • Sowjetunion • Stalin • Terror • Verschleppung • Weltkrieg |
| ISBN-10 | 3-8437-3174-8 / 3843731748 |
| ISBN-13 | 978-3-8437-3174-4 / 9783843731744 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich