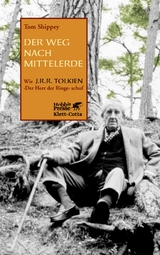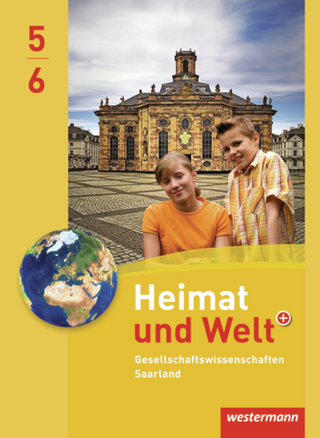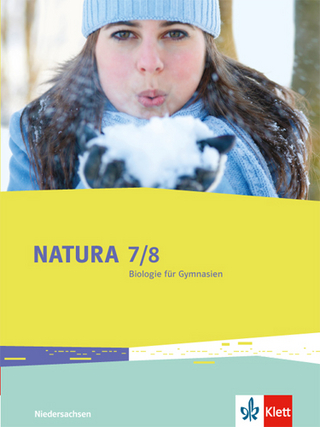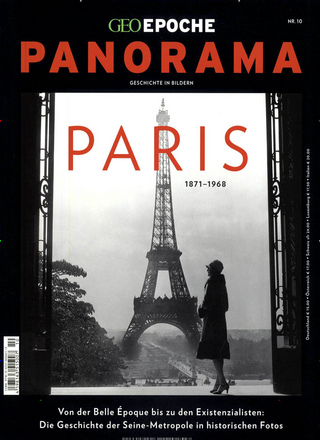Der Weg nach Mittelerde
Klett-Cotta (Verlag)
978-3-608-93601-8 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
- Das wichtigste Buch zu Tolkiens Werk
- unverzichtbar für alle Tolkien-Fans
- Übersetzt vom Tolkien-Experten Helmut W. Pesch
- Einbeziehung des »Herr der Ringe«-Films
J. R. R. Tolkien war über drei Jahrzehnte lang Professor in Oxford. Sein Fachgebiet war die Philologie, die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft. Zu Tolkiens Zeit war diese Wissenschaft jedoch an ihre Grenzen gestoßen. So schuf Tolkien sich seine eigene Welt, eine Welt aus Sprache.
Wie dieser schöpferische Prozess vonstatten ging, davon erzählt Tom Shippey in "Der Weg nach Mittelerde": eine faszinierende, mit ungewöhnlicher Klarheit und Fachkenntnis geschriebene Erkundung von J. R. R. Tolkiens Kreativität und den Quellen seiner Inspiration. Shippey zeigt im Detail, wie Tolkiens wissenschaftlicher Hintergrund ihn dazu führte, ein Werk zu schaffen, dessen Faszination nun bereits mehr als ein halbes Jahrhundert überdauert und Millionen von Lesern in ihren Bann gezogen hat.
Eine Reise zu den Wurzeln von "Der Herr der Ringe" - das Standardwerk zu J. R. R. Tolkien, ergänzt um ein Kapitel zur Verfilmung durch Peter Jackson, liegt nun erstmals in deutscher Sprache vor.
Wie kaum ein anderer ist Tom Shippey dazu prädestiniert, über Tolkien (und ganz in seinem Sinne) zu schreiben: hat er doch selbst in Oxford gelehrt, teilweise noch während Tolkiens eigener Lehrtätigkeit, und Tolkiens eigene Fächer. Shippey hatte den Lehrstuhl für Mediävistik an der Universität von Leeds inne, denselben, den Tolkien früher bekleidet hatte. 2001 wurde er mit dem "World Fantasy Award" ausgezeichnet. Shippey lehrt zur Zeit an der Universität von St. Louis, USA.
DANKSAGUNG UND QUELLEN
VORWORT
KAPITEL EINS
?LIT.? UND ?LANG.?
KAPITEL ZWEI
PHILOLOGISCHE SPUREN
KAPITEL DREI
DER BÜRGER ALS MEISTERDIEB
KAPITEL VIER
WANDERUNGEN AUF DER KARTE
KAPITEL FÜNF
VERFLECHTUNGEN UND DER RING
KAPITEL SECHS
ÜBER STOCK UND STEIN
KAPITEL SIEBEN
VISIONEN UND REVISIONEN
KAPITEL ACHT
WENN DER ZAUBER VERGEHT
KAPITEL NEUN
?IM VERLAUF DER TATSÄCHLICHEN ABFASSUNG?
NACHWORT
ANHANG A: TOLKIENS QUELLEN: DIE WAHRE TRADITION
ANHANG B: VIER »STERNCHEN«-GEDICHTE
ANHANG C: PETER JACKSONS VERFILMUNGEN
ANMERKUNGEN
KONKORDANZ DEUTSCHSPRACHIGER AUSGABEN
REGISTER
KAPITEL VIER: WANDERUNGEN AUF DER KARTE Karten und Namen Zwischen der Veröffentlichung von The Hobbit und des ersten Bandes von The Lord of the Rings vergingen siebzehn Jahre. Es ist wohl wahr, dass in der Zwischenzeit ein Weltkrieg stattfand und Tolkiens Familie Zuwachs bekam, während Tolkien selbst sich vielen beruflichen Pflichten widmen musste , die er, wie er später betonte, nicht vernachlässigte. Dennoch liegt der Hauptgrund für den langen zeitlichen Abstand in dem Tempo und der Natur von Tolkiens eigener Kreativität. Er kam von Mittelerde nicht los - ja, ihr widmete er seine akademischen »Schaffensjahre« -, aber die Entstehung des Herrn der Ringe erwies sich als eine Sache mit eigenen Gesetzen, denen man ihren Lauf lassen musste . Dank der Veröffentlichung von » The History of Middle-earth «, insbesondere von Band VI bis IX, wissen wir nun einiges mehr über diesen Prozess als zu dem Zeitpunkt, als das vorliegende Buch ursprünglich geschrieben wurde. Zunächst einmal kann man sehen, dass der Erfolg des Hobbit Tolkien wohl ziemlich überrascht hatte und er auf die sehr naheliegende Frage des Verlags nach einer Fortsetzung sicherlich nicht vorbereitet war. Wie wir wiederum nun viel besser wissen und wie unten in Kapitel sieben dargelegt wird, hatte er viele Jahre lang an dem gearbeitet, was später Das Silmarillion werden sollte, und einiges an Material dazu vorliegen. Im November 1937 (die Originalausgabe des Hobbit war im September jenes Jahres erschienen) schickte er eine Auswahl dieser Texte an seinen Verleger Stanley Unwin , nur um einen Monat später eine höfliche Absage zu erhalten, vermutlich auf der Grundlage einer unvollständigen Lektüre. 1 Stanley Unwin wollte eine Fortsetzung, keine Vorgeschichte, und mehr über Hobbits , nicht über Elben . Tolkien begann dementsprechend vom Ende des Hobbit an weiterzuschreiben . Das erste Kapitel trug den Titel A long-expected party , »Ein lang erwartetes Fest«, wie er bis zur endgültigen Veröffentlichung bestehen bleiben sollte. Allerdings dürfte es jeden überraschen, der mit Der Herr der Ringe vertraut ist und dann die frühen Entwürfe in The Return of the Shadow durchliest, wie wenig Tolkien an Plan oder Konzept im Kopf hatte, als er zu schreiben begann. Bilbos Ring sollte gewiss eine Rolle spielen. Aber er ist (einer Notiz zufolge, die vielleicht ein paar Monate nach Beginn geschrieben wurde), »nicht sehr gefährlich, wenn zu guten Zwecken gebraucht«; siehe Shadow , S. 42. Wie Christopher Tolkien ausführt, bleibt der Ring eine ganze Zeit lang nicht mehr als ein »recht praktisches magisches Utensil«, wobei die »zentrale Konzeption des Herrscherringes noch nicht vorhanden« war. Wann genau Tolkien diese zentrale Idee kam, ist immer noch nicht klar; siehe Shadow , S. 70, 87, 227. Inzwischen begann die Figur, die Aragorn oder » Strider « (dt. »Streicher«) werden sollte, ihre Laufbahn als »ein merkwürdig aussehender, braungesichtiger Hobbit « namens Trotter , der immer hölzerne Schuhe trug und dem man genau wie Aragorn zuerst im Gasthaus »Zum Tänzelnden Pony« in Bree begegnet. » Trotter « bereitete Tolkien immense Probleme: Mindestens drei Mal notierte er: »Wer ist Trotter ?«, als Frage an sich selbst, und kam zu völlig unterschiedlichen Antworten - er war ein Vetter Bilbos ; er war ein Hobbit , der auch ein Waldläufer war; er war ein Elbe in Verkleidung - bis er sich schließlich darauf festlegte, dass er ein Mensch und ein Abkömmling der Menschen des Nordens war. Selbst nachdem die Figur als der hochgewachsene und langbeinige Aragorn Gestalt angenommen hatte, hielt Tolkien hartnäckig an dem immer unpassenderen Namen » Trotter « fest, schrieb sogar etwas zu dessen Rechtfertigung, was als Erklärung von » Telcontar « bis in die endgültige Fassung überdauern sollte (zur Entwicklung siehe Shadow , 137, 210, 214, 223; Treason , 6; War , 390; und LotR , 863 [3:154]). Wie Christopher Tolkien wiederholt feststellt, konnte sein Vater äußerst zäh über mehrere Revisionen hinweg an einer Szene festhalten und zugleich deren Kontext und Bedeutung grundlegend ändern. Doch in diesen frühen Stadien kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Tolkiens Weg zu einer Handlung eher Schlafwandeln glich als einem zielgerichteten Vorgehen. Mit einer gewissen Beschämung (siehe das »Vorwort« zu dieser Ausgabe) blicke ich zurück auf meinen frühen Versuch, etwas dergleichen aus Tolkiens fertigem Ergebnis abzuleiten. Kein Wunder, dass der Professor gerne mehr mit mir über »den Plan« geredet hätte, »wie er erscheint oder zu finden sein mag«! Er hätte mir gesagt, dass die Konstruktion, die zu finden ich mir solche Mühe gab, einfach nicht da war, sicherlich nicht von Anfang an und womöglich überhaupt nicht. Dennoch, um Bilbo zu zitieren, »not all those who wander are lost« . Nicht jeder, der ziellos herumstreift, hat sich auch tatsächlich verirrt. Tolkien hatte zwar weder einen großen Plan noch eine zentrale Idee, hatte keine Pläne gemacht für eine Fortsetzung zum Hobbit und konnte sein » Silmarillion «- Material nicht direkt verwenden, aber er war nicht völlig ohne Quellen, aus denen er schöpfen konnte. Etwas von dem, was in seinem Kopf vorging, wird deutlich aus einem der größeren Unterschiede zwischen Der Hobbit und Der Herr der Ringe , nämlich ihrer Verwendung von Karten und Namen. Karten und Namen In Der Hobbit kommen erstaunlich wenig Namen vor. Natürlich gibt es die zwölf Zwerge, alle aus dem Dvergatal -Gedicht entlehnt und vermutlich von den meisten Lesern als eine homogene Gruppe wahrgenommen, die nur von Fili und Kili , die jünger sind als die anderen, dem dicken Bombur und dem freundlichen Balin aufgelockert wird und natürlich von Thorin , dem Anführer. Es gibt nur wenige elbische Namen und Bezeichnungen, und keine von denen, die vorkommen - Bladorthin , Dorwinion , Girion , Galion , Moria und Esgaroth -, haben in der Geschichte eine wichtige Funktion. Der Elbenkönig bleibt in Der Hobbit namenlos und wird erst in Der Herr der Ringe als Thranduil benannt ( LotR , 240 [1:292]). Die einzigen Hobbit-Nachnamen , die genannt werden, sind Baggins , Took und Sackville-Baggins (wobei sich Letzterer als Anomalie in Mittelerde und falscher Zungenschlag erweisen soll), sowie » Messrs Grubb , Grubb and Burrowes « als Auktionatoren kurz vor dem Ende. Elrond , Azog , Radagast , die lautmalerischen Namen der Raben Roac und Carc - damit ist die Liste in Der Hobbit so gut wie vollständig. Eine übliche Praxis Tolkiens in diesem Stadium war es, einfach Namen mittels Großschreibung zu bilden. So lebt Bilbo in einem Tunnel, der in den Hang eines Hügels führt: » The Hill , as all the people for many miles round called it «. Der Bach am Fuß von » The Hill « wird » The Water « genannt, das Dorf der Hobbits am » The Water « heißt » Hobbiton « (nahe » Bywater «), und so geht es weiter nach » Wilderland «, wo wir die » Misty Mountains«, den » Long Lake«, den » Lonely Mountain «, einen Fluss namens » Running « und ein Tal namens » Dale « finden. Selbst » Gandalf « ist, genau genommen, ein Name dieses Typs. Auch er kommt aus dem Dvergatal , wo er in unmittelbarer Umgebung von Thráinn , Thorinn und Thrór aufscheint , doch Tolkien betrachtete ihn offenbar mit einem gewissen Vorbehalt, da er das Element - álfr enthielt, wogegen seiner Meinung nach Elben und Zwerge nur auf den Seiten des OED in Eintracht beisammen lebten. Was also tat ein » Gandalf « in einem Zwergenkatalog , und was war überhaupt ein gand - ? Bei einem Blick in das Icelandic Dictionary von R. Cleasby und Gudbrand Vigfusson wäre Tolkien auf die Interpretation gestoßen, dass die Bedeutung von gandr »etwas zweifelhaft« sei, aber vermutlich » irgendetwas Verzaubertes oder ein von Zauberern benutztes Objekt«, während gandálfr entweder ein »Zauberer« oder vielleicht ein »verhexter Dämon« war. Er schloss offenbar daraus, dass diese Wörterbuch-Definition wieder einmal falsch war und dass gandr »Stab« bedeutete (das übliche Requisit eines Zauberers, wie man dies selbst an Shakespeares Prospero oder Miltons Comus ablesen kann). Entsprechend heißt es, als Gandalf zum ersten Mal auftritt: »Alles, was der ahnungslose Bilbo an diesem Morgen sehen konnte, war ein alter Mann mit einem Stab « (Hervorhebung von mir). 2 Es stellt sich schließlich heraus, dass er kein Elb ist, aber am Ende von Der Herr der Ringe ist klar, das er aus dem Elbenland kommt. » Gandalf « ist somit also kein Name, sondern eine Beschreibung, wie bei Beorn , Gollum , dem Nekromanten und anderen Leuten, Orten und Dingen in Der Hobbit . Da das » Silmarillion « mit seiner weit entwickelten Nomenklatur bereits existierte, wäre es falsch zu sagen, dass Tolkien in den 1930ern nicht an Namen interessiert gewesen wäre. Es sieht jedoch so aus, als ob er sich nicht sicher gewesen sei, wie er sie in einem Roman einsetzen sollte, insbesondere, was englische Namen betraf. Doch er hatte das Problem erkannt. Als Der Hobbit sich der Vollendung näherte, konzentrierte er sich mit plötzlicher Hellsichtigkeit auf das Problem - wie man an Bauer Giles von Ham sehen kann, das zwar erst 1949 veröffentlicht, aber anscheinend in der Zeit von 1935-38 geschrieben wurde, das heißt, sich mit dem Abschluss des Hobbit überschnitt (siehe Bibliography , 73-4). Dies wirft viele interessante Streiflichter auf die Entwicklung von Tolkiens literarischem Werk. Denn zum einen ist es die einzige seiner Geschichten, die unverkennbar in England angesiedelt ist, und während seine Historie sich in Kinderreimen* wiederfindet, ist seine Geografie bemerkenswert klar. Ham ist heute Thame , eine Stadt in Buckinghamshire , zwölf Meilen östlich von Oxford. Worminghall ist vier Meilen entfernt und Oakley , dessen Pfarrer gefressen wurde, fünf. Die Hauptstadt des Mittleren Königreiches, »etwa zwanzig Meilen ( leagues ) entfernt von Ham «, klingt nach Tamworth , der historischen Hauptstadt der Könige von Mercien , achtundsechzig Meilen Luftlinie von Thame entfernt (eine league , nebenbei bemerkt, entspricht drei englischen Meilen oder knapp fünf Kilometern). Farthingho in Northamptonshire , wo einst »ein Vorposten zum Mittleren Königreich ... unterhalten wurde«, liegt auf einer direkten Linie zwischen den beiden Orten, etwa ein Drittel des Wegs von Thame - ein Beweis für den Mangel an territorialem Ehrgeiz des »Kleinen Königreichs «. Wales, wo die Riesen leben, und die ( Penninischen ) Berge, wo die Drachen leben, sind nach diesem kleinteiligen Maßstab hinreichend weit weg. Und wenn Bauer Giles sich weigert, sich Geschichten über das Volk »nördlich über die Hügel und noch weiter, ungefähr jenseits der Stehenden Steine«, anzuhören, meint er vermutlich Warwickshire , dessen Grenze zu Oxfordshire an den Rollright Stones verläuft. Alles in allem ist es äußerst unfair von dem imaginären Herausgeber von Bauer Giles , dessen imaginären Autor wegen seiner mangelhaften geografischen Kenntnisse zu schelten; jener Autor, wie Tolkien, »scheint ... selbst im Gebiet des Kleinen Königreichs gelebt zu haben« und wusste , worüber er schrieb. Doch was bezweckt diese plötzliche Genauigkeit? Offenbar wollte Tolkien ein zeitloses und idealisiertes England (oder eher Britannien) schaffen, in dem die Orte und die Menschen ungeachtet aller politischen Verwerfungen dieselben blieben. Die Geschichte von Bauer Giles ist somit weitgehend der Triumph des Einheimischen über das Fremde - denn »die Umgangssprache wurde an seinem Hofe Mode, keine seiner Ansprachen waren in Bücherlatein gehalten« - und zugleich der Sieg des bleibenden Wertes über die sich wandelnde Mode und des Heldenepos und der Volksballade über pompöse und pedantische rationalistische Wissenschaft. In all diesen Dingen führt Bauer Giles die Richtung der » Man-in-the - Moon «- Gedichte und des Hobbit weiter - wie auch in seinen bissigen Seitenhieben auf das OED mit dessen arroganterweise als »zivilisiert« bezeichneten Definition von blunderbuss , »Donnerbüchse«. 3 Doch zugleich kann die Geschichte als eines von mehreren Werken gesehen werden, in denen Tolkien seinen eigenen Wechsel von der Wissenschaft zur Kreativität (siehe oben S. 54-69) thematisiert. Ist Bauer Giles von Ham , wie »Blatt von Tüftler«, eine Allegorie? Der Hauptgrund für diese Vermutung ist Giles' Helfer, der Pfarrer, von dem es heißt: »Er war ein Sprachkundler ( grammarian ) und konnte zweifellos weiter in die Zukunft sehen als andere.« Sein entscheidender Beitrag zum Gelingen des Unternehmens besteht darin, dass er Giles rät, ein langes Seil mitzunehmen, wenn er den Drachen jagen geht. Ohne dieses Seil, könnte man sagen, hätte es keinen Schatz gegeben, keinen zahmen Drachen, kein Thame , kein Kleines Königreich. Darüber hinaus ist der Pfarrer auch in gewisser Hinsicht verantwortlich für Schwanzbeißer , Giles' Schwert. Er vermutet, worum es sich bei dem Schwert handelt, während Giles und der Müller noch darüber diskutieren, bestätigt die Vermutung, als es nicht in die Scheide will, solange ein Drache in der Nähe ist, und trotz seines Fachjargons über » epigraphische Zeichen« und archaische Buchstaben liest er tatsächlich die Runen auf dem Schwert und deckt dessen Identität als Schwanzbeißer (oder auf Lateinisch Caudimordax ) auf. Indem er dies alles tut, macht er Giles Mut. Insgesamt verdient er einen Großteil der Lorbeeren - sicherlich viel mehr als Augustus Bonifacius Ambrosius Aurelianus Antoninus , der stolze Tyrann, der Giles das Schwert geschickt hat, wenngleich nur, weil so einfache schwere Schwerter aus der Mode waren. Die Schlussfolgerung drängt sich auf, dass der Pfarrer mit seiner Mischung von Gelehrsamkeit, Bluff und gesundem Menschenverstand einen idealisierten (christlichen) Philologen verkörpert. In diesem Fall sähe der stolze Tyrann des Mittleren Königreichs, der seine schärfste Waffe aus der Hand gibt, sehr wie der literarische Kritiker aus, der keine Notiz von der Sprachgeschichte nimmt! Man könnte noch weitergehen: Bauer Giles wäre der kreative Instinkt, das Seil (ebenso wie Schwanzbeißer ) die philologische Wissenschaft, der Drache die alte Welt der nordischen Phantasie, die auf ihrem Schatz von verlorenen Legenden brütet, das kleine Königreich der fiktionale Raum, den Tolkien gestalten, unabhängig machen und bewohnen wollte. Natürlich wäre eine solche Allegorie ein Scherz 4 , aber ein Scherz in Tolkien'schem Stil, ein optimistisches Gegenstück zu »Blatt von Tüftler« ein paar Jahre später. Die ganze Geschichte ist voll von linguistischem Humor, von den düsteren Sprüchen des Hufschmieds, der »gemeinhin als Sonniger Sam bekannt« war, und seiner begriffsstutzigen Missdeutung von Hilarius und Felix - »Unheilvolle Namen. Ihr Klang will mir gar nicht gefallen« - bis zu Giles' hartnäckigen Eigenheiten als Muttersprachler . Die wahren Irrtümer jedoch, bemerkt Tolkien am Ende, kommen aus der späteren »gelehrten« Geschichte. Somit müsste » Thame « eigentlich » Tame « lauten, »denn Thame mit einem h ist ein unklarer, närrischer Einfall«. In Wirklichkeit ist die ganze Geschichte, die Tolkien erzählt, um Namen wie Thame und Worminghall zu erklären, natürlich auf nichts gegründet, bloße Fiktion. Dennoch, selbst in der Wirklichkeit bleibt Thame-mit-h eine Torheit ohne Berechtigung, Teil jener Welle von Buch-Latinismen , die Thames und Thomas , could , debt und doubt und vielen anderen Worten jene stummen, unhistorischen , unenglischen eingefügten Buchstaben gegeben haben, welche die Rechtschreibung dieser Sprache bis heute plagen. Tolkien wäre es lieber gewesen, wenn es sie nicht gäbe. Er beklagte das mangelnde moderne Verständnis von englischen Namen, englischen Orten, englischer Kultur. In Bauer Giles von Ham kann man ihn über Probleme der Rück- Schöpfung und der Kontinuität nachdenken sehen - denn Namen und Orte bleiben, ganz gleich, was Menschen darüber denken. Auch wenn er darüber Scherze machte, stellen Thame und Worminghall nach » The Hill « und » The Water « einen großer Fortschritt dar. Farthingho setzte Tolkien auf die Spur zu den Farthings , den Vierteln in » The Shire «. Die weitere Entwicklung zu Der Herr der Ringe ist offensichtlich. Wo Der Hobbit etwa vierzig oder fünfzig eher beiläufige Namen hatte, listet das Register von Der Herr der Ringe unter »Personen, Tiere, Untiere « über sechshundert Namen auf und fast genauso viele »Orte«, dazu ein paar hundert unklassifizierbare , aber benannte »Sachen«. In ähnlicher Weise sind Thrors Karte und die Karte von Wilderland in Der Hobbit , die der Geschichte außer einem dekorativen Element und einem altmodischen » Land-der-Ungeheuer «- Gefühl nichts hinzufügten, der ausfaltbaren Karte von Mittelerde in Die Gefährten und der noch detaillierteren topografischen Karte von Gondor und Mordor in Die Rückkehr des Königs gewichen. Hinzu kommen die Karte des Auenlands am Ende des Prologs und die noch weiter führende Karte, die 1970 als von Pauline Baynes gestaltetes Poster erschien. All diese Karten basierten auf Entwürfen Tolkiens (siehe Treason , 295-323), und alle stecken voller Details, die im Text nie direkt verwendet wurden. Christopher Tolkien bestätigt die Wahrheit der Worte seines Vaters an Naomi Mitchison : »Ich begann wohlweislich mit einer Karte und legte die Geschichte so an, dass sie hineinpasste « ( Letters , 177 [234]; vgl. Treason , 315). Doch selbst die Figuren in Der Herr der Ringe haben eine starke Neigung, wie Karten zu reden, und wie historische obendrein. Auf S. 381 [1:459] beginnt Aragorn : »Im Südwesten seht ihr jetzt über die nördlichen Ebenen der Riddermark ... Bald kommen wir zur Mündung des Limklar , der von Fangorn herabkommt und sich in den Großen Strom ergießt.« Kurz zuvor hatte Celeborn den Lauf des Anduin verfolgt, »bis er [...] zu der hohen Insel Zinnenfels kommt, die wir Tol Brandir nennen ... über die Rauros-Fälle hinunter in das Nindalf oder Fennfeld , wie es in Eurer Sprache genannt wird. Es ist ein weites Sumpfgebiet ... Die Entflut ... ergießt sich dort ... in den Strom... An jenem Fluss , auf dieser Seite des Großen Stroms, liegt Rohan . Auf der anderen Seite erheben sich die kahlen Höhen der Emyn Muil .« ( LotR , 373 [1:450-1]) Der Fluss des Wissens und der Namen scheint unaufhaltsam zu sein, und die Angewohnheit wird von Gimli , Gandalf , Fangorn , selbst Meriadoc geteilt. Warum diese Ausführlichkeit? Die Antwort führt uns wieder zurück zum Hobbit . An einer Stelle nimmt Bilbo seinen ganzen Mut zusammen, um Gandalf zu fragen, warum etwas » The Carrock « genannt wird. Weil es einer ist, erwidert dieser übellaunig (S. 108-9 [125]): »Er hat es Carrock genannt, weil Carrock eben sein Wort dafür ist. Solche Felsen nennt er Carrocks , und dieser ist der Carrock , weil er der einzige in der Nähe seines Hauses ist und weil er ihn genau kennt.« Dies ist wenig hilfreich und nicht einmal wahr, denn carrecc ist Altwalisisch für »Fels«, erhalten in verschiedenen modernen Namen wie Crickhowell in Brecon (oder Crickhollow [dt. Krickloch ] im Auenland ). Allerdings hat Gandalf seinen Finger auf eine Eigentümlichkeit von Namen gelegt, und zwar dass sie willkürlich sind, selbst wenn sie es ursprünglich nicht waren. Irgendwann einmal waren alle Namen wie » Gandalf « oder » The Hill «; somit bedeutet Frogmorton »umzäunter Ort ( town ) im sumpfigen Land ( moor ) , wo es Frösche ( frogs ) gibt« (siehe » Guide «, 185). Tolkien war »der Tollkühne«, Suffield , der Name von Tolkiens Mutter, »(jemand vom) Südfeld« - und so weiter. Doch das entspricht nicht der Art und Weise, wie Namen heute wahrgenommen werden. In der modernen Welt sehen wir sie als Etiketten an, als etwas, das in einer sehr engen Beziehung mit dem steht, was es bezeichnet, es deckungsgleich beschreibt. Um einen etwas pompösen Ausdruck zu benutzen, sie sind » isomorph mit der Realität«. Und das bedeutet, dass sie für die Fantasy außergewöhnlich nützlich sind. Denn mit der wiederholten Unterstellung, dass die Dinge, die sie benennen, wirklich existieren, und indem sie deren Natur und Geschichte widerspiegeln, verleihen sie ihr Bodenhaftung. Tolkiens neue Gleichung von Fantasy und Wirklichkeit tritt am deutlichsten in seiner Karte, Beschreibung und Geschichte von » The Shire « zutage, dem Auenland , das man als ein vergrößertes »Kleines Königreich« ansehen könnte, welches nach Mittelerde verpflanzt wurde. Die einfachste Art, es zu beschreiben, wäre zu sagen, dass das » Shire « eine Kalkierung von England ist. Eine Kalkierung , auch Lehnübersetzung genannt, ist ein linguistischer Begriff, der jenen Prozess bezeichnet, wenn die Bestandteile eines zusammengesetzten Wortes Stück für Stück übersetzt werden, um in einer anderen Sprache ein neues Wort zu bilden, wie im Französischen haut-parleur von »Lautsprecher « ( parler haut = laut sprechen) oder im Irischen each-chumhacht von »Pferdestärke« ( each = »Pferd«, wie oben eoh , equus auf S. 26). Das Entscheidende bei Kalkierungen ist, dass der abgeleitete Begriff in keinster Weise wie das Original klingt und dennoch überall dessen Einfluss zeigt. Somit ist, historisch gesehen, das » Shire « gleich/ ungleich England, sind die Hobbits gleich/ungleich den Engländern. Hobbits leben im Auenland wie Engländer in England, doch wie die Engländer kommen sie von anderswoher, aus dem »Angle« bzw. Angeln (in Mittelerde zwischen Hoarwell und Loudwater , in Europa zwischen Flensburger Förde und Schlei ). Beide Gruppen haben diese Tatsache vergessen. Beide wanderten in drei Stämmen aus, Angeln, Sachsen und Jüten oder Stoors , Harfoots und Fallohides ; alle haben sich seitdem weitgehend vermischt. Die Engländer wurden von zwei Brüdern angeführt, Hengest und Horsa , d.h. »Hengst« und »Pferd«, die Hobbits von Marcho und Blanco , vgl. altenglisch * marh , »Pferd«, blanca (nur im Beowulf ), »weißes Pferd«. 5 Alle vier gründeten Reiche, die sich in einem untypischen Frieden entwickelten; es gab im Auenland keine Schlacht zwischen der von Grünfeld, 1147, und der Schlacht von Bywater , 1419 - ein Zeitraum von 272 Jahren, der fast dem zwischen der letzten Schlacht auf englischem Boden ( Sedgemoor , 1685) und der Veröffentlichung von The Return of the King (1955) entspricht. Auch organisatorisch ist das » Shire «, mit mayor , moot , muster und shirriffs , ein altertümliches und idealisiertes England, während die Hobbits mit ihrer Schlichtheit, ihrer Gefräßigkeit, ihrer Neigung zu peinlichem Auftreten, ihrem Misstrauen gegenüber Auswärtigen* und vor allem mit ihrer verblüffenden Fähigkeit, Widrigkeiten zu ertragen, ein leicht erkennbares, wenngleich wiederum altmodisches Selbstbild der Engländer sind. Am offenkundigsten freilich wird die Kalkierung , wenn man die Karte betrachtet. Hierzu braucht nicht mehr gesagt zu werden, als dass Tolkien die meisten der » Shire «- Namen aus seiner unmittelbaren Umgebung schöpfte. So lässt uns » Nobottle « im Nordviertel zunächst an Flaschen denken, was als Landschaftselement kaum plausibel wäre, doch der Name kommt von altenglisch niowe , »neu«, und botl , »Haus« (wie in bytla , vgl. » Hobbit «). Es gibt ein Nobottle in Northamptonshire , fünfunddreißig Meilen von Oxford entfernt (und nicht weit von Farthingstone ). Der Name bedeutet so ziemlich dasselbe wie Newbury , auch eine Stadt in England, fünfundzwanzig Meilen südlich von Oxford und auch ein Ort im » Shire « oder genauer im Buckland . Buckland selbst ist ein Ortsname in Oxfordshire und ansonsten in ganz England verbreitet, denn er hat die ziemlich langweilige Etymologie von bócland (»Buchland«), das urkundlich auf die Kirche »gebucht« war und somit verschieden vom folcland (»Volksland«), welches nicht übertragbar war. Diese Ableitung war in Mittelerde unmöglich, darum konstruierte Tolkien eine andere, bessere Deutung, wonach » Buckland « das Land war, wo die Buck-Familie lebte, und somit ein echtes »Volksland« darstellte, mit Bucklebury im Mittelpunkt, so wie Tuckborough im » Tookland «. Was » Took « betrifft, so hat dies ebenfalls im modernen Englisch einen leicht komischen Anstrich (viele schreiben es lieber » Tooke «), aber es ist nur die gewöhnliche nordenglische Aussprache des sehr häufigen » Tuck «. Fünf Minuten mit dem Oxford Dictionary of English Place-Names , E. Ekwalls English River Names oder P. H. Reaneys Dictionary of British Surnames bieten Erklärungen für die meisten Namen und Bezeichnungen der Hobbit-Welt , und Ähnliches gilt, auf einer höheren Ebene, für den Rest von Mittelerde. Somit ist Celeborns » Wetwang « auch ein Ort in Yorkshire , das » Dunharrow « der Reiter von Rohan hat offensichtliche englische Parallelen, die Flüsse Gladden , Silverlode , Limlight , etc., haben alle englische Wurzeln oder Entsprechungen, und so geht es weiter in immer größeren Kreisen. Die Arbeit, die Tolkien in all das hineingesteckt hat, ist immens. Sie erscheint darüber hinaus weitgehend verschwendet, weil trotz aller Bemühungen der Figuren die Hälfte der Namen nie in die Handlung eingeht! Dennoch, dachte Tolkien sicherlich - und sehr wahrscheinlich zu Recht -, war all diese Mühe nicht vergebens. Die Karten und die Namen geben Mittelerde jenes Gefühl der Solidität und der Verankerung in Zeit und Raum, das den Welten seiner Epigonen so augenfällig mangelt. Sie markieren Bestrebungen, die viel höher angesiedelt sind als die parodistischen Eröffnungsszenen und das wechselseitige Verständnis am Schluss des Hobbit . Sie liefern auch ganz einfach Mahlgut für Tolkiens kreative Mühle - die wie Gottes Mühlen langsam mahlt, aber am Ende außerordentlich fein. [...]
| Erscheint lt. Verlag | 6.3.2008 |
|---|---|
| Übersetzer | Helmut W. Pesch |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | The Road to Middle-Earth |
| Maße | 139 x 219 mm |
| Gewicht | 752 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Literatur |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Literaturwissenschaft | |
| Schlagworte | Der Herr der Ringe • Der Herr der Ringe (Tolkien) • Entstehung • Tolkien • Tolkien, John R. R. |
| ISBN-10 | 3-608-93601-7 / 3608936017 |
| ISBN-13 | 978-3-608-93601-8 / 9783608936018 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich